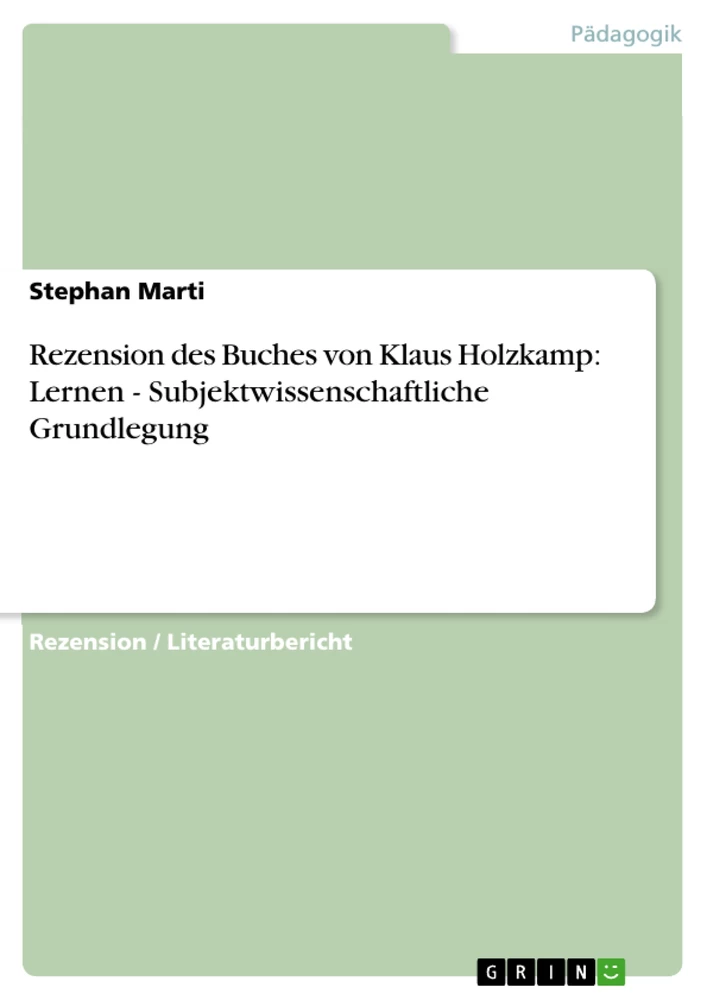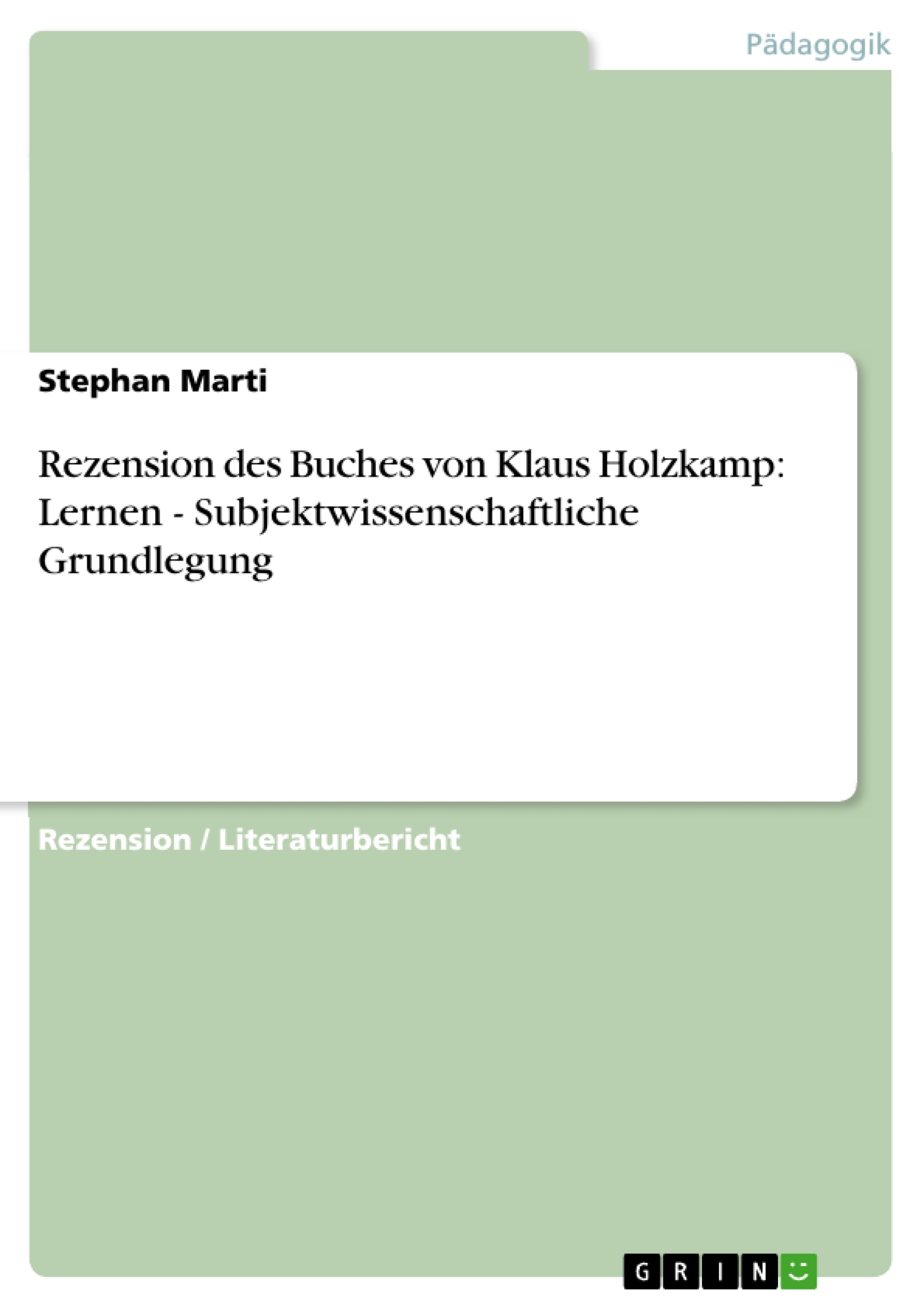Lernen, so der Titel des letzten Buchs von Klaus Holzkamp, ist nicht unbedingt ein Titel, der die Leser dazu veranlasst, das Buch aus einem Regal oder sich gegenseitig aus den Händen zu reissen, um gespannt darin zu blättern. Ebenfalls handelt es sich bei Holzkamps Werk um keinen Ratgeber, der aufzeigt, wie schnell und effizient gelernt werden kann. Genauso wenig erhebt es den Anspruch, jenes Wissen zu enthalten, welches unbedingt gelernt werden muss. Diesen Anspruch erheben andere populistischer. Ferner ist Holzkamps Buch kein wissenschaftlicher Klassiker, der von keinem Pädagogikstudenten gelesen werden muss, solange er sich mit dem gegenwärtigen Schulsystem zufrieden stellen kann. Vielmehr handelt es sich um einen psychologisch-pädagogischen Marmorfels mit dem Potential zum pädagogischen David, sofern der Leser den Sinn dieser 'subjektwissenschaftlichen Grundlegung' für sich zu erkennen vermag.
Marti Stephan
Lernen, so der Titel des letzten Buchs von Klaus Holzkamp, ist nicht unbedingt ein Titel, der die Leser dazu veranlasst, das Buch aus einem Regal oder sich gegenseitig aus den Händen zu reissen, um gespannt darin zu blättern. Ebenfalls handelt es sich bei Holzkamps Werk um keinen Ratgeber, der aufzeigt, wie schnell und effizient gelernt werden kann. Genauso wenig erhebt es den Anspruch, jenes Wissen zu enthalten, welches unbedingt gelernt werden muss. Diesen Anspruch erheben andere populistischer. Ferner ist Holzkamps Buch kein wissenschaftlicher Klassiker, der von keinem Pädagogikstudenten gelesen werden muss, solange er sich mit dem gegenwärtigen Schulsystem zufrieden stellen kann. Vielmehr handelt es sich um einen psychologisch-pädagogischen Marmorfels mit dem Potential zum pädagogischen David, sofern der Leser den Sinn dieser 'subjektwissenschaftlichen Grundlegung' für sich zu erkennen vermag.
In einem ersten Schritt hin zur theoretischen Grundlegung tastet sich Holzkamp über die Erkenntnisse der kritischen Psychologie der 1970-er Jahre an die lernpsychologischen Theorien heran, welche er im zweiten Kapitel der Kritik bzw. der Reinterpretation unterzieht. Im Anschluss an die Kritik legt Holzkamp die Grundbegrifflichkeit seiner 'subjektwissenschaftlichen Theorie lernenden Weltaufschlusses' dar. Darin entwickelt er den subjekttheoretischen Ansatz, indem er auf das Verhältnis zwischen dem Lernsubjekt und dem Lerngegenstand und dessen Bedeutungsstruktur eingeht. Dabei beschäftigt sich Holzkamp in erster Linie mit dem Lernen im Allgemeinen. Im letzten Kapitel lässt er sich jedoch ebenfalls auf das schulische, also institutionelle Lernen ein und plädiert hierbei für eine Schulreform unter Berücksichtigung der Subjekttheorie.
Kritik / Reinterpretation an den lerntheoretischen Grundsätzen
Als Basis der Kritik an den bekannten Theorien des Behaviorismus oder des Kognitivismus führt Holzkamp die Errungenschaften der kritischen Psychologie ins Feld. Der von Holzkamp als „materielles A priori“ bezeichnete Grundsatz, dass niemand bewusst seinen eigenen Interessen zuwider handle und die Erkenntnis, dass jedes Verhalten eines Subjekts subjektiv sinnvoll und begründet erfolge, lassen ihn zum Schluss kommen, dass das menschliche Verhalten auf Handlungsgründen basiere. Die Ergebnisse behavioristischer Forschung und Theorie die durch Tierexperimente (Ratten, Hunde, Tauben) generiert wurde und damit auf die Vorstellung zurück führt, dass Lernen von 'universell-organismischer Natur' sei, lehnt Holzkamp mit der Begründung ab, dass tierischem Verhalten keine bewussten Handlungsgründe zu Grunde liegen. Er beruft sich hierbei auf Forschungsergebnisse der Psychologie, die aufzeigen, dass sich Lernmechanismen 'artspezifisch' unterscheiden. Somit folgert er, dass aus den Erkenntnissen über die Konditionierung von Ratten nicht auf den Menschen geschlossen werden kann. Auch spricht Holzkamp dem experimentellen Rahmen in dem diese Forschungsart agiert einen manipulativen Charakter zu. Er weist darauf hin, dass die Handlungsgründe des Subjekts durch die künstlichen Bedingungen des Experiments so manipuliert werden, dass die Versuchsperson das von den Forschern gewünschte Verhalten hervorbringt.
Der kognitiven Theorie haftet Holzkamp die Errungenschaft der Unterscheidung zwischen „Lernen“ und „Ausführung“ positiv an. Dennoch kritisiert er die Anhänger dieser Forschungsrichtung - Badura, Tolmann, u.a. - bezüglich ihrer Darlegung der Lernmotivation als ein auf Neugierde und damit auf Triebhaftigkeit zugrunde liegendes Verhalten. Das behavioristische, als auch das kognitivistische Prinzip der Aussenansicht von Lernen - Lernen ist nicht sichtbar, nur die Ausführung ist ersichtlich – lässt Holzkamp nicht gelten. Vielmehr sollte nach der subjektiven Begründung für das gezeigte Verhalten gefragt werden. Holzkamp wehrt sich gegen die Reduktion der Motivation auf die Triebhaftigkeit auch deswegen so stark, weil die 'intrinsische Motivation' damit genetisch verursacht wäre. Generell stellt er in Frage, ob es die 'intrinsische Motivation' überhaupt gibt. Er negiert den Gedanken, dass jemand eine Sache um der Sache willen tut damit, in dem er aufzeigt, dass das Subjekt hierbei gewissermassen ein unbegründetes Handeln an den Tag legen würde. Dies wiederum widerspricht den oben genannten Erkenntnissen der kritischen Psychologie.
Eine weitere Kritik richtet Holzkamp an das kognitivistische Konzept von Gedächtnis. Hierbei spricht er sich dagegen aus, das Lernen des Menschen mit der Datenverarbeitung eines Computers zu vergleichen. Holzkamp geht in seiner Kritik auf das Dilemma ein, wonach ein Subjekt nicht gleichzeitig Anwender/Programmierer des Gedächtnissystems und verarbeitender Prozessor sein kann. Holzkamp wirft den Kognitivisten eine Vermischung dieser beiden Ebenen vor. Anhand von zwei kognitivistischen Tatsachen schlüsselt Holzkamp dieses Dilemma auf. Einerseits ist dies die kognitivistische Annahme, dass ein Input vom Lernenden so kodiert wird, dass es im Systemgedächtnis verarbeitet werden kann. In diesem Fall hat der Lernende keine Kontrolle darüber, ob und wie das System die Daten im 'Prozessor' abspeichert. Andererseits kennt die kognitivistische Theorie auch das Speichermodell, wie etwa jenes des Kurzzeitspeichers. Hiernach wird der Lernende ermächtigt, etwas aus dem Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher zu verlagern. Somit wäre der Lernende Akteur im Prozessor selbst. Für Holzkamp liefert diese pädagogische Theorie den Beweis ihrer Unstimmigkeit gleich selber.
Was im ersten Drittel des Buches Lernen wie eine pädagogische Abrechnung mit allen bisherigen Theorien daherkommt, ist nicht ausschliesslich destruktiv aufzufassen. Holzkamp unterzieht die bisherigen Theorien einer detaillierten Betrachtung hinsichtlich der Rolle des Subjekts als selbstbestimmter Lernender. Er klärt durch diese Reinterpretation der Theorien die Rolle des Subjekts darin. Dies geschieht an einigen Stellen würdigend, dient aber vorwiegend der Überleitung in die subjektwissenschaftliche Theorie.
Grundbegrifflichkeiten der Subjektwissenschaftlichen Theorie
Kern des Buches bildet Eindeutig die Erläuterung der Grundbegrifflichkeit der 'subjektwissenschaftlichen Theorie lernenden Weltaufschlusses'. Hierin klärt Holzkamp die Differenzen zwischen dem subjekttheoretischen Ansatz und den anderen Theorien. Selbst wenn Holzkamp den Konstruktivismus als Theorie nicht explizit anspricht, findet durch die genaue Analyse des Sinnbegriffs für den subjektiven Weltaufschluss eine greifbare Abgrenzung statt. Holzkamps Analyse von Lernen orientiert sich am Prinzip der 'Selbstsicht von je mir als Lernsubjekt'. Diese Methode basiert auf der Erkenntnis, dass ontogenetisches Lernen eine Verflochtenheit zwischen kindlichen Lernfortschritten und Unterstützungsaktivitäten Erwachsener darstellt. Diese Verflechtung erlaubt gemäss Holzkamp keine wissenschaftliche Betrachtung des Lernens an sich. Vielmehr plädiert er dafür, dass das 'je meine Lernen' zum Gegenstand der Analyse von Lernen zu machen sei. Nur das Subjekt an sich könne diese Entflechtung vornehmen und sich damit dem Lernen als Objekt widmen. Holzkamp nennt in seinem Buch diesbezüglich drei Modalitäten des Lernens, nämlich die mentale (kognitive), die kommunikative (intersubjektive) und die objektivierende Modalität (erstellen von Quellen, Tabellen, Notizen).
[...]
- Quote paper
- MA Educational Sciences und MA Educational Sciences Stephan Marti (Author), 2007, Rezension des Buches von Klaus Holzkamp: Lernen - Subjektwissenschaftliche Grundlegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214206