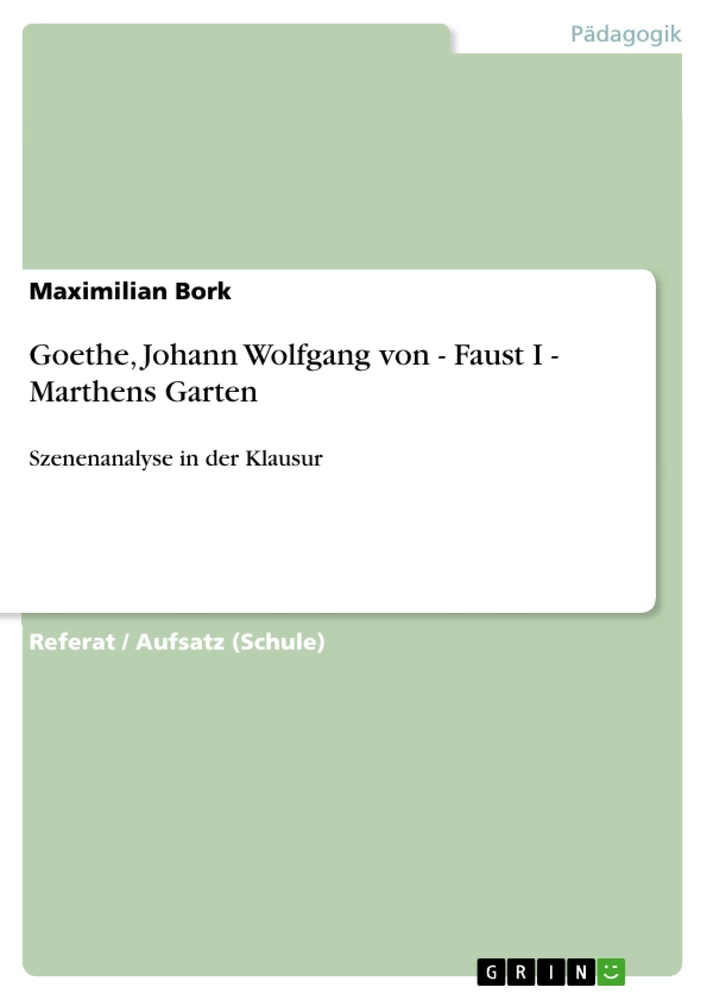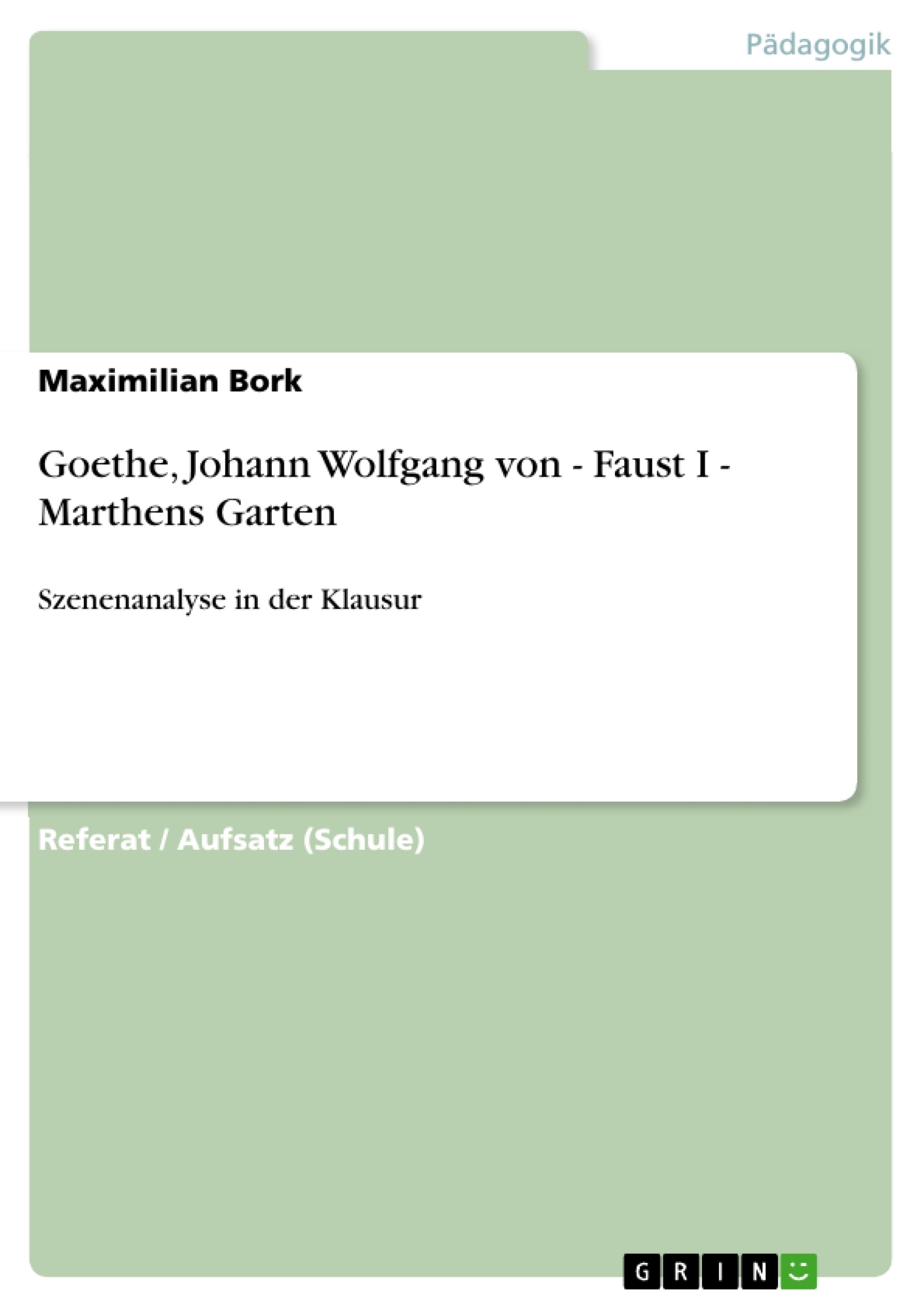A) Allgemeine Informationen zu „Faust I“
B) Erschließung der Szene „Marthens Garten“ aus Goethes „Faust I“
I. Inhaltsangabe
II. Erschließung der Szene „Marthens Garten“
1. Bedeutung der Szene für das Dramenganze und die unterschiedliche Auffassung von Religiösität
a) Höhepunkt der Gretchentragödie
b) Fausts universaler Glaube
c) Gretchens Glaube
d) Vorhersehbarkeit des katastrophalen Ausgangs
2. Dialogführung
a) Gretchen-Faust-Dialog
b) Faust-Mephisto-Dialog
3. Sprache
a) Satzbau
b) Wortwahl
c) Stilmittel
4. Weitere Textstellen zu Gretchens Religionshaltung
a) in der Szene „Nacht“
b) in der Szene „Dom“
c) in der Szene „Kerker“
d) in der Szene „Straße“
C) Aktualität der Thematik
Gliederung
A) Allgemeine Informationen zu „Faust I“
B) Erschließung der Szene „Marthens Garten“ aus Goethes „Faust I“
I. Inhaltsangabe
II. Erschließung der Szene „Marthens Garten“
1. Bedeutung der Szene für das Dramenganze und die unterschiedliche Auffassung von Religiosität
a) Höhepunkt der Gretchentragödie
b) Fausts universaler Glaube
c) Gretchens Glaube
d) Vorhersehbarkeit des katastrophalen Ausgangs
2. Dialogführung
a) Gretchen-Faust-Dialog
b) Faust-Mephisto-Dialog
3. Sprache
a) Satzbau
b) Wortwahl
c) Stilmittel
4. Weitere Textstellen zu Gretchens Religionshaltung
a) in der Szene „Nacht“
b) in der Szene „Dom“
c) in der Szene „Kerker“
d) in der Szene „Straße“
C) Aktualität der Thematik
Das Drama „Faust I“ von Johann Wolfgang von Goethe gilt als eines der bedeutendsten und meistzitierten Werke der deutschen Literatur. Das 1808 veröffentlichte Werk greift die Geschichte des historischen Doktor Faustus auf und wird in „Faust II“ zu einer Menschheitsparabel ausgeweitet. Heinrich Faust, wie sein historisches Vorbild Johann Georg Faust, ein angesehener Forscher und Lehrer zu Beginn der Neuzeit, zieht eine selbstkritische Lebensbilanz und kommt zu einem doppelt niederschmetternden Fazit: Als Wissenschaftler fehle es ihm an tiefer Einsicht und brauchbaren Ergebnissen und als Mensch sei er unfähig, das Leben in seiner Fülle zu genießen. Tief deprimiert und lebensmüde verspricht er dem Teufel Mephisto seine Seele, wenn es diesem gelingen sollte, Faust von seiner Unzufriedenheit und Ruhelosigkeit zu befreien. Mephisto schließt mit Faust einen Pakt in Form einer Wette, verwandelt ihn zurück in einen jungen Mann und nimmt ihn mit auf eine Reise durch die „kleine“ und dann die „große Welt“. Auf ihrem Weg durch die kleine Welt Gretchens ist eine ihrer Stationen „Marthens Garten“.
Die Szene „Marthens Garten“ aus Goethes „Faust I“ handelt zuerst von einem Gespräch zwischen dem verliebten Gretchen und Faust, zunächst über die Religion, dann über Mephisto. Später unterhalten sich Mephisto und Faust, wobei Mephisto befürchtet von Gretchen als Teufel entlarvt zu werden.
Diese Szene, die nach der Szene „Wald und Höhle“ und vor „Am Brunnen“ spielt, beginnt mit dem Gespräch zwischen Margarete und Faust. Die gläubige Margarete will mehr über Fausts Religionsdenken erfahren. Dieses Streben Gretchens führt zu einer Diskussion beider, wobei sie stets anklagt und er immer wieder geschickt mit Gegenfragen ausweicht. Schließlich offenbart Faust ihr doch seine Ansicht von einem universellen Glauben. Daraufhin greift Margarete Mephisto, Fausts momentan abwesenden Begleiter, als Thema auf und stellt eindeutig dar, wie abgeneigt sie Mephisto gegenüber ist. Faust versucht das zu beschwichtigen, es gelingt ihm aber nicht. Gretchen muss nun zu Fausts Bedauern gehen, schlägt aber noch vor, sich nachts zu treffen. Da Gretchens Mutter aber nicht tief schläft, überreicht Faust ihr noch ein Schlafmittel, um sich doch mit ihr treffen zu können. Nach Margaretes Abgang tritt Mephisto auf und verspottet Faust aufgrund seiner Zuneigung zu Gretchen. Es kommt kurz zu einer fast vulgären Auseinandersetzung, an dessen Ende Mephisto jedoch seine Sorge äußert, dass Margarete ihn als Teufel erkennen könnte. Mit der Ironie Mephistos über Fausts bevorstehendes „Schäferstündchen“ schließt die Szene.
Bereits anhand der Inhaltsangabe ist ersichtlich, wie ausschlaggebend die Szene für das Dramenganze ist. Sie stellt einen Höhepunkt des gesamten Dramas, aber vor allem der Gretchentragödie, dar. Mit dem Auftakt der Szene stellt Margarete die entscheidende und zentrale Gretchenfrage: „Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“ (V. 3415). Sie spricht gezielt Fausts Religion an, denn eigentlich würde für eine so fromme Katholikin nur ein Mann desselben Glaubens in Frage kommen. Faust, der Gretchen nicht verlieren will, antwortet nach kurzer Weigerung durch Gegenfragen. Zuerst, meint Faust, genüge die Aussage: „Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut“ (V. 3419). Doch Gretchen stellt unmissverständlich klar, dass „man [...] dran glauben“ (V. 3415) müsse. Faust kontert mit der Gegenfrage: „Muß man?“ (V. 3422), um Gretchen von ihrem „Verhör“ abzubringen, doch diese lässt sich nicht beirren. Daher gesteht Faust: „Ich glaub ihn.“ (V. 3434) und berichtet von seinem universalen Glauben, allumfassend und mit dem Gefühl des Menschen im Vordergrund. Er versucht Gretchen mit Weisheit zu schmeicheln und behauptet, dass Religion nicht definierbar ist: „Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott!“ (V. 3454). Faust sieht Religion somit auch als Gefühls- und Herzensbegriff. Zudem weitet er die Religion auf das Unendliche aus, sowie auf die Natur (vgl. V. 3457f und 3442ff). Dies führt letztendlich zu einem toleranten und aufgeklärten Glauben, erkennbar durch seine Weisheit und Verstandnutzung beim Formulieren der Aussage, aber auch zu einem emotionalen, denn er erwähnt ebenso die Betonung der Gefühle (vgl. V. 3454), charakteristisch für den Sturm und Drang. Abschließend betont er seine Auffassung eines freien Glaubens Jedermanns, insofern es einem übergeordneten Zwecke diene (vgl. V. 3462ff). Diese Aussage lässt sich auch mit der Aussage der „Ringparabel“ aus „Nathan der Weise“ verbinden: Der eigene, freie Glaube steht bei beiden im Vordergrund.
Gretchen dagegen steht mit ihrem Religionsverständnis im enormen Kontrast zu Fausts. Sie ehrt die „heil’gen Sakramente“ (V. 3424) und ist streng traditionell katholisch geprägt. Sie besucht die Beichte und spiegelt einen unhinterfragten, fast sturen Glauben und eine außerordentliche Sicherheit im Glauben wider. Sie praktiziert ihren dogmatischen und tiefen Kirchenglauben, weshalb sie womöglich auch die Abneigung zu Mephisto verspürt: Er „ist mir in tiefer Seele verhaßt“ (V. 3437). Erst diese Akzeptanz der zwei völlig gegensätzlichen Glaubensansichten durch Gretchen sorgt letztendlich für die Katastrophe im Drama. Denn mit einem Glauben, wie ihn Faust darstellt, würde sie das Gespräch in der Szene „Am Brunnen“ ganz anders wahrnehmen und interpretieren. So sieht Gretchen in den Lästereien und dem Bericht über die Affäre Bärbelchens ihr eigenes Schicksal gespiegelt und vorausgedeutet, sie zeigt die ersten Gefühle von Reue und Schuld durch ihr Mitleid bei Sibylle: „Das arm Ding“ (V. 3562) oder: „Doch – alles, was mich dazu trieb, Gott! War so gut! Ach war so lieb!“ (V. 3585) zeigen ihre Gewissensbisse. Hätte sie Fausts universalen Glauben, würde sie ihre Tat nicht bereuen müssen.
So ist die Szene ausschlaggebend, denn durch die Akzeptanz Fausts als Liebhaber und nicht als Ehemann kommt die Katastrophe ins Rollen und führt zur völligen Zerstörung Gretchens, die überfordert vom Glauben ihre Sünden bereut und so in Verwirrtheit gerät, nur aufgrund ihrer Religionsansichten, die durch Faust eingerissen wurden.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale "Gretchenfrage" in Faust I?
Gretchen fragt Faust: „Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“. Damit zielt sie auf Fausts innere Überzeugung und Glaubenshaltung ab.
Wie unterscheidet sich Fausts Glauben von Gretchens?
Faust vertritt einen pantheistischen, universalen Gefühlsglauben, während Gretchen fest in der traditionellen, dogmatischen katholischen Kirche verwurzelt ist.
Welche Rolle spielt Mephisto in der Szene "Marthens Garten"?
Mephisto wird von Gretchen als unheimlich und abstoßend wahrgenommen. Er verspottet Fausts Gefühle und drängt auf die Fortführung des Pakts.
Warum ist diese Szene entscheidend für die Gretchentragödie?
Hier akzeptiert Gretchen Faust trotz ihrer religiösen Bedenken, was durch das Schlafgift für die Mutter die Katastrophe und Gretchens sozialen sowie psychischen Ruin einleitet.
Welche Stilmittel prägen die Szene?
Goethe nutzt einen starken Kontrast in der Wortwahl zwischen Gretchens Demut und Fausts rhetorischem Ausweichen sowie Mephistos ironisch-vulgärer Sprache.
- Quote paper
- Maximilian Bork (Author), 2013, Goethe, Johann Wolfgang von - Faust I - Marthens Garten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213912