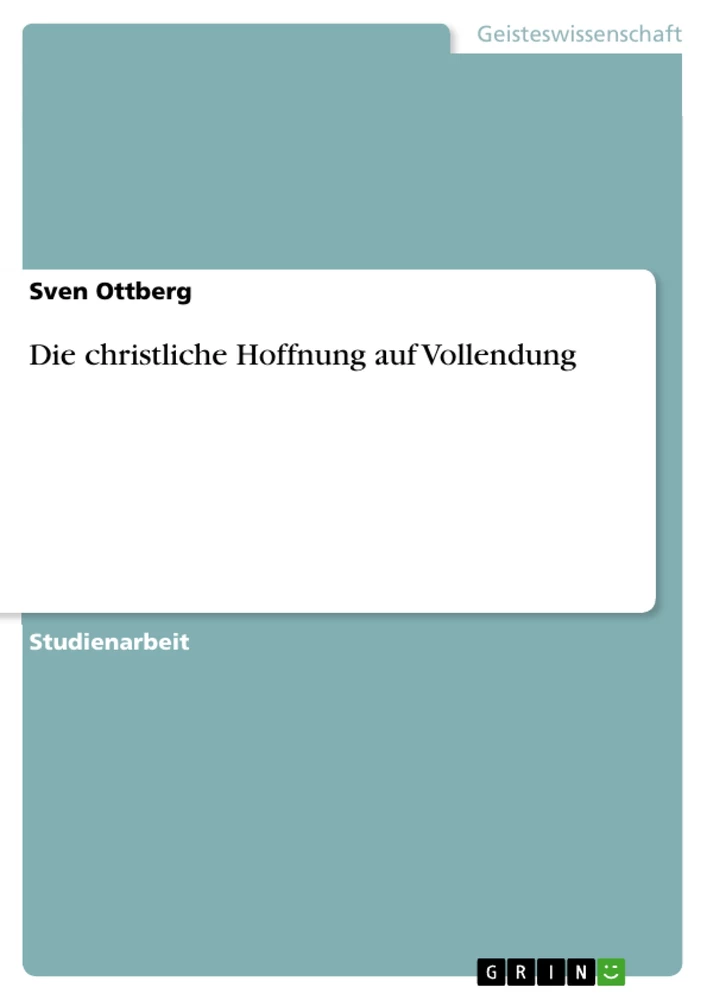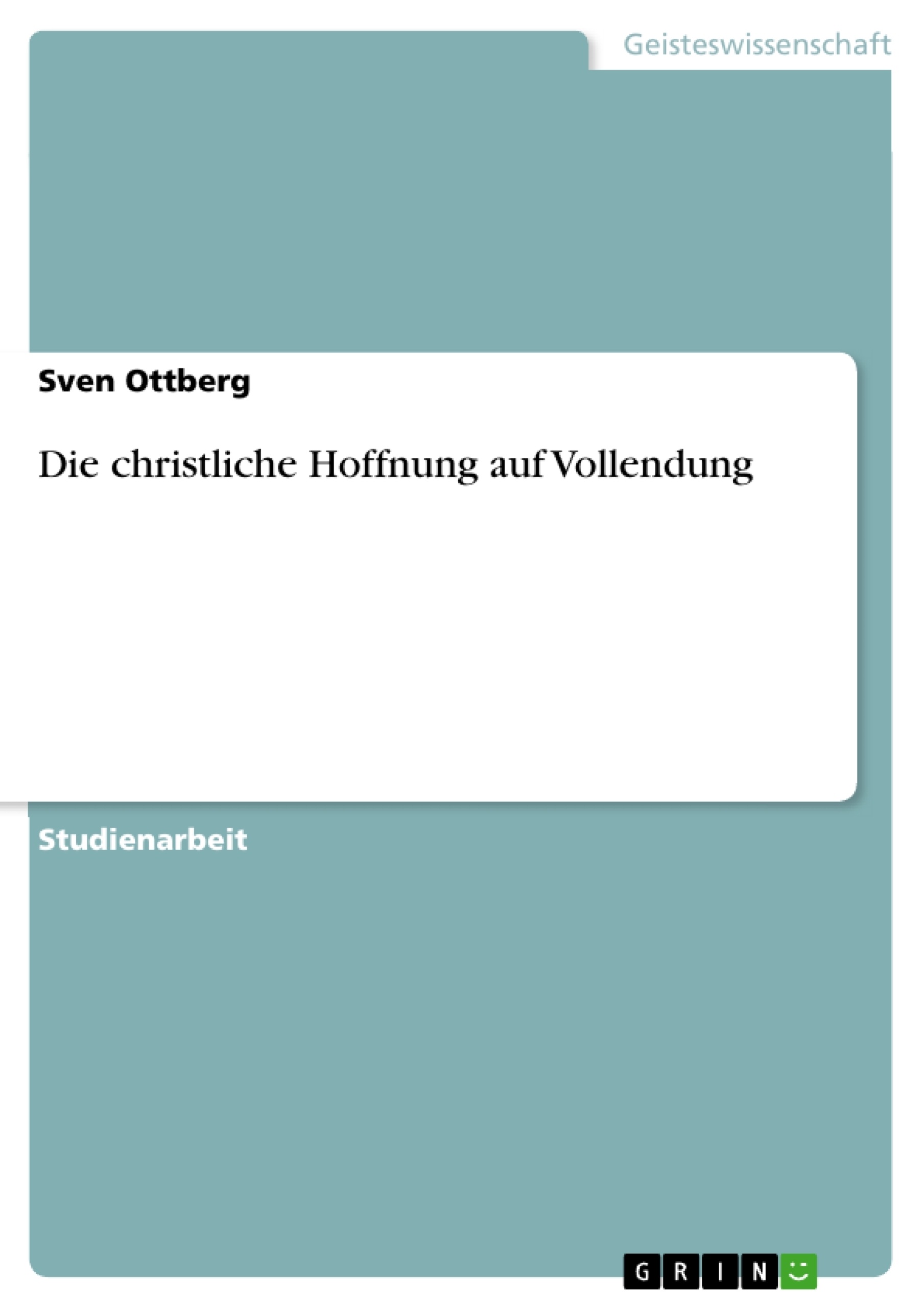Die christliche Hoffnung auf Vollendung gründet in der Auferstehung Jesu Christi. Entfalten Sie diese Aussage des neuen Testaments und grenzen Sie den Glauben an die Auferstehung von nichtchristlichen Vollendungsvorstellungen ab.
Die Hoffnung auf Vollendung und somit der Glaube an die Auferstehung der Toten ist untrennbar mit der Auferstehung Jesu Christi verbunden. Für Paulus ist dies die christliche Hoffnung schlechthin. Fehlt der Glaube an die Auferstehung Jesu, spricht Paulus sogar von einem sinnlosen Glauben.
"Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos" (1 Kor 15,13f).
Nach Auskunft der christlichen Nachrichtenagentur idea.de glaubt nur noch ein gutes Drittel (37 Prozent) der Deutschen an ein Leben nach dem Tod oder an die Auferstehung Jesu Christi. Diese auf Daten des Meinungsforschungsinstitutes Forsa beruhende Umfrage aus dem Jahr 2011 zeigt, dass das gestellte Thema sehr aktuell ist und wirft die Frage auf, was eigentlich mit der Lehre von Tod und Auferstehung oder der christlichen Hoffnung auf Vollendung gemeint ist.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Begriffen „Hoffnung“ und „Vollendung“ im theologischen Kontext, um die eschatologische Dimension des christlichen Glaubens darzulegen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Hauptteil
- 1. Die christliche Hoffnung auf Vollendung
- 2. Hoffnung auf Vollendung im Neuen Testament
- 2.1 Jesu Botschaft vom Reich Gottes
- 2.2 Die eschatologische Rede
- 2.3 Nachösterliche Neuorientierung
- 2.4 Parusie
- 3. Die Auferstehung der Toten
- 4. Abgrenzung zu nichtchristlichen Vollendungsvorstellungen
- 4.1. Vollendungsvorstellungen im Islam
- 4.2. Vollendungsvorstellungen im Judentum
- C. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die christliche Hoffnung auf Vollendung im Kontext der Auferstehung Jesu Christi. Sie beleuchtet die neutestamentlichen Grundlagen dieser Hoffnung und grenzt sie von nichtchristlichen Vollendungsvorstellungen ab. Der Fokus liegt auf der eschatologischen Dimension des christlichen Glaubens und der Interpretation der Aussagen Jesu über das Reich Gottes.
- Die christliche Hoffnung auf Vollendung und ihre Verankerung in der Auferstehung Jesu.
- Die Darstellung des Reiches Gottes im Neuen Testament und seine Bedeutung für die eschatologische Hoffnung.
- Die Lehre von der Auferstehung der Toten im christlichen Glauben.
- Ein Vergleich christlicher Vollendungsvorstellungen mit denen des Islam und des Judentums.
- Die Relevanz der christlichen Hoffnung auf Vollendung im heutigen Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor: Die christliche Hoffnung auf Vollendung ist untrennbar mit der Auferstehung Jesu Christi verbunden. Sie verdeutlicht die Aktualität des Themas anhand sinkender Glaubenserwartungen in der deutschen Bevölkerung und führt in die Thematik der eschatologischen Dimension des christlichen Glaubens ein. Die Arbeit fokussiert auf die neutestamentlichen Aussagen Jesu und die paulinische Theologie, um die Kernpunkte der christlichen Vollendungsvorstellungen darzulegen, wobei sie auch auf Unterschiede innerhalb der christlichen Glaubensrichtungen eingeht. Abschließend kündigt die Einleitung einen Vergleich mit nichtchristlichen Vollendungsvorstellungen, insbesondere im Islam und Judentum, an.
B. Hauptteil, Kapitel 1. Die christliche Hoffnung auf Vollendung: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Vollendung" im theologischen Kontext als Inbegriff der eschatologischen Hoffnung. Es betont, dass diese Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod in Gemeinschaft mit Gott seit über 2000 Jahren Christen trägt und von der Verheißung Gottes getragen wird. Das Kapitel unterscheidet diese Hoffnung von menschlichem Handeln und betont ihren zukünftigen Bezug auf das kommende Reich Gottes. Trotz der Unklarheit über die genaue Gestalt der Vollendung unterstreicht es die Bedeutung des gegenwärtigen Heilshandelns Gottes. Die Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft im Bezug auf das Reich Gottes wird als zentraler Aspekt herausgestellt.
B. Hauptteil, Kapitel 2. Hoffnung auf Vollendung im Neuen Testament: Dieses Kapitel analysiert die neutestamentlichen Aussagen Jesu über das Reich Gottes. Es beleuchtet die Spannung zwischen der Ankündigung des nahen Reiches Gottes und seiner zukünftigen Vollendung. Jesu Wirken, insbesondere seine Wunder wie die Auferweckung des Jünglings von Nain und Lazarus, wird als bereits angebrochenes Reich Gottes gedeutet, das aber gleichzeitig auf die zukünftige Vollendung hinweist. Das Kapitel betont die Erfüllung der prophetischen Worte durch Jesus und sein heilmachende Handeln als Ausdruck des gegenwärtig wirkenden Gottes. Die Verbindung von gegenwärtigem Handeln und zukünftiger Vollendung bildet den Kern der Analyse.
Schlüsselwörter
Christliche Hoffnung, Vollendung, Auferstehung Jesu Christi, Reich Gottes, Eschatologie, Neues Testament, Parusie, Islam, Judentum, Vollendungsvorstellungen, Heilshandeln Gottes.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Christliche Hoffnung auf Vollendung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die christliche Hoffnung auf Vollendung, insbesondere im Kontext der Auferstehung Jesu Christi. Sie beleuchtet die neutestamentlichen Grundlagen dieser Hoffnung und vergleicht sie mit nichtchristlichen Vollendungsvorstellungen (Islam und Judentum).
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die christliche Hoffnung auf Vollendung und ihre Verankerung in der Auferstehung Jesu, die Darstellung des Reiches Gottes im Neuen Testament und dessen Bedeutung für die eschatologische Hoffnung, die Lehre von der Auferstehung der Toten, einen Vergleich christlicher Vollendungsvorstellungen mit denen des Islam und des Judentums sowie die Relevanz der christlichen Hoffnung auf Vollendung im heutigen Kontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung (A), einen Hauptteil (B) und einen Schluss (C). Der Hauptteil umfasst Kapitel zur christlichen Hoffnung auf Vollendung, zur Hoffnung auf Vollendung im Neuen Testament (mit Unterkapiteln zu Jesu Botschaft, eschatologischer Rede, nachösterlicher Neuorientierung und Parusie), zur Auferstehung der Toten und einem Vergleich mit nichtchristlichen Vollendungsvorstellungen im Islam und Judentum.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass die christliche Hoffnung auf Vollendung untrennbar mit der Auferstehung Jesu Christi verbunden ist.
Welche neutestamentlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die neutestamentlichen Aussagen Jesu über das Reich Gottes, die Spannung zwischen der Ankündigung des nahen Reiches und seiner zukünftigen Vollendung, Jesu Wirken und Wunder als bereits angebrochenes Reich Gottes, die Erfüllung prophetischer Worte und Jesu heilmachende Handeln als Ausdruck des gegenwärtig wirkenden Gottes.
Wie wird der Begriff "Vollendung" definiert?
Der Begriff "Vollendung" wird im theologischen Kontext als Inbegriff der eschatologischen Hoffnung definiert, ein Weiterleben nach dem Tod in Gemeinschaft mit Gott.
Wie wird der Vergleich mit anderen Religionen durchgeführt?
Die Arbeit vergleicht die christliche Hoffnung auf Vollendung mit den Vollendungsvorstellungen im Islam und Judentum.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Christliche Hoffnung, Vollendung, Auferstehung Jesu Christi, Reich Gottes, Eschatologie, Neues Testament, Parusie, Islam, Judentum, Vollendungsvorstellungen, Heilshandeln Gottes.
Welche Bedeutung hat die Arbeit für den heutigen Kontext?
Die Arbeit beleuchtet die Aktualität des Themas anhand sinkender Glaubenserwartungen in der deutschen Bevölkerung und untersucht die Relevanz der christlichen Hoffnung auf Vollendung im heutigen Kontext. (Der genaue Kontext wird jedoch nicht im bereitgestellten Text detailliert beschrieben).
- Quote paper
- Sven Ottberg (Author), 2011, Die christliche Hoffnung auf Vollendung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213902