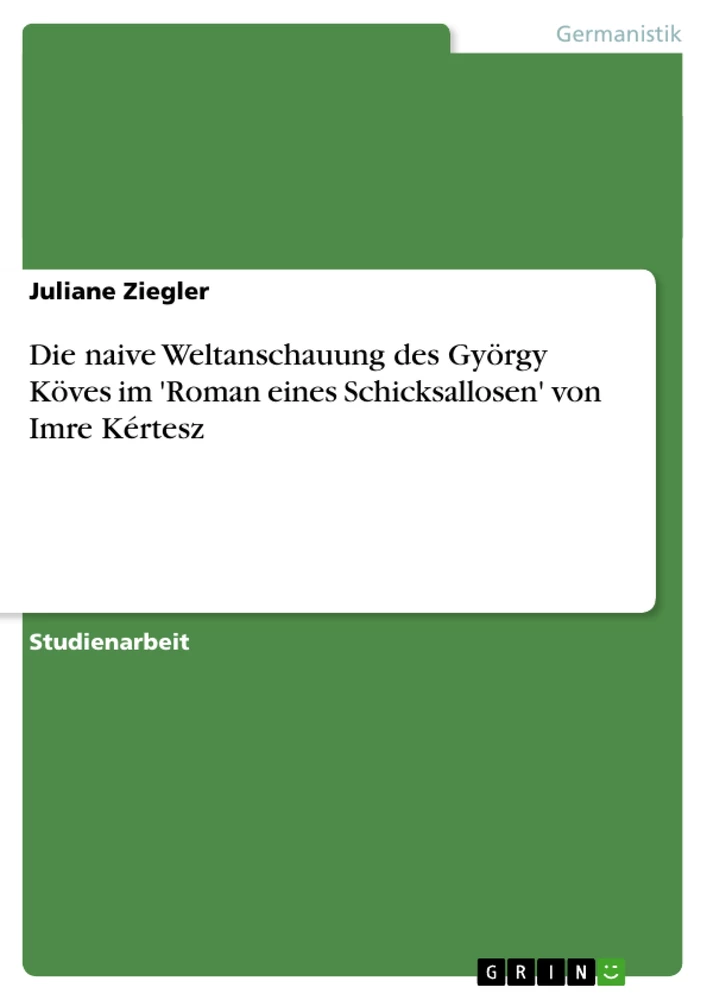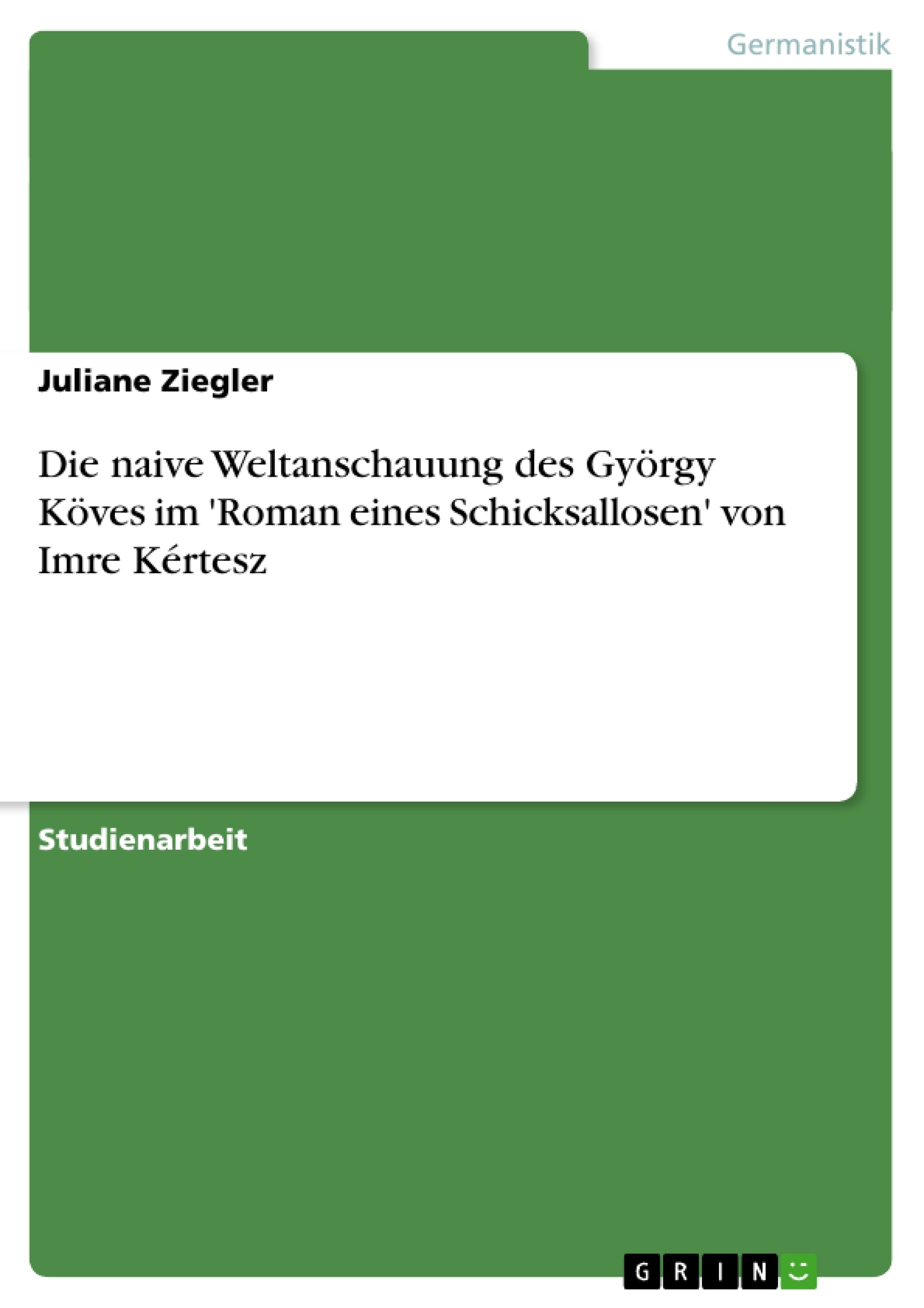Als Thema für diese Hausarbeit habe ich mir die besondere Sichtweise des Protagonisten
aus dem „Roman eines Schicksallosen“ des ungarischen Autors Imre Kertész gewählt. Es ist
eben diese Sichtweise, die sein Werk so explosiv gemacht hat, die es ins Gespräch gebracht
hat, die zum Nachdenken angeregt hat.[...] Später,
als es um Auschwitz und Buchenwald und vor allem Zeitz ging, war ich jedoch erschrocken
und gleichzeitig tief berührt. Diese Erzählweise hat mich an manchen Stellen richtig wütend
gemacht, aber ich habe bald gemerkt, dass mehr dahinter stecken muss und soll. Als ich den
Roman zum zweiten Mal gelesen habe, wurde mir Schritt für Schritt klar, dass György die
Konzentrationslager vielleicht nur überlebt hat, gerade weil er so war? Negative Folgen, die
man normalerweise mit Naivität verbindet, sind zumindest ausgeblieben.
Der zweite Aspekt, den ich in diesem Zusammenhang beleuchten möchte, ist folgender:
Ausgehend davon, dass der Protagonist rückblickend erzählt, er also im Nachhinein, als
Wissender, noch einmal die Rolle des Unwissenden einnimmt - warum? Er muss bestimmte
Gründe dafür haben, diese Art der Erzählung zu wählen, denn normalerweise lässt sich doch
eine subjektive Wertung bei einer rückblickenden Erzählung nicht ausschließen.
Außerdem stellt sich die spannende Frage, warum viele Leser, anfangs Verlage, später Politik
und Gesellschaft allgemein, so extrem auf diese Sichtweise reagiert haben. Haben sie das
Recht dazu, oder hat vielmehr der Autor, das Recht, seinen Roman so zu
gestalten?
Ich werde diesen Fragen nachgehen, in dem ich die einzelnen Stationen György Köves
sowohl sprachlich, als auch inhaltlich analysiere, sie mit seiner inneren, wie äußeren
Entwicklung in Verbindung bringe, um letztendlich das Besondere an der Wirkung dieser
Sprache herauszufinden.
Auffällig am „Roman eines Schicksallosen“ ist auch, dass es viele Parallelen zwischen
Kertész als Autor des Romans und György Köves, als dessen Protagonisten gibt. Der Roman ist seit seiner Entstehung Sprengstoff für Politik und Literatur.
Warum zerreißen sich so viele Menschen die Münder über dieses Buch, wie reagiert
Kertész auf diese, letztendlich ja von ihm geschaffene Zwiespältigkeit? Um Antworten auf
diese Fragen geben zu können und um das Werk nicht von seinem Schöpfer abzusondern, gebe ich im ersten Teil der Arbeit einen
relativ umfangreichen Überblick über Leben und Schaffen Kertész’.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Autor: Imre Kertész
- Der Kampf um Anerkennung in Ungarn
- Der Nobelpreis 2002
- Die naive Weltanschauung des György Köves im „Roman eines Schicksallosen“
- Inhaltsangabe
- Köves Vorgeschichte und sein Weg nach Auschwitz
- Die „Deportation“ von Auschwitz über Buchenwald nach Zeitz
- Zurück in Buchenwald – die Rettung
- Endlich zu Hause?
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die besondere Sichtweise des Protagonisten György Köves im „Roman eines Schicksallosen“ von Imre Kertész. Die Arbeit untersucht die Gründe für die naive Weltanschauung des Protagonisten und ihre Auswirkungen auf seine Erfahrungen in den Konzentrationslagern. Außerdem beleuchtet sie die literarische Gestaltung der Geschichte aus der Perspektive des Protagonisten und die Rezeption des Romans durch Leser, Verlage, Politik und Gesellschaft.
- Die naive Weltanschauung des Protagonisten György Köves
- Die literarische Gestaltung der Geschichte aus der Perspektive des Protagonisten
- Die Rezeption des Romans durch Leser, Verlage, Politik und Gesellschaft
- Die Parallelen zwischen Imre Kertész als Autor und György Köves als Protagonist
- Die Bedeutung des Romans für die ungarische Literatur und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die ersten drei Kapitel der Arbeit befassen sich mit der Vorgeschichte des Protagonisten György Köves und seiner Inhaftierung in der Gendarmeriekaserne Andrássy. Dieser Teil der Arbeit analysiert die Persönlichkeit des Protagonisten, sein Elternhaus, seine Freunde und seine Erfahrungen mit seiner Umwelt. Die Kapitel vier bis sieben schildern Köves Leidensweg in den Konzentrationslagern und stellen seine Gratwanderung zwischen Leben und Tod dar. Kapitel acht markiert einen Wendepunkt in der Geschichte: György Köves, nachdem er die Resignation seines leblosen Körpers bemerkt, kehrt mit der Kraft seines Willens zu den Lebenden zurück und entscheidet sich für das Leben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des „Roman eines Schicksallosen“ sind die naive Weltanschauung, die Erfahrungen in den Konzentrationslagern, die literarische Gestaltung der Geschichte aus der Perspektive des Protagonisten, die Rezeption des Romans und die Parallelen zwischen Autor und Protagonist. Weitere wichtige Begriffe sind die ungarische Literatur und Gesellschaft, die Geschichte des Holocaust und die Rolle der Erinnerungskultur.
- Quote paper
- Juliane Ziegler (Author), 2003, Die naive Weltanschauung des György Köves im 'Roman eines Schicksallosen' von Imre Kértesz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21388