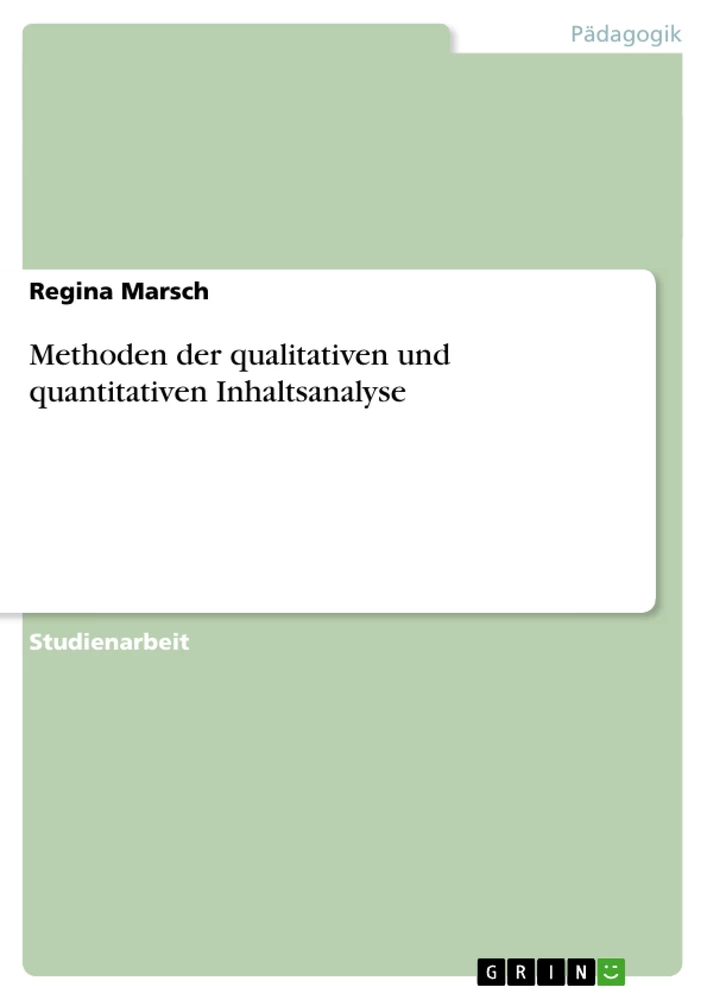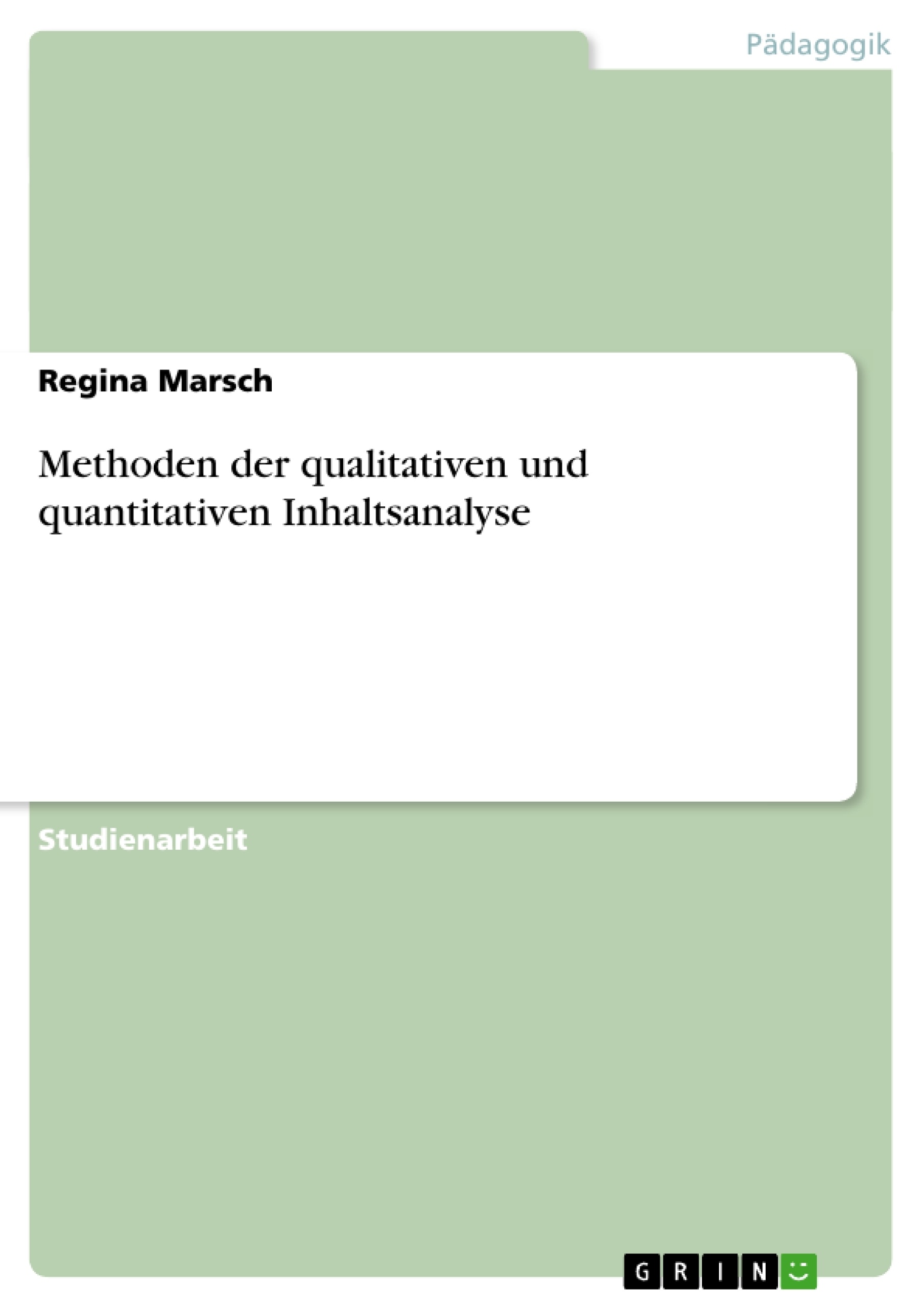Generell lassen sich zwei Formen der Inhaltsanalyse unterscheiden. Die qualitative und die
quantitative. Während bei der quantitativen Inhaltsanalyse lediglich die Art und die Anzahl
der, beispielsweise in einem Text benutzten Silben, Wörter oder Buchstaben, sowie die Häufigkeit
von Wörtern in einem Satz bestimmt wird, und somit eine rein syntaktische Beschreibung
erfolgt, (vgl. Merten 1995, S. 19), befasst sich die qualitative Inhaltsanalyse mit der Interpretation
des Textes, etwa der Frage der Bedeutung oder der Intention des Verfassers. Sie
wird als verstehende Wissenschaft verstanden und soll somit individuelle Ansätze verfolgen,
weswegen sie auch als induktive Form der Inhaltsanalyse verstanden wird (vgl. Mayring
2007, S. 18). Die quantitative Analyse hingegen will erklären und hält als deduktive Variante
an allgemeinen Prinzipien und Gesetzen fest (vgl. Mayring 2007, S. 18). Laut Mayring spricht
man von quantitativer Analyse „sobald Zahlbegriffe und deren in-Beziehung-setzen durch
mathematische Operationen bei der Erhebung oder Auswertung verwendet werden“ (ebd., S.
16) und bei allem anderen von qualitativer Analyse. Während bei der qualitativen Analyse auf
Nominalskalenniveau gemessen wird, gilt bei der Messung mit Ordinal-, Intervall-, oder Ratioskalen
das Prinzip der quantitativen Analyse (vgl. ebd.; S. 17).. Da es in der qualitativen
Inhaltsanalyse aber weniger auf das Messen, sondern vielmehr auf das Verstehen des Textes
ankommt, spricht man hier auch von „hermeneutischer“ Inhaltsanalyse, während die quantitative
Form auch als „empirische“ Textanalyse verstanden wird (vgl., Bos, Tarnai 1999, S.
660ff). Hier gibt es vier wichtige Formen: [...]
Inhaltsverzeichnis
1 Unterschiede und Gemeinsamkeiten der qualitativen und quantitativen Inhaltsanalyse
2 Eckpunkte der Entwicklung der Inhaltsanalyse als Forschungsinstrument
3 Der einfache Kommunikationszusammenhang
4 Die Häufigkeitswortliste
5 Wortstatistische Maße
5. 1 Der Type-Token-Ratio
5. 2 Die Statistik auf Wortebene
6 Die Inhaltsanalyse in der Tabellendatei
7. Literaturverzeichnis
1 Unterschiede und Gemeinsamkeiten der qualitativen und quantitativen Inhaltsanalyse
Generell lassen sich zwei Formen der Inhaltsanalyse unterscheiden. Die qualitative und die quantitative. Während bei der quantitativen Inhaltsanalyse lediglich die Art und die Anzahl der, beispielsweise in einem Text benutzten Silben, Wörter oder Buchstaben, sowie die Häufigkeit von Wörtern in einem Satz bestimmt wird, und somit eine rein syntaktische Beschreibung erfolgt, (vgl. Merten 1995, S. 19), befasst sich die qualitative Inhaltsanalyse mit der Interpretation des Textes, etwa der Frage der Bedeutung oder der Intention des Verfassers. Sie wird als verstehende Wissenschaft verstanden und soll somit individuelle Ansätze verfolgen, weswegen sie auch als induktive Form der Inhaltsanalyse verstanden wird (vgl. Mayring 2007, S. 18). Die quantitative Analyse hingegen will erklären und hält als deduktive Variante an allgemeinen Prinzipien und Gesetzen fest (vgl. Mayring 2007, S. 18). Laut Mayring spricht man von quantitativer Analyse „sobald Zahlbegriffe und deren in-Beziehung-setzen durch mathematische Operationen bei der Erhebung oder Auswertung verwendet werden“ (ebd., S. 16) und bei allem anderen von qualitativer Analyse. Während bei der qualitativen Analyse auf Nominalskalenniveau gemessen wird, gilt bei der Messung mit Ordinal-, Intervall-, oder Ratioskalen das Prinzip der quantitativen Analyse (vgl. ebd.; S. 17).. Da es in der qualitativen Inhaltsanalyse aber weniger auf das Messen, sondern vielmehr auf das Verstehen des Textes ankommt, spricht man hier auch von „hermeneutischer“ Inhaltsanalyse, während die quantitative Form auch als „empirische“ Textanalyse verstanden wird (vgl., Bos, Tarnai 1999, S. 660ff). Hier gibt es vier wichtige Formen:
Die Frequenzanalyse, die allein die Häufigkeit bestimmter Wörter oder Mehrwortausdrücke bestimmt ist die einzige, rein quantitative Art der Inhaltsanalyse. Oft kommt es hier auch nur auf rein formale Eigenschaften der zu analysierenden Quelle an, wie den Type-Token-Ratio, oder den Aktionsquotienten. Sie hat somit ihren Schwerpunkt oft in der computergestützten Inhaltsanalyse (vgl. Diekmann 2004, S. 496). In der zweiten Form, der Valenzanalyse, zeigt sich schon ein geringer qualitativer Ansatz, indem zusätzlich bestimmt wird, ob ein gewisser Suchausdruck bzw. Sachverhalt vom Erzählenden eher positiv, negativ oder neutral bewertet wird. Die Intensitätsanalyse geht noch einen Schritt weiter, indem sie nicht nur bipolar ausgerichtet ist, sondern mehrstufig gemessen wird, wie stark die Bewertung der jeweiligen Suchausdrücke ausfällt (vgl. Mayring 2007, S. 15). Bei der Kontingenzanalyse schließlich, sollen Assoziationsstrukturen in den zu analysierenden Materialien erfasst werden, es soll also nachgewiesen werden ob gewissen Merkmale öfter oder seltener zusammen vorkommen, als angenommen (vgl. Diekmann 2004, S. 496). In den letzten drei genannten 2
Analysearten ist es also, auch wenn sie zur quantitativen Inhaltsanalyse zählen, trotzdem nicht vermeidbar durch Interpretation und zumindest geringe Miteinbeziehung des Kontextes auch qualitative Methoden zu verwenden, da sie es immer mit der „Bedeutung von Quantitäten“ zu tun haben (Früh 2007, S. 67).
Auch die qualitative Inhaltsanalyse kann nicht vollständig ohne die quantitative Inhaltsanalyse vonstattengehen. Z. B. lässt sich eine qualitative Bewertung eines Interviews meist nur Durchführen, wenn man seine Kategorien, wie z.B. „Zufriedenheit am Arbeitsplatz“ durch das Kriterium der Häufigkeit bestimmter Ausdrücke, welche Zufriedenheit, bzw. Unzufriedenheit signalisieren, festmacht (vgl. ebd. S. 67).
In beiden, sowohl in der qualitativen wie auch in der quantitativen Inhaltsanalyse werden Kategorien gebildet. Während der Prototyp in der quantitativen Inhaltsanalyse jedoch eine theoriegeleitete Kategorienbildung darstellt, indem theoretische Hypothesen anhand des Textmaterials überprüft und belegt werden sollen, wird bei der qualitativen Kategorienbildung üblicherweise empiriegeleitet vorgegangen, indem der Autor sich zunächst intensiv mit dem Text auseinandersetzt und sich dann erst mit der Frage beschäftigt, welche Merkmale hier besonders interessant sein könnten und inwiefern sie interpretierbar sind (vgl. ebd., S. 73). Allerdings ist es nahezu unmöglich beide Verfahren strikt zu trennen, da meistens eine Mischform benötigt wird, so dass es lediglich darauf ankommt, welche Form der Kategorienbildung stärker gewichtet wird (vgl. ebd., S. 73). Auch die Anzahl der gesuchten Variablen spielen bei der Unterscheidung der qualitativen von der quantitativen Analyse keine Rolle. Allerdings werden bei der quantitativen Methode pro Fall immer die selben Variablen gesucht, während es bei der qualitativen Methode immer auf den jeweiligen zu untersuchenden Fall und auf die Fragestellung ankommt (vgl. ebd., S. 70), wobei sie auch meist individueller und komplexer ist, und mehr kontextuelle sowie situative Merkmale aufweist (vgl. ebd., S. 70). An diesen Punkten lässt sich sehr gut erkennen, dass eine direkte und klar abgegrenzte Unterscheidung zwischen qualitativer und quantitativer Inhaltsanalyse nahezu unmöglich ist. Auch wenn die Kritik der qualitativen an der quantitativen Analysemethode in einigen Fällen überzeugend und gerechtfertigt ist, haben sich die rein qualitativen Alternativen als völlig unzulänglich erweisen, bzw. fehlen sie völlig (vgl. Mayring 2007, S. 16). Somit lässt sich sagen, dass zumindest im „Bezug auf die Inhaltsanalyse … eine strikte Kontrastierung qualitativer und quantitativer Vorgehensweisen sogar theoretisch wie praktisch gegenstandslos“ ist (Früh, S. 67).
[...]
- Quote paper
- Regina Marsch (Author), 2011, Methoden der qualitativen und quantitativen Inhaltsanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213889