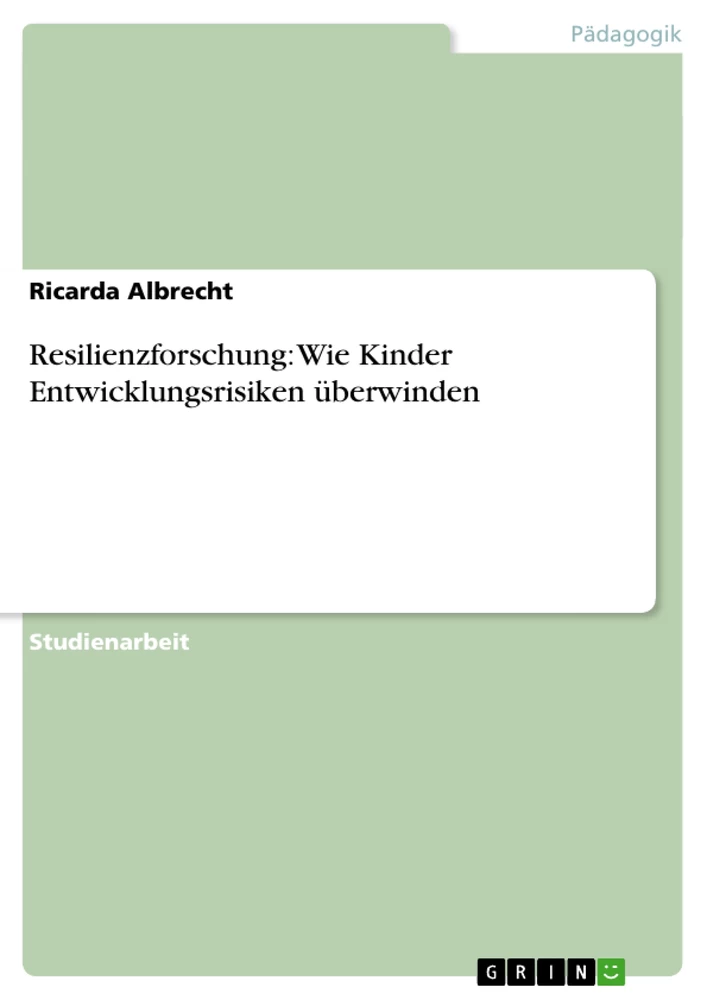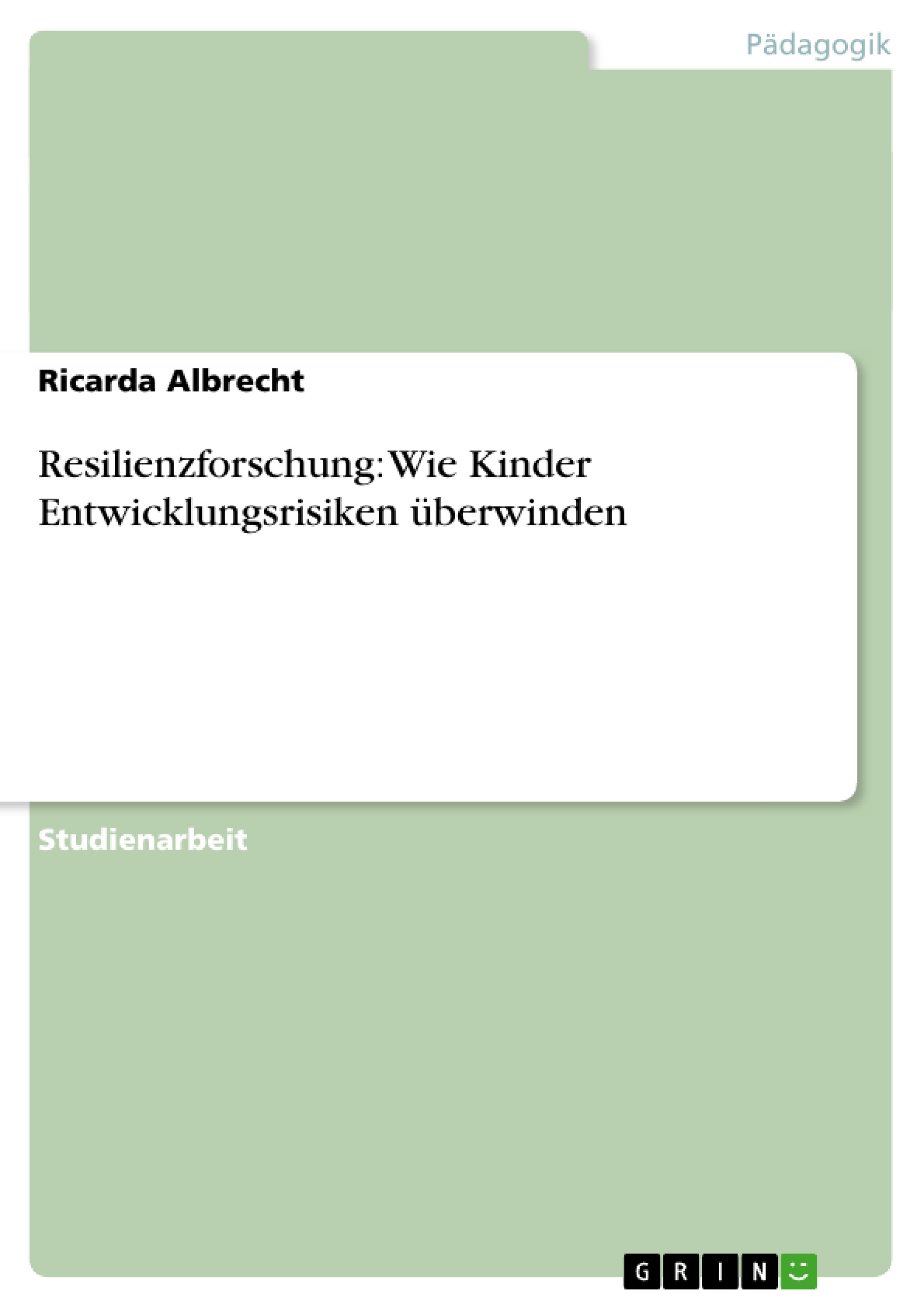In unserer heutigen Gesellschaft mit circa 4,3 Millionen Arbeitslosen leben viele Familien in Armut. Jede zweite Ehe wird geschieden. Dies sind zwei Meldungen, die verstärkt in das öffentliche Bewusstsein treten. Entwicklungsrisiken wie permanenter Stress durch Armut oder Brüche, wie dem Verlust der Eltern, sind für Kinder schwer zu verkraften. Sie können zu Störungen bei dem Kind führen, welche seine Entwicklung stören. Dennoch gibt es eine Vielzahl, die trotz solcher Schicksalsschläge Problemlösestrategien entwickelt. Diese Überwindung von Entwicklungsrisiken wird Resilienz genannt und ist sowohl Thema des Textes von Corina Wustmann: „Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung“ als auch des Textes von Thomas Gabriel: „Resilienz - Kritik und Perspektiven“, die in dieser Arbeit gegenübergestellt werden sollen. Dabei gehe ich der Frage nach, was die heutige Resilienzforschung ist und genauer, welche Faktoren zur Bildung von Resilienz führen. Auch soll die Förderung der Resilienzbildung im Hinblick auf solche Faktoren untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung
- 2.1 Charakteristika des Resilienzkonzepts
- 2.2 Empirische Forschungsbefunde
- 2.3 Zukünftige Forschungsperspektive
- 2.4 Perspektivenwechsel der Resilienzforschung
- 3. Resilienz - Kritik und Perspektiven
- 3.1 Resilienzforschung
- 3.2 Resilienz, Bildung und soziale Ungleichheit
- 3.3 Perspektiven und Kritik
- 4. Resilienz - Forschung, begünstigende Faktoren und Förderung
- 5. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der Resilienz im Kontext der Kinderentwicklung, insbesondere wie Kinder Entwicklungsrisiken überwinden. Sie analysiert die aktuelle Resilienzforschung, vergleicht verschiedene Forschungsansätze und identifiziert Faktoren, die zur Entwicklung von Resilienz beitragen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Resilienzbildung.
- Definition und Charakteristika von Resilienz
- Empirische Befunde zur Resilienzforschung, insbesondere die Kauai-Längsschnittstudie
- Bedeutung von personalen und sozialen Ressourcen für die Resilienzentwicklung
- Perspektiven und Kritikpunkte der Resilienzforschung
- Förderung der Resilienzbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Resilienzforschung ein und stellt den Kontext von Armut, Scheidungen und daraus resultierenden Entwicklungsrisiken für Kinder dar. Sie hebt die Fähigkeit von Kindern hervor, trotz widriger Umstände positive Entwicklungsverläufe zu nehmen, und kündigt die Gegenüberstellung der Arbeiten von Corina Wustmann und Thomas Gabriel an. Die zentrale Forschungsfrage betrifft die aktuelle Resilienzforschung, die Faktoren zur Resilienzbildung und deren Förderung.
2. Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung: Dieses Kapitel definiert Resilienz nach Corina Wustmann als die Fähigkeit, Lebenskrisen ohne langwierige psychische Folgen zu überstehen. Es beleuchtet die Charakteristika des Resilienzkonzepts als dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess, der durch das Wechselspiel zwischen Kind und Umwelt geprägt ist. Die erfolgreiche Bewältigung von Problemen stärkt das Kind und ermöglicht es ihm, zukünftigen Risiken besser zu begegnen. Die Autorin stützt sich auf die Kauai-Längsschnittstudie, die die Konstruktion der Lebensumwelt durch Kinder und die Entwicklung von Resilienz untersucht. Resilienz wird als variable, situationsspezifische und multidimensionale Größe beschrieben, die sich im Verlauf der Entwicklung verändert.
3. Resilienz - Kritik und Perspektiven: (Annahme: Dieses Kapitel würde die Kritikpunkte und Perspektiven der Resilienzforschung diskutieren, unter anderem die Punkte der sozialen Ungleichheit und die Herausforderungen bei der praktischen Anwendung der Forschungsergebnisse. Eine detaillierte Zusammenfassung dieses Kapitels kann erst nach dem Lesen des vollständigen Textes erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Resilienz, Resilienzforschung, Kinderentwicklung, Entwicklungsrisiken, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, personale Ressourcen, soziale Ressourcen, Kauai-Längsschnittstudie, Widerstandsfähigkeit, soziale Ungleichheit, Förderung von Resilienz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Resilienzforschung in der Kinderentwicklung
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Resilienzforschung im Kontext der Kinderentwicklung. Er analysiert das Konzept der Resilienz, untersucht empirische Befunde, insbesondere die Kauai-Längsschnittstudie, und beleuchtet kritische Perspektiven und Fördermöglichkeiten der Resilienzbildung bei Kindern.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Charakteristika von Resilienz, empirische Befunde der Resilienzforschung (mit Fokus auf die Kauai-Studie), die Bedeutung personaler und sozialer Ressourcen für die Resilienzentwicklung, Kritikpunkte und Perspektiven der Resilienzforschung sowie die Förderung der Resilienzbildung. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bewältigung von Entwicklungsrisiken wie Armut und Scheidung bei Kindern.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage. Kapitel 2 beleuchtet die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung, definiert Resilienz nach Wustmann und analysiert die Kauai-Studie. Kapitel 3 (Resilienz - Kritik und Perspektiven) diskutiert kritische Punkte und Perspektiven der Forschung, inklusive sozialer Ungleichheit. Kapitel 4 befasst sich mit der Forschung zu Resilienz, begünstigenden Faktoren und deren Förderung. Kapitel 5 enthält die Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Resilienz, Resilienzforschung, Kinderentwicklung, Entwicklungsrisiken, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, personale Ressourcen, soziale Ressourcen, Kauai-Längsschnittstudie, Widerstandsfähigkeit und soziale Ungleichheit.
Welche Forschungsansätze werden verglichen?
Der Text vergleicht implizit verschiedene Forschungsansätze innerhalb der Resilienzforschung, indem er die Arbeit von Corina Wustmann und Thomas Gabriel gegenüberstellt und die Ergebnisse der Kauai-Längsschnittstudie analysiert. Eine explizite Gegenüberstellung verschiedener Ansätze wird jedoch nicht im Detail ausgeführt.
Welche Rolle spielt die Kauai-Längsschnittstudie?
Die Kauai-Längsschnittstudie dient als wichtiger empirischer Bezugspunkt, um die Konzepte der Resilienz und der Konstruktion der Lebensumwelt durch Kinder zu veranschaulichen und zu belegen.
Wie wird Resilienz im Text definiert?
Resilienz wird im Text, angelehnt an Corina Wustmann, als die Fähigkeit definiert, Lebenskrisen ohne langwierige psychische Folgen zu überstehen. Sie wird als dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess beschrieben, der durch das Wechselspiel zwischen Kind und Umwelt geprägt ist.
Welche Kritikpunkte an der Resilienzforschung werden angesprochen?
Der Text erwähnt, dass Kapitel 3 Kritikpunkte und Perspektiven der Resilienzforschung diskutiert, unter anderem die soziale Ungleichheit und Herausforderungen bei der praktischen Anwendung der Forschungsergebnisse. Konkrete Kritikpunkte werden in der Zusammenfassung jedoch nicht detailliert aufgeführt, da der vollständige Text nicht zur Verfügung steht.
Wie kann Resilienz gefördert werden?
Der Text deutet an, dass Kapitel 4 die Förderung der Resilienzbildung thematisiert, jedoch ohne konkrete Maßnahmen in der Zusammenfassung zu nennen.
- Quote paper
- Ricarda Albrecht (Author), 2007, Resilienzforschung: Wie Kinder Entwicklungsrisiken überwinden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213747