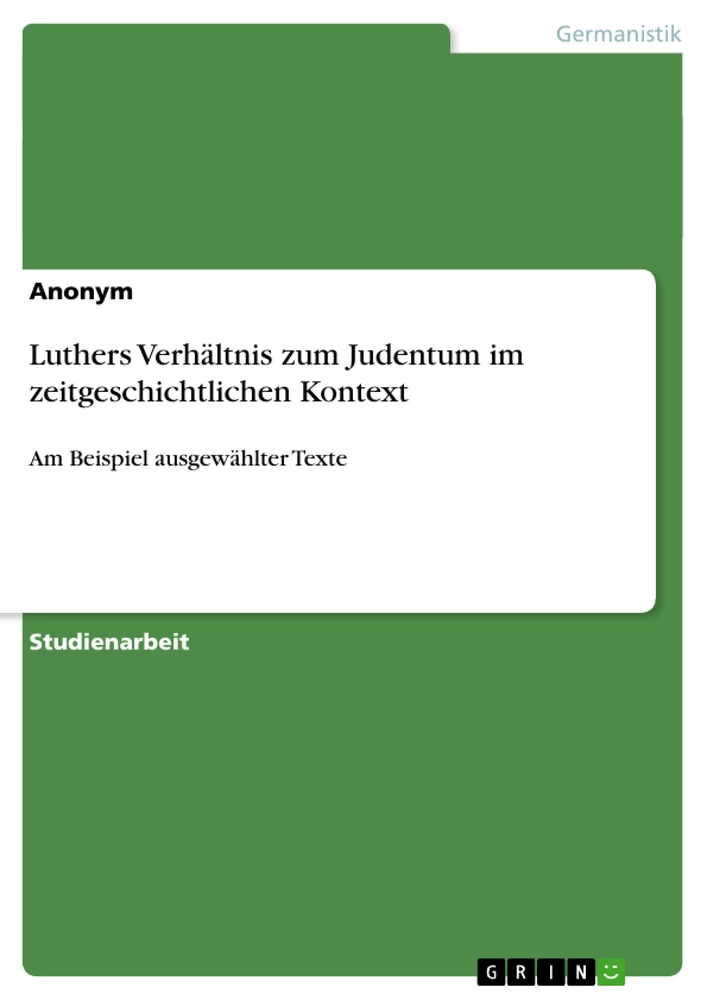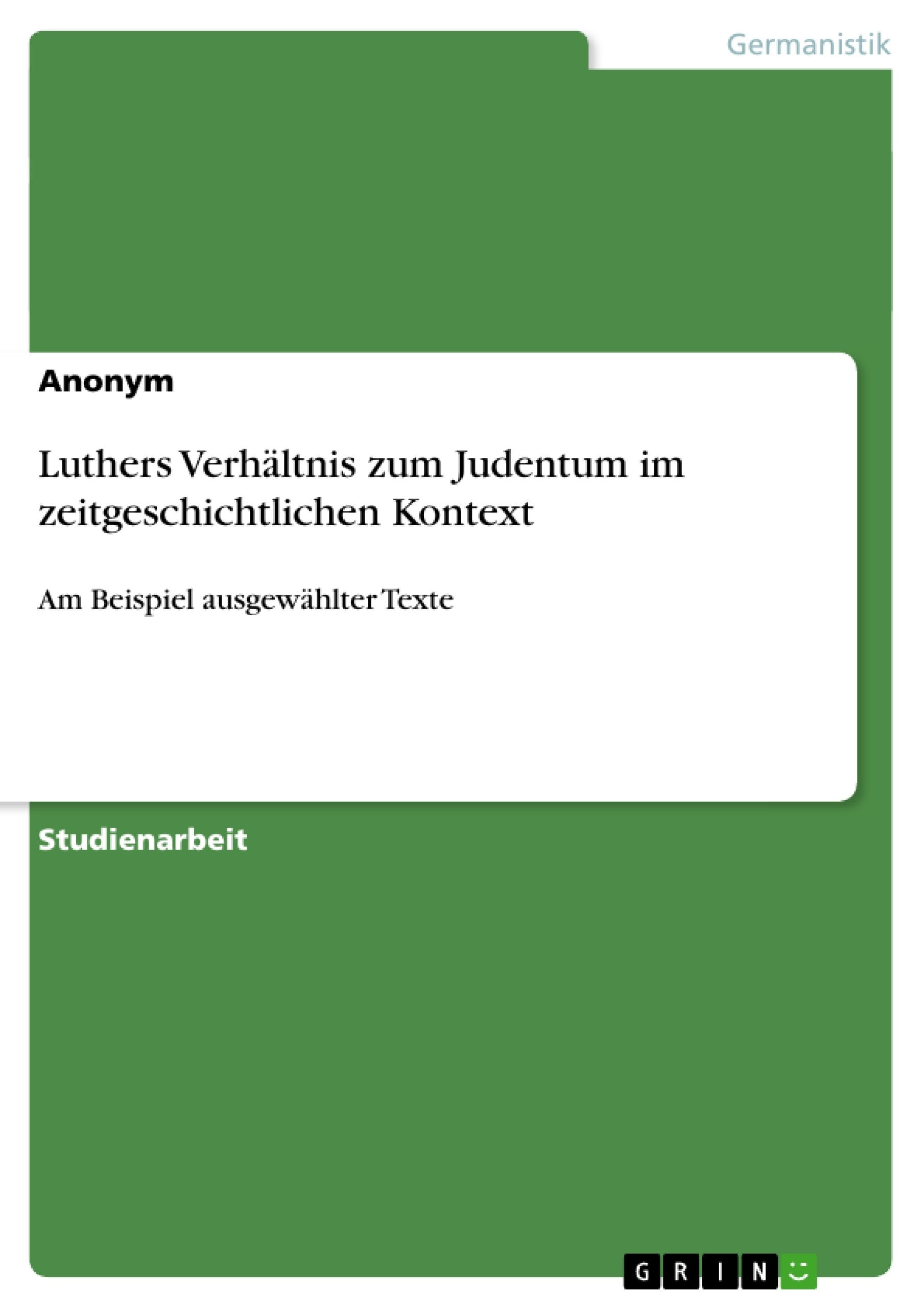Einleitung
Martin Luther gilt als Begründer der Reformation in Deutschland im 16. Jahrhundert. Durch die Übersetzung der Bibel ins Deutsche hat Luther einen Meilenstein für das Christentum und die deutsche Sprache gesetzt. Sein Schaffen wirkt noch bis in die heutige Zeit und Luthers Persönlichkeit ist lebenskräftiger geblieben als jede andere Gestalt der deutschen und europäischen Geschichte der frühen Neuzeit. Trotz des ganzen Lobes und der Anerkennung, die Luther auch heute noch genießt, gehört er zu den umstrittensten Persönlichkeiten jener Epoche, denn Luther wurde und wird auch heute noch vorgeworfen in seinen sogenannten „Judenschriften“ judenfeindliche Tendenzen zu äußern. Gerade für die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler schien Martin Luther ein Wegbereiter des Antisemitismus zu sein. Viele von ihnen beriefen sich auf den deutschen Geistlichen und den Inhalt seiner Schriften.
Meine Seminararbeit soll sich mit dem Ursprung, nämlich den sogenannten „Judenschriften“ „Daß Jesus ein geborener Jude sei“, „Wider Sabbather an einen guten Freund“, „Von den Juden und ihren Lügen“ und „Vom Schem Hampohras und vom Geschlecht Christi“ als Quellen beschäftigen und klären, was für ein Verhältnis Luther zu den Juden und dem Judentum hatte und wie er sich schriftlich über die Thematik geäußert hat.
Anschließend sollen Luthers Texte und seine Aussagen in die Epoche der frühen Neuzeit eingeordnet werden. Da man jeden literarischen Text im Zuge seiner Entstehung, der Biographie des Autors und den Zeitumständen betrachten sollte, ist es wichtig die Texte zu differenzieren und nicht als vereinzelte, literarische Objekte zu sehen, sondern sie im Kontext der Entstehungszeit wirken zu lassen, ohne dabei schnelle Urteile zu fällen. Am Ende der Seminararbeit soll der Frage, ob und warum sich Luther gegen die Juden stellte oder ob er sogar ein Antisemit war annähernd Antwort geleistet werden.
Die Forschung hat sich erst ab dem 20. Jahrhundert intensiv mit Luther und seiner Beziehung zu den Juden gewidmet. Ab diesem Zeitpunkt haben sich viele Wissenschaftler, Historiker, Privatpersonen, aber auch Institutionen, wie die evangelische Kirche zu diesem Thema geäußert. Im Gegensatz zur öffentlichen Meinung, die Luther als Antisemiten gebrandmarkt und ihm Geschichtsmächtigkeit bis zu Hitler zugesprochen hat, erscheint er in der Lutherforschung als ein Mann des Wechsels zwischen Rollen des Judenfreundes und
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Luthers „Judenschriften“
1.1. „Daß Jesus ein geborener Jude sei“
1.2. „Wider Sabbather an einen guten Freund“
1.3. „Von den Juden und ihren Lügen“
1.4. „Vom Schem Hampohras und vom Geschlecht Christi“
2. Luthers Schrift im Kontext ihrer Entstehungszeit
3. Zusammenfassung
4. Literatur- und Quellenverzeichnis
Einleitung
Martin Luther gilt als Begründer der Reformation in Deutschland im 16. Jahrhundert. Durch die Übersetzung der Bibel ins Deutsche hat Luther einen Meilenstein für das Christentum und die deutsche Sprache gesetzt. Sein Schaffen wirkt noch bis in die heutige Zeit und Luthers Persönlichkeit ist lebenskräftiger geblieben als jede andere Gestalt der deutschen und europäischen Geschichte der frühen Neuzeit.[1] Trotz des ganzen Lobes und der Anerkennung, die Luther auch heute noch genießt, gehört er zu den umstrittensten Persönlichkeiten jener Epoche, denn Luther wurde und wird auch heute noch vorgeworfen in seinen sogenannten „Judenschriften“ judenfeindliche Tendenzen zu äußern. Gerade für die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler schien Martin Luther ein Wegbereiter des Antisemitismus zu sein. Viele von ihnen beriefen sich auf den deutschen Geistlichen und den Inhalt seiner Schriften.
Meine Seminararbeit soll sich mit dem Ursprung, nämlich den sogenannten „Judenschriften“ „Daß Jesus ein geborener Jude sei“, „Wider Sabbather an einen guten Freund“, „Von den Juden und ihren Lügen“ und „Vom Schem Hampohras und vom Geschlecht Christi“ als Quellen beschäftigen und klären, was für ein Verhältnis Luther zu den Juden und dem Judentum hatte und wie er sich schriftlich über die Thematik geäußert hat.
Anschließend sollen Luthers Texte und seine Aussagen in die Epoche der frühen Neuzeit eingeordnet werden. Da man jeden literarischen Text im Zuge seiner Entstehung, der Biographie des Autors und den Zeitumständen betrachten sollte, ist es wichtig die Texte zu differenzieren und nicht als vereinzelte, literarische Objekte zu sehen, sondern sie im Kontext der Entstehungszeit wirken zu lassen, ohne dabei schnelle Urteile zu fällen. Am Ende der Seminararbeit soll der Frage, ob und warum sich Luther gegen die Juden stellte oder ob er sogar ein Antisemit war annähernd Antwort geleistet werden.
Die Forschung hat sich erst ab dem 20. Jahrhundert intensiv mit Luther und seiner Beziehung zu den Juden gewidmet. Ab diesem Zeitpunkt haben sich viele Wissenschaftler, Historiker, Privatpersonen, aber auch Institutionen, wie die evangelische Kirche zu diesem Thema geäußert. Im Gegensatz zur öffentlichen Meinung, die Luther als Antisemiten gebrandmarkt und ihm Geschichtsmächtigkeit bis zu Hitler zugesprochen hat, erscheint er in der Lutherforschung als ein Mann des Wechsels zwischen Rollen des Judenfreundes und des Judenfeindes. Im Jahre 1523 engagiert er sich tatsächlich für die Beseitigung von Hindernissen, die einer Judenbekehrung im Wege stehen. Seine schroffen Schriften der dreißiger und vierziger Jahre hingegen überhäufen die Juden mit Schimpf und Schande wegen ihrer „verstockten Blindheit.“[2] So wird Luther von den einen für seine Leistung vergöttert und gegenüber Kritikern bis aufs Äußerste verteidigt, so sehen die Anderen die Ebene und Basis die Luther für Antisemiten, Nationalsozialisten und Fremdenfeinde geschaffen hat. Martin Luther wurde missbraucht, verzerrt und heroisiert.[3]
Diese Arbeit soll anhand der Quellentexte Luthers Verhältnis zum Judentum aufzeigen und einen neutralen Blick auf ihn und seine Sichtweisen werfen.
1. Luthers „Judenschriften“
Die äußeren Veranlassungen dafür, dass sich Luther zwischen 1538 und 1543 in insgesamt vier thematischen Einzelschriften mit dem Judentum auseinandersetze, sind vielfältig und nur zum Teil durchsichtig. Im nächsten Abschnitt soll dennoch ein Versuch gestartet werden zu erklären, wie und mit welcher Motivation er seine „Judenschriften“ verfasste, welche Ziele er damit verfolgte und was dies für Luther und seine Beziehung zum Judentum aussagt.
1.1. „Dass Jesus ein geborener Jude sei“ (1523)
„Dass Jesus ein geborener Jude sei“ gehört zu Martin Luthers frühen „Judenschriften.“ Obwohl Luther bei der Entstehung des Textes im Jahr1523, schon 40 Jahre alt war, wird diese Schrift oft als sein „Jugendwerk“ ausgegeben und gilt als eher „judenfreundlich“, da sich Luther hier von allen Schriften am mildesten und tolerantesten zum Judentum äußert. In kurzer Zeit erlebte das Werk Luthers sieben Auflagen und fand weite Verbreitung.
Anlass und Motivation für das Verfassen dieser Schrift war ein Brief, indem der Erzherzog Ferdinand Luther beschuldigte, dass dieser fälschlicherweise der Öffentlichkeit lehre, Christus sei Abrahams Same und er durch diese Aussage die Jungfräulichkeit Marias leugne. Die „alte Kirche“ fordert Luther daraufhin auf, Stellung zu beziehen und so seinen und den Ruf der Kirche wieder reinzuwaschen.[4] Luther, der dies anfänglich für nicht ganz ernst gemeint hält, bleibt nichts anderes übrig, als auf diese Vorwürfe zu reagieren und verfasst somit das besagte Stück. „Daß Jesus ein geborener Jude sei“ ist somit eine Verteidigungsschrift, die den Vorwurf der Ketzerei zurückweist.[5] Zu Beginn versucht Luther die Gründe zu erläutern, weshalb er fest daran glaubt, dass Christus ein Jude sei, der von einer Jungfrau geboren wurde. Er beschreibt die Juden und ihr Verhältnis zum Christentum und erklärt, dass „die Juden von dem Geblüt Christi sind, wir Heiden sind, Schwäger und Fremdlinge, sie sind Blutsfreunde, Vettern und Brüder unseres Herren. So gehören die Juden näher zu Christo als wir.“[6] Luther weist daraufhin die Juden zurecht, da sie die Prophezeiungen der biblischen Weisen nicht als konkrete Deutung der Ankunft Jesu interpretiert haben. Somit ist für Luther die jüdische Auslegung des Alten Testaments „falsch“. Er wirft ihnen „teufelische Hoffart“[7] vor und verbindet damit die Absicht „ob ich vielleicht auch der Juden ettliche mocht tzum Christen glauben reytzen.“[8] Hier sollte man erwähnen, dass sich seine Bemühung die Juden zu bekehren auf die Bekehrung etlicher und nicht auf die Bekehrung des ganzen jüdischen Volkes bezieht, so dass in seiner Schrift „Juden nicht primär, sondern sekundär und indirekt angesprochen werden.“[9]
Weiterhin gibt Luther dem Leser zwei Ratschläge mit auf dem Weg: Die Juden sollen freundlich behandelt und in das Leben in der Gesellschaft voll aufgenommen werden. Des weiteren soll ihnen gezeigt werden, dass Jesus der rechte Messias ist. Später, wenn sie erkannt und akzeptiert haben, dass der Mensch Jesu auch wahrhaftig Gott ist, soll ihnen näher gebracht werden, dass Jesu somit auch der einzige und wahre Gott ist.[10]
Am Ende gibt er den Rat, dass man die Juden „säuberlich unterweist, damit ihrer viele rechte Christen werden und wieder zu ihrer Väter, der Propheten und Patriarchen Glauben treten.“[11] Er zielt darauf ab, das Verständnis für den christlichen Glauben bei bereits getauften Juden zu vertiefen bzw. denjenigen, die sich der christlichen Judenmission annehmen wollten, ein Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Um Martin Luthers Reaktion und Ansichten in dieser Schrift verstehen zu können, muss man sich immer wieder seine Sichtweise der Dinge im zeitgeschichtlichen Kontext ins Gedächtnis rufen. Die Juden lehnen ganz klar die Erlösungslehre ab, sodass Luther sie als Feinde für das Christentum sieht.
Inwiefern diese Schrift judenfreundlich oder gar feindlich ist sollte man versuchen anhand der Frage zu klären an wen diese Schrift Luthers ursprünglich gerichtet war. Adressaten sind die „narren und grobe(n) esels kopffe“[12], die gegen ihn Vorwürfe erhoben haben, also die Papisten, Mönche und Bischöfe: Christen, keine Juden. Zwar spricht Luther von und über die Juden, dennoch spricht erwähnt er sie immer in der dritten Person, „daraus ergibt sich, dass Luther das Problem des nachbiblischen Judentums im innerchristlichen Bereich und eingebettet in die innerchristliche Auseinandersetzung um seine Reformation behandelt.“[13] Was an der Schrift exemplarisch deutlich wird ist, dass Luther „in der Regel über Juden, nicht aber mit oder zu ihnen sprach. Es geht ihm vorrangig darum, wie andere mit den Juden reden sollten.“[14] Einen Versuch, selbst in direkten Kontakt mit verschiedenen Juden zu treten, hat Luther weder mit dieser noch mit einer der anderen „Judenschriften“ unternommen: Er liefert eine theologische Grundlegung der Judenmission, leistet aber keinen Beitrag dazu, wie, durch wen und in welcher Form sie durchgeführt werden sollte.[15]
Nun stellt sich die Frage, weshalb sich Martin Luther in dieser Schrift nicht so hart und radikal gegen die Juden äußert, wie bei seinen späteren Werken. Ist Martin Luther erst im Laufe der Jahre zum „Judenhasser“ geworden und war er ihnen sogar freundlich gesonnen? 1522 hatte sich Martin Luther hoch motiviert und voller Leidenschaft mit der Übersetzung des Neuen Testaments in die deutsche Sprache beschäftigt und dadurch eine Art Zuneigung für das Judentum entwickelt.[16]
Die Juden waren auf Luther aufmerksam geworden und beschäftigten sich intensiv mit ihm als Person und Schriftsteller. Dies war der Grund, weshalb Luther dachte, die Juden ließen sich bekehren und würden ihm zuströmen. Er hatte in einem neuen Ton über die Juden gesprochen und damit eine Bekehrungswelle zum Christentum auszulösen gehofft. Mit diesem Vorhaben ist er allerdings kläglich gescheitert, weil sich die Juden durch das „Werben“ der Christen in ihrer Ablehnung des Christentums bestärkt fühlten. Vielmehr fühlten sie sich in ihrem Hass auf die Christen durch die Schrift noch weiter angestachelt.
Als die Bekehrung somit ausblieb, änderte sich Luthers Sichtweise auf das jüdische Volk. Diese Enttäuschung und das Unverständnis darüber ließ er in seine späteren Schriften einfließen. Sein Verhalten gegenüber den Juden wurde nun ausgesprochen unchristlich. Luther war, so schrieb Thomas Mann Jahrhunderte später, "ein mächtiger Hasser, zum Blutvergießen von ganzem Herzen bereit."[17]
1.2. „Wider die Sabbathehr an einen guten Freund“ (1538)
Der Anlass für diese Schrift war ein Brief des Grafen Wolf Schlick zu Falkenau, der Luther darüber informiert hatte, dass Hunderte Christen zum Judentum konvertiert seien und somit das jüdische Gesetz und den Sabbat übernommen hätten. Dies war von Beginn seiner kirchlichen Laufbahn Luthers größte Angst gewesen. Luthers Antwort auf die Geschehnisse war „Wider die Sabbather an einen guten Freund.“ Auf diese Schrift reagierten die Juden, indem sie eine Gegenschrift verfassten, die sich auf den Inhalt des besagten Stückes bezog. Luthers Ansicht nach verfälschte diese Schrift biblische Wahrheiten, sodass er sein umfangreiches Buch „Von den Juden und ihren Lügen“ verfasste, welches 1543 erschien.[18] Beide Schriften gehören somit zu den „späten Judenschriften.“
[...]
[1] Hellmut Diwald, Luther, Eine Biographie, S.8.
[2] Heiko Obermann, Wurzeln des Antisemitismus, S.56.
[3] Ludwig Schneider, Martin Luther und die Juden, S.9.
[4] Johannes Brosseder, Martin Luther und der Leidensweg der Juden, S.120.
[5] Johannes Brosseder, Martin Luther und der Leidensweg der Juden, S.122.
[6] Martin Luther, Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, WA 11, S.314.
[7] ebd., S.422.
[8] ebd., S.324.
[9] Johannes Brosseder, Martin Luther und der Leidensweg, S.124.
[10] ebd., S.122.
[11] Martin Luther, Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, WA 11, S.315.
[12] Martin Luther, Wider die Sabbather an einen guten Freund, WA 50, S.309
[13] Johannes Brosseder, Martin Luther und der Leidensweg der Juden, S.121.
[14] Thomas Kaufmann, Luthers „Judenschriften“ in ihren historischen Kontexten, S.9.
[15] Thomas Kaufmann, Luthers „Judenschriften“ in ihren historischen Kontexten, S.30.
[16] Ludwig Schneider, Martin Luther und die Juden, S.16.
[17] Ernst Walter Zeeden, Luther und die Deutschen, S.41.
[18] Paul Ahring, Die Theologie der Reformationszeit und die Juden, S.105.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Luthers Verhältnis zum Judentum im zeitgeschichtlichen Kontext , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213721