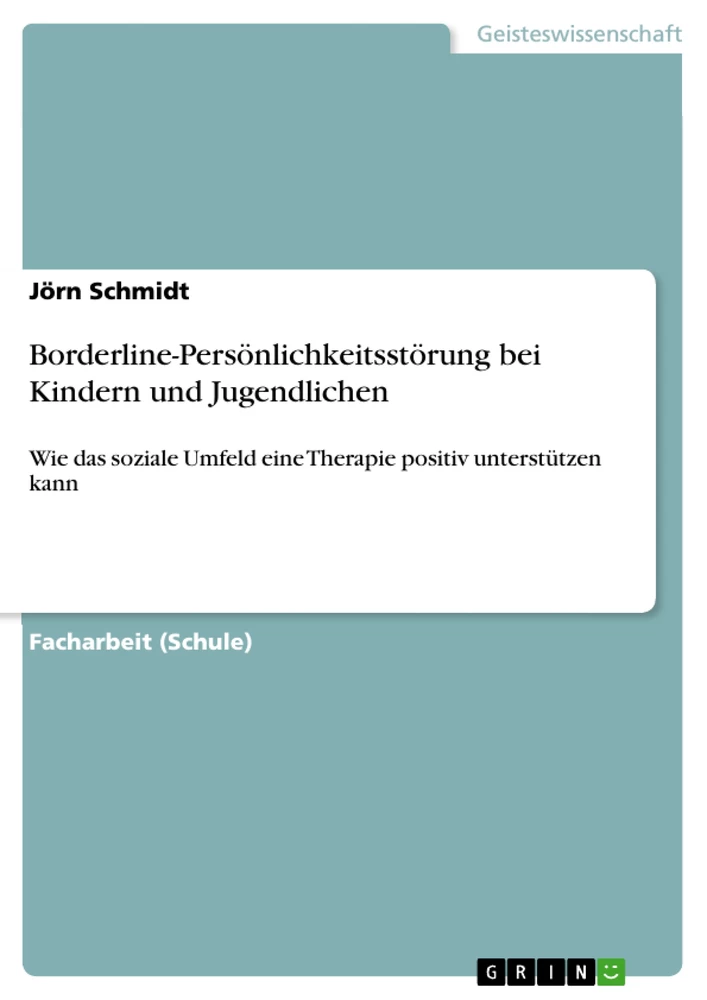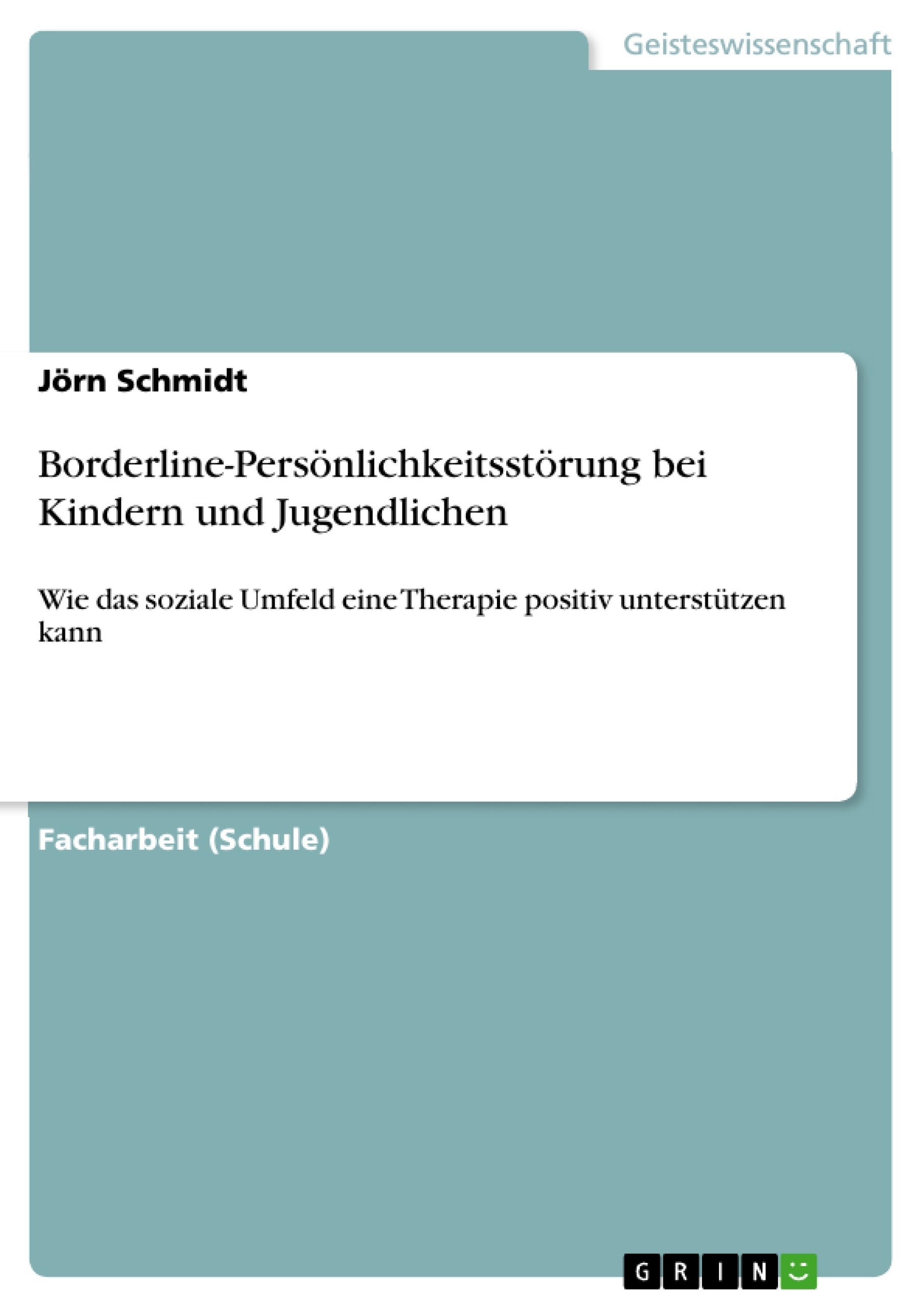„Borderline: Grenzgänger zwischen Extremen" (Braunmiller, 2010), so titelt Focus online am 6. Oktober 2010. Bereits diese Überschrift verrät die Ernsthaftigkeit dieses Themas. Beim Borderline-Syndrom – kurz BPS – handelt es sich um eine Persönlichkeitsstörung.
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist durch die Unfähigkeit des Eingehens zwischenmenschlicher Beziehungen, das instabile emotionale Erleben, eine gestörte Affektregulation sowie das verzerrte Selbstbild des Betroffenen gekennzeichnet.
Was aber können Schulen, Jugendeinrichtungen, Peers und andere mit Jugendlichen in Beziehung stehende Personen und Einrichtungen tun, um psychisch kranke Jugendliche bestmöglich zu unterstützen?
Diese Arbeit klärt auf 69 Seiten (im Format DIN A4; Druckformat ggf. abweichend) kurz und informativ über die Borderline-Persönlichkeitsstörung und deren Therapie auf, gibt Lehrern, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen Tipps zum Umgang mit Borderline-Patienten und bietet ihnen eine Auswahl von Präventionsmöglichkeiten.
Auch das weitere soziale Umfeld erhält wertvolle Tipps, um besser mit dem Betroffenen umgehen zu können und gleichzeitig die Therapieerfolge des Betroffenen deutlich zu verbessern.
Somit bietet diese Arbeit sowohl einen Ratgeber für Angehörige, Bildungseinrichtungen / Lehrerinnen und Lehrer, sowie Peers, die mit dem betroffenen Jugendlichen in Beziehung stehen, als auch eine ausführliche Übersicht über das Störungsbild, die Ursachen, Diagnostik, Epidemiologie, Therapiemöglichkeiten sowie viele weitere Themen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort und persönliche Danksagung
- Einleitung
- Geschichte der BPS
- Definitionen, Klassifikationen, Epidemiologie
- Klassifikationssysteme im Überblick
- ICD-10 (WHO)
- DSM-IV-TR (APA)
- Definition von Persönlichkeitsstörungen
- Persönlichkeitsstörungen nach ICD-10
- Persönlichkeitsstörungen nach DSM-IV-TR
- Definitionen der Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Definitionen der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach ICD-10
- Definition emotional-instabiler Persönlichkeitsstörungen
- Definition des impulsiven Typus (F.60.30) nach ICD-10
- Diagnosefindung zum impulsiven Typus nach ICD-10 (F60.30)
- Definition der Borderline-Persönlichkeitsstörung (F60.31) nach ICD-10
- Diagnosefindung zum Borderline-Typus (F60.31) nach ICD-10
- Definition der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach DSM-IV
- Definitionen der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach ICD-10
- Epidemiologie der BPS im Kindes- und Jugendalter
- Konzept von Persönlichkeitsstörungen
- Terminologie
- Das Temperament
- Der Charakter
- Persönlichkeitsstörung
- Soziopathie
- Fazit und Zusammenhänge
- Dimensionale Konzepte
- Psychodynamisch orientierte Konzepte
- Terminologie
- Klassifikationssysteme im Überblick
- Symptomatik
- Ätiologie
- Genetik
- Psychosoziale Bedingungen
- Neurobiologie und radiologische Bildgebung
- Diagnostik der BPS
- Spezielle Anamnese
- Komorbiditäten
- Psychologische Diagnostik
- Selbsteinschätzungsfragebögen
- Interviewtechniken
- Strukturiertes klinisches Interview für DSM-IV (SKID-II)
- International Personality Disorder Examination (IPDE)
- Vergleich SKID-II und IPDE
- Dimensionale Diagnostik
- Inventar klinischer Persönlichkeitsakzentuierungen (IKP)
- Persönlichkeitsstil- und Störungsinventar (PSSI)
- Klinische Untersuchung
- Differentialdiagnostik
- Adoleszentenkrise
- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
- Psychosen
- Therapie
- Dialektisch-behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A)
- Die Rolle des Therapeuten
- Förderung der Fertigkeiten des Patienten
- Den Patienten motivieren, an der Therapie teilzunehmen
- Telefonkontakt zum Patienten
- Therapeutenaustausch
- Betreuung des sozialen Umfeldes
- Therapieablauf / -module
- Gruppentherapie
- Einzeltherapie
- Supervisionsgruppe
- Telefonberatung
- Therapieziele
- Therapieabschluss
- Wirksamkeit der DBT-A im ambulanten Setting
- Die Rolle des Therapeuten
- Dialektisch-behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A)
- Die therapiestützende Rolle des sozialen Umfeldes (empirischer Teil)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) bei Kindern und Jugendlichen und analysiert, wie das soziale Umfeld die Therapie positiv unterstützen kann. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der BPS zu vermitteln, einschließlich ihrer Definition, Klassifikation, Ätiologie und Diagnostik. Ein besonderer Fokus liegt auf der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT-A) und der Bedeutung des sozialen Umfeldes im Therapieprozess.
- Definition und Klassifikation der BPS nach ICD-10 und DSM-IV-TR
- Ätiologie der BPS: Genetische, psychosoziale und neurobiologische Faktoren
- Diagnostische Verfahren für BPS im Kindes- und Jugendalter
- Dialektisch-Behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A) als Behandlungsansatz
- Die Rolle des sozialen Umfeldes in der Therapie von BPS
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) bei Kindern und Jugendlichen ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie hebt die Bedeutung des sozialen Umfeldes für den Therapieerfolg hervor und verweist auf die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise.
Geschichte der BPS: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Verständnisses und der Behandlung von BPS. Es beschreibt die Veränderungen in der Diagnostik und Therapie über die Zeit und die Herausforderungen, die sich bei der Behandlung von BPS, insbesondere im Kindes- und Jugendalter, gestellt haben.
Definitionen, Klassifikationen, Epidemiologie: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Übersicht über die Definition und Klassifikation von BPS gemäß ICD-10 und DSM-IV-TR. Es erläutert die Unterschiede in den Klassifizierungssystemen und diskutiert die epidemiologischen Aspekte der Störung im Kindes- und Jugendalter. Es werden verschiedene Konzepte von Persönlichkeitsstörungen vorgestellt, um ein umfassenderes Verständnis der Störung zu ermöglichen.
Symptomatik: Dieses Kapitel beschreibt die typischen Symptome einer BPS bei Kindern und Jugendlichen. Es differenziert zwischen den verschiedenen Symptombereichen und zeigt auf, wie sich die Symptomatik im Laufe der Entwicklung verändern kann. Es stellt die Herausforderungen dar, die sich aus der Heterogenität der Symptomatik ergeben.
Ätiologie: Dieses Kapitel erörtert die Ursachen von BPS. Es untersucht genetische, psychosoziale und neurobiologische Faktoren, die zur Entstehung der Störung beitragen können. Der Fokus liegt auf dem komplexen Zusammenspiel verschiedener Einflussfaktoren und der individuellen Vulnerabilität.
Diagnostik der BPS: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen diagnostischen Verfahren zur Erkennung von BPS bei Kindern und Jugendlichen. Es erläutert die Bedeutung der Anamnese, die Rolle von Komorbiditäten und die Anwendung verschiedener psychologischer Tests und Interviews, wie z.B. SKID-II und IPDE. Es hebt die Bedeutung der Differentialdiagnostik hervor, um BPS von anderen Störungen abzugrenzen.
Therapie: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Dialektisch-Behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A) als eine effektive Behandlungsmethode für BPS. Es beschreibt die Rolle des Therapeuten, den Therapieablauf mit seinen verschiedenen Modulen (Gruppentherapie, Einzeltherapie, Telefonberatung etc.) und die Therapieziele. Die Wirksamkeit der DBT-A im ambulanten Setting wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Borderline-Persönlichkeitsstörung, BPS, Kinder, Jugendliche, ICD-10, DSM-IV-TR, Ätiologie, Diagnostik, Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT-A), Therapie, soziales Umfeld, Komorbidität, Psychosoziale Faktoren, Neurobiologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Facharbeit: Borderline-Persönlichkeitsstörung bei Kindern und Jugendlichen
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit befasst sich mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) bei Kindern und Jugendlichen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Rolle des sozialen Umfelds bei der Therapie und der Wirksamkeit der Dialektisch-Behavioralen Therapie für Adoleszente (DBT-A).
Welche Aspekte der BPS werden behandelt?
Die Arbeit behandelt umfassend verschiedene Aspekte der BPS, darunter Definition und Klassifikation nach ICD-10 und DSM-IV-TR, die Ätiologie (genetische, psychosoziale und neurobiologische Faktoren), Diagnostik (Anamnese, Komorbiditäten, psychologische Tests, Differentialdiagnostik), und Therapie (insbesondere DBT-A).
Wie wird die BPS definiert und klassifiziert?
Die Facharbeit beschreibt detailliert die Definition und Klassifikation der BPS nach den gängigen Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV-TR. Die Unterschiede zwischen den Systemen werden erläutert, und verschiedene Konzepte von Persönlichkeitsstörungen werden vorgestellt.
Welche Ursachen für BPS werden diskutiert?
Die Ätiologie der BPS wird unter Berücksichtigung genetischer, psychosozialer und neurobiologischer Faktoren untersucht. Das komplexe Zusammenspiel dieser Faktoren und die individuelle Vulnerabilität spielen eine zentrale Rolle.
Welche diagnostischen Verfahren werden beschrieben?
Die Arbeit erläutert verschiedene diagnostische Verfahren, einschließlich Anamnese, Berücksichtigung von Komorbiditäten, und den Einsatz psychologischer Tests und Interviews wie SKID-II und IPDE. Die Bedeutung der Differentialdiagnostik zur Abgrenzung von anderen Störungen wird hervorgehoben.
Welche Therapiemethode steht im Mittelpunkt?
Die Dialektisch-Behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A) wird als effektive Behandlungsmethode vorgestellt. Die Rolle des Therapeuten, der Therapieablauf (Gruppentherapie, Einzeltherapie, Telefonberatung etc.), die Therapieziele und die Wirksamkeit im ambulanten Setting werden detailliert beschrieben.
Welche Rolle spielt das soziale Umfeld?
Ein wichtiger Aspekt der Arbeit ist die Rolle des sozialen Umfelds bei der Therapie von BPS. Die unterstützende Funktion des sozialen Umfeldes wird als essentiell für den Therapieerfolg betrachtet und empirisch untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Facharbeit?
Die Facharbeit beinhaltet Kapitel zu Vorwort/Danksagung, Einleitung, Geschichte der BPS, Definitionen/Klassifikationen/Epidemiologie, Symptomatik, Ätiologie, Diagnostik, Therapie und dem empirischen Teil zur Rolle des sozialen Umfeldes. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen: Borderline-Persönlichkeitsstörung, BPS, Kinder, Jugendliche, ICD-10, DSM-IV-TR, Ätiologie, Diagnostik, Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT-A), Therapie, soziales Umfeld, Komorbidität, Psychosoziale Faktoren, Neurobiologie.
- Quote paper
- Jörn Schmidt (Author), 2013, Borderline-Persönlichkeitsstörung bei Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213698