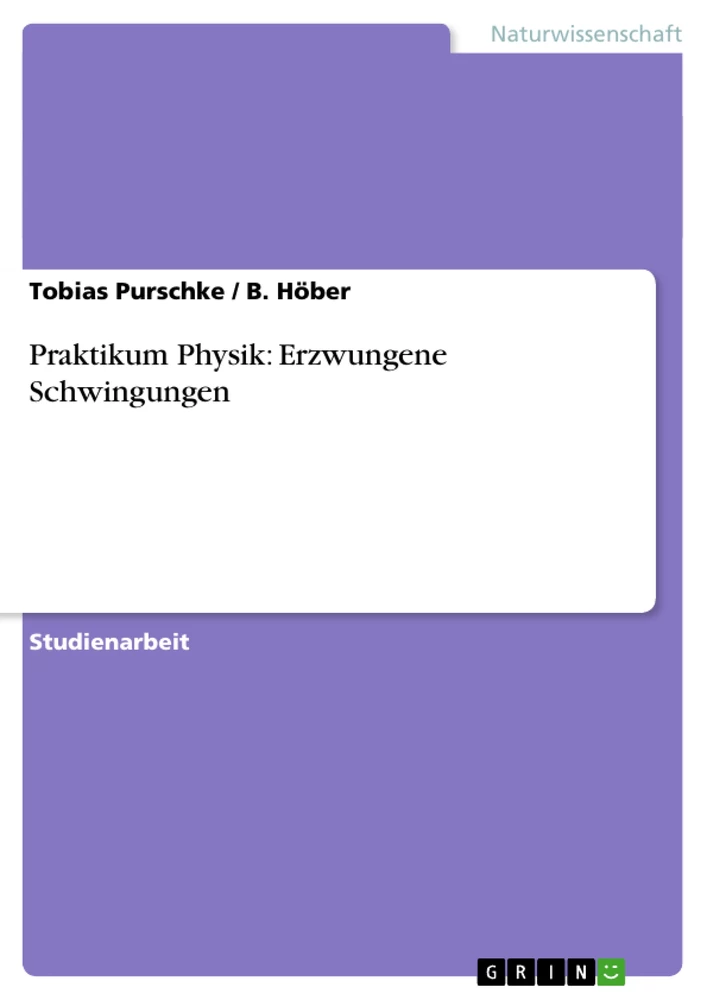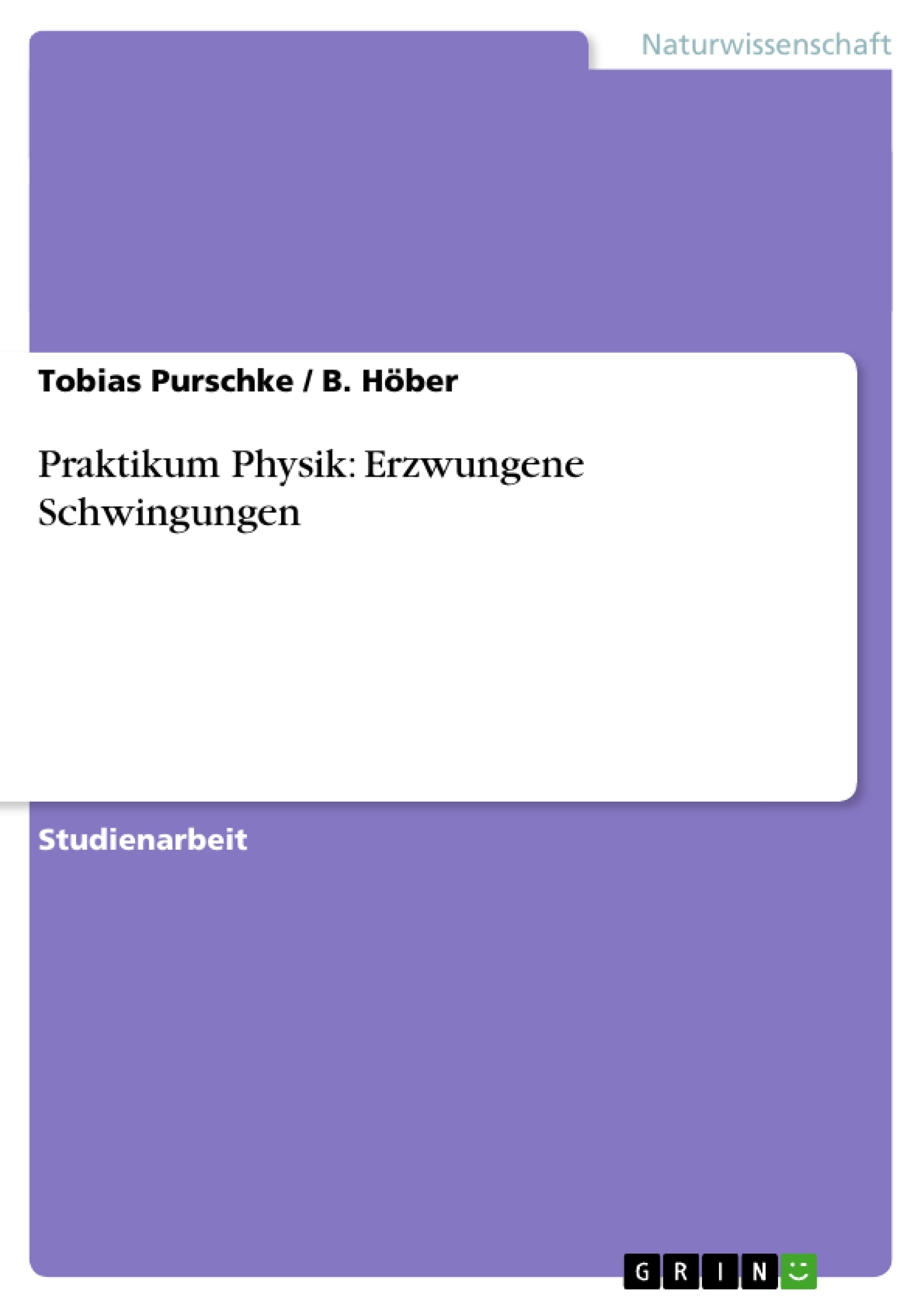Der Torsionsschwinger (Pohl’sches Rad) besteht aus einem flachen Kupferring, der auf der Achse drehbar und möglichst reibungsfrei gelagert ist, der Spiralfeder, die einerseits am Kupferring, andererseits an dem ebenfalls um die Achse drehbaren und zunächst feststehenden Hebel befestigt ist. Der Hebel kann durch die Schubstange, die durch einen Exzehnter auf der Achse eines drehzahlvariablen Elektromotors betätigt wird, in eine Schwingbewegung versetzt werden. Dadurch wird das innere Ende der Schubstange periodisch sinusförmig hin und her bewegt. Somit wird periodisches Drehmoment ausgeübt. Die Amplitude y (oder auch) vom Kupferring wird mit dem Zeiger an der Skala abgelesen.
2. Aufgabenstellung
Aufgabe 1: Bestimmen Sie zunächst ohne Wirbelstromdämpfung die Eigenfrequenz des Torsionspendels aus der Schwingungsdauer. Aufgabe 2: Variieren Sie die Wirbelstromdämpfung in 4 Stufen mit einem Erregerstrom
Inhaltsverzeichnis
- 1. Versuchsaufbau, Versuchsbeschreibung
- 2. Aufgabenstellung
- 3. Messinstrumente und Zubehör
- 4. Physikalische Grundlagen
- 5. Messergebnisse
- 5.1 Aufgabe 1
- 5.2 Aufgabe 2
- 5.3 Aufgabe 3
- 6. Auswertung
- 7. Fehlerrechnung
- 8. Mathematischer Beweis (Aufgabe 4)
- 9. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Praktikumsprotokoll dokumentiert die Untersuchung erzwungener Schwingungen mithilfe eines Torsionsschwingers (Pohl'sches Rad). Ziel ist es, die Eigenfrequenz des Systems zu bestimmen, den Einfluss der Wirbelstromdämpfung auf die Schwingungsamplitude zu analysieren und die Frequenzabhängigkeit der erzwungenen Schwingung zu untersuchen. Die mathematische Beschreibung der Resonanzfrequenz und Maximalamplitude wird ebenfalls behandelt.
- Bestimmung der Eigenfrequenz eines Torsionsschwingers
- Analyse des Einflusses der Wirbelstromdämpfung
- Untersuchung der Frequenzabhängigkeit der erzwungenen Schwingung
- Mathematischer Beweis der Resonanzfrequenz und Maximalamplitude
- Anwendung physikalischer Grundlagen auf ein experimentelles Setup
Zusammenfassung der Kapitel
1. Versuchsaufbau, Versuchsbeschreibung: Der Versuchsaufbau beschreibt einen Torsionsschwinger (Pohl'sches Rad), bestehend aus einem Kupferring, einer Spiralfeder und einem Hebel, der von einem Elektromotor angetrieben wird. Der Motor versetzt den Hebel in periodische Schwingungen, die auf den Kupferring übertragen werden. Die Amplitude der Schwingung des Kupferrings wird mit einem Zeiger an einer Skala abgelesen. Der Aufbau dient als Grundlage für die folgenden Experimente zur Untersuchung erzwungener Schwingungen und deren Abhängigkeit von verschiedenen Parametern wie der Dämpfung und der Erregerfrequenz.
2. Aufgabenstellung: Dieses Kapitel definiert die drei Hauptaufgaben des Experiments. Aufgabe 1 konzentriert sich auf die Bestimmung der Eigenfrequenz des ungedämpften Torsionsschwingers. Aufgabe 2 untersucht den Einfluss der Wirbelstromdämpfung auf die Schwingungsamplitude bei verschiedenen Stromstärken. Aufgabe 3 befasst sich mit der Untersuchung der Frequenzabhängigkeit der erzwungenen Schwingung unter verschiedenen Dämpfungsbedingungen. Schließlich wird in Aufgabe 4 der mathematische Beweis für die Resonanzfrequenz und die Maximalamplitude gefordert. Diese Aufgaben strukturieren den praktischen Teil des Experiments und leiten die Auswertung der Messergebnisse.
3. Messinstrumente und Zubehör: Hier werden die verwendeten Messgeräte und Materialien detailliert aufgelistet, darunter das Pohl'sche Rad, Netzgeräte, Amperemeter, ein Digitalmultimeter, ein Trennstelltrafo und ein Experimentiertrafo. Die angegebenen Toleranzen der Messgeräte unterstreichen die Wichtigkeit der Fehlerrechnung im späteren Verlauf des Protokolls und die Notwendigkeit, die Genauigkeit der Messergebnisse zu berücksichtigen.
4. Physikalische Grundlagen: Dieses Kapitel erläutert die physikalischen Grundlagen der Schwingungen, darunter freie und erzwungene, ungedämpfte und gedämpfte Schwingungen. Es werden die entsprechenden Differentialgleichungen vorgestellt und die unterschiedlichen Fälle der gedämpften Schwingung (schwache Dämpfung, starke Dämpfung, aperiodischer Grenzfall) diskutiert. Die mathematischen Zusammenhänge bilden die theoretische Basis für die Interpretation der experimentellen Ergebnisse und die Beantwortung der im Kapitel 2 gestellten Aufgaben.
Schlüsselwörter
Erzwungene Schwingungen, Torsionsschwinger, Pohl'sches Rad, Eigenfrequenz, Wirbelstromdämpfung, Resonanzfrequenz, Maximalamplitude, Dämpfungskonstante, Frequenzabhängigkeit, Amplitudenmessung.
Häufig gestellte Fragen zum Praktikumsprotokoll: Erzwungene Schwingungen am Torsionsschwinger
Was ist der Gegenstand des Praktikumsprotokolls?
Das Protokoll dokumentiert ein Experiment zur Untersuchung erzwungener Schwingungen mithilfe eines Torsionsschwingers (Pohl'sches Rad). Es behandelt die Bestimmung der Eigenfrequenz, den Einfluss der Wirbelstromdämpfung und die Frequenzabhängigkeit der erzwungenen Schwingung.
Welche Aufgaben wurden im Experiment bearbeitet?
Das Experiment umfasste drei Hauptaufgaben: 1. Bestimmung der Eigenfrequenz des ungedämpften Systems, 2. Analyse des Einflusses der Wirbelstromdämpfung auf die Schwingungsamplitude bei verschiedenen Stromstärken, und 3. Untersuchung der Frequenzabhängigkeit der erzwungenen Schwingung unter verschiedenen Dämpfungsbedingungen. Zusätzlich wurde ein mathematischer Beweis für die Resonanzfrequenz und Maximalamplitude gefordert.
Welche Messinstrumente wurden verwendet?
Verwendet wurden ein Pohl'sches Rad, Netzgeräte, Amperemeter, ein Digitalmultimeter, ein Trennstelltrafo und ein Experimentiertrafo. Die Toleranzen der Messgeräte wurden berücksichtigt, um die Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten.
Welche physikalischen Grundlagen werden behandelt?
Das Protokoll behandelt die physikalischen Grundlagen freier und erzwungener, ungedämpfter und gedämpfter Schwingungen. Die entsprechenden Differentialgleichungen werden vorgestellt, und die verschiedenen Fälle der gedämpften Schwingung (schwache Dämpfung, starke Dämpfung, aperiodischer Grenzfall) werden diskutiert.
Wie ist das Protokoll aufgebaut?
Das Protokoll beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung des Versuchsaufbaus und der Aufgabenstellung, eine Auflistung der verwendeten Messinstrumente, die Erläuterung der physikalischen Grundlagen, die Präsentation der Messergebnisse (aufgeteilt nach den drei Hauptaufgaben), die Auswertung der Ergebnisse, eine Fehlerrechnung, einen mathematischen Beweis (Aufgabe 4) und eine Schlussbetrachtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Protokolls?
Schlüsselwörter sind: Erzwungene Schwingungen, Torsionsschwinger, Pohl'sches Rad, Eigenfrequenz, Wirbelstromdämpfung, Resonanzfrequenz, Maximalamplitude, Dämpfungskonstante, Frequenzabhängigkeit, Amplitudenmessung.
Was ist das Ziel des Experiments?
Das Ziel des Experiments ist es, die Eigenfrequenz des Systems zu bestimmen, den Einfluss der Wirbelstromdämpfung auf die Schwingungsamplitude zu analysieren und die Frequenzabhängigkeit der erzwungenen Schwingung zu untersuchen. Die mathematische Beschreibung der Resonanzfrequenz und Maximalamplitude soll ebenfalls behandelt werden.
Wie wird der Versuchsaufbau beschrieben?
Der Versuchsaufbau besteht aus einem Torsionsschwinger (Pohl'sches Rad), der aus einem Kupferring, einer Spiralfeder und einem Hebel besteht, welcher von einem Elektromotor angetrieben wird. Der Motor erzeugt periodische Schwingungen, die auf den Kupferring übertragen werden. Die Amplitude der Schwingung wird mit einem Zeiger an einer Skala abgelesen.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. (FH) Tobias Purschke (Author), B. Höber (Author), 2003, Praktikum Physik: Erzwungene Schwingungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21365