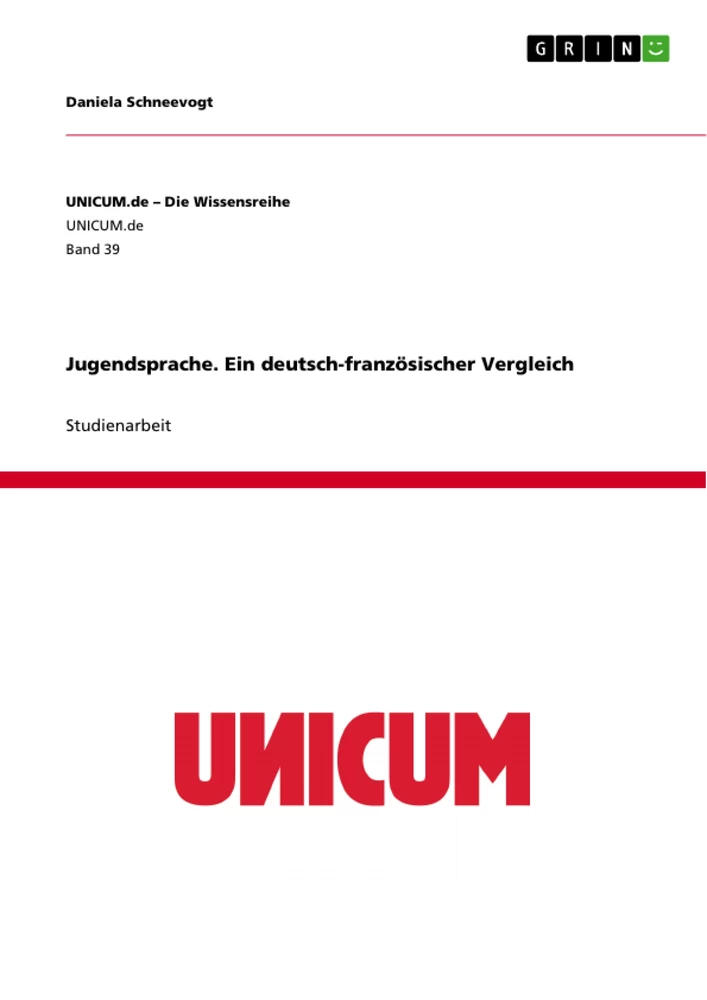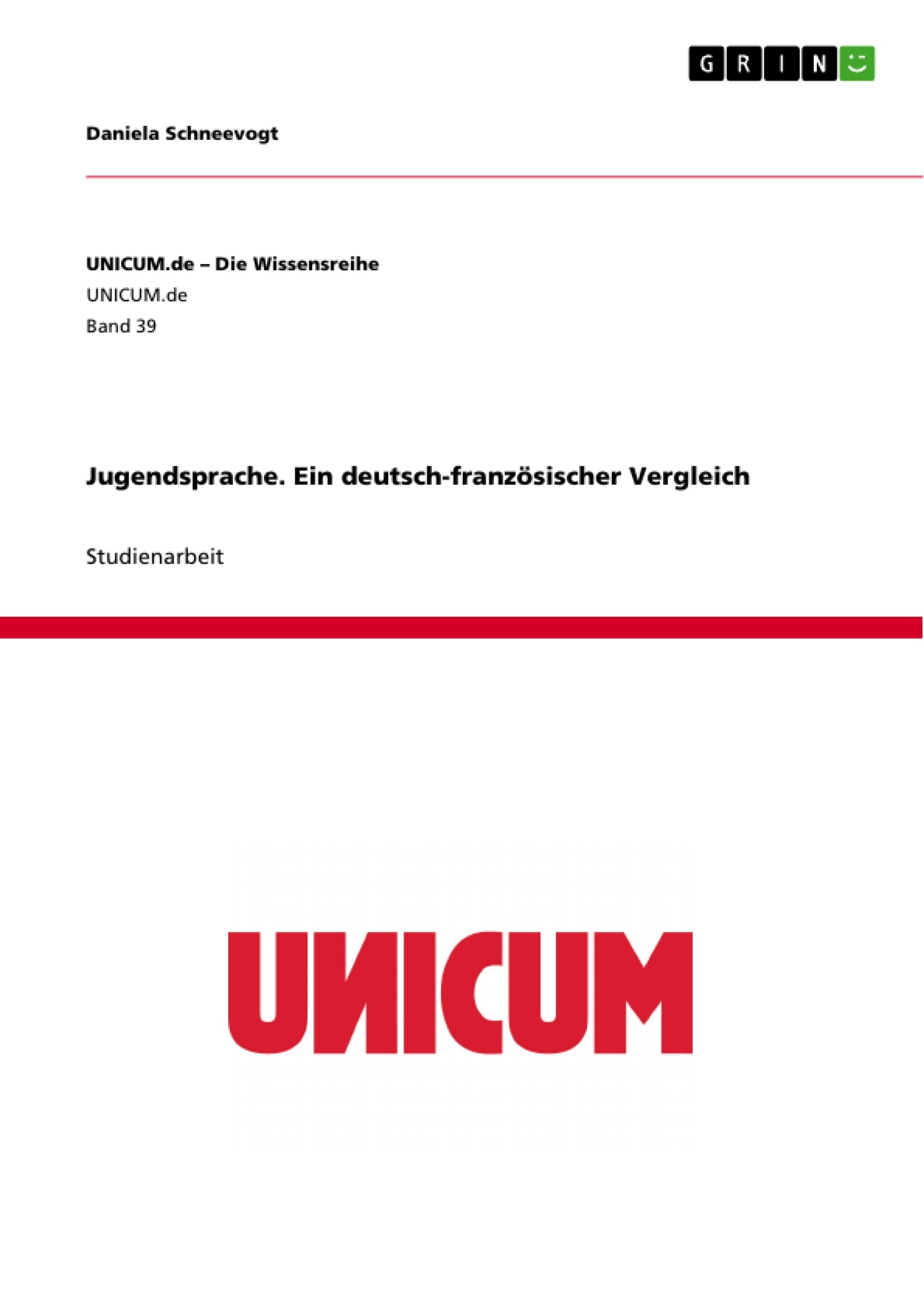Seit Beginn der 80er Jahre steigt die Zahl der Studien zum Thema Jugendsprachforschung international stetig an. Es stellt sich nunmehr die Frage, was genau die Begriffe youngspeak, Jugendsprache, langue des jeunes etc. eigentlich beschreiben, welche Funktionen der Gebrauch von Jugendsprache hat und ob sie bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterzuordnen ist. Um dies beantworten zu können, wird in der folgenden Arbeit ein deutsch-französischer Vergleich aufgestellt, der Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzeigen soll, aber auch den soziokulturellen Kontext sowie das Thema Integration berücksichtigt. Zunächst werden jedoch für das Verständnis wichtige Definitionen und weitere Informationen gegeben, um anschließend auf die Besonderheiten der Jugendsprache beider Nationen einzugehen sowie die sprachpolitischen Ansätze beider Staaten wiederzugeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Allgemeines zur Jugendsprache
- 2.1 Begriffe
- 2.2 Merkmale
- 2.3 Funktionen
- 3 Jugendsprache in Deutschland
- 3.1 Spezifisches
- 3.2 Sprachpolitisches
- 4 Jugendsprache in Frankreich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Jugendsprache im deutsch-französischen Vergleich. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und den soziokulturellen Kontext sowie die Integration zu berücksichtigen. Die Arbeit beleuchtet Definitionen und Merkmale der Jugendsprache, um anschließend die Besonderheiten in beiden Ländern und die jeweiligen sprachpolitischen Ansätze zu analysieren.
- Definition und Merkmale der Jugendsprache
- Spezifische Merkmale der Jugendsprache in Deutschland
- Spezifische Merkmale der Jugendsprache in Frankreich
- Sprachpolitische Ansätze in Deutschland und Frankreich
- Soziokultureller Kontext und Integration
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Jugendsprachforschung ein und beschreibt die steigende Anzahl an Studien seit den 1980er Jahren. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Begriffen, Funktionen und Gesetzmäßigkeiten von Jugendsprache und kündigt einen deutsch-französischen Vergleich an, der Unterschiede und Gemeinsamkeiten, den soziokulturellen Kontext und die Integration berücksichtigen soll. Die Einleitung dient als Grundlage für die nachfolgenden Kapitel, die Definitionen liefern und die Besonderheiten der Jugendsprache in beiden Ländern erläutern sowie die sprachpolitischen Ansätze präsentieren.
2 Allgemeines zur Jugendsprache: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der Jugendsprachforschung, die sich aus der mündlichen Natur der Äußerungen und den hohen Kosten von Studien zur mündlichen Sprachverwendung ergeben. Die internationale Relevanz des Themas wird betont, ebenso wie die unterschiedlichen Perspektiven und Begriffsdefinitionen, die im weiteren Verlauf des Kapitels behandelt werden. Es wird deutlich, dass die Jugendsprache ein komplexes und vielschichtiges Phänomen ist, das sich nicht auf eine einheitliche Definition reduzieren lässt, sondern vielmehr gruppenspezifische Kommunikationsweisen und Sprachstile umfasst.
2.1 Begriffe: Der Abschnitt beschreibt die verschiedenen Begriffe, die in der Literatur zur Beschreibung des Phänomens Jugendsprache verwendet werden, von allgemeinen Begriffen wie "Sondersprache" und "Slang" bis hin zu Begriffen, die auch phonologische und morphosyntaktische Aspekte berücksichtigen, wie "Varietät" oder "Generationssoziolekt". Es wird betont, dass es sich nicht um "die eine Jugendsprache" handelt, sondern um gruppenspezifische Kommunikationsweisen, die von soziokulturellen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildungsniveau und sozialer Herkunft beeinflusst sind. Dieser Abschnitt legt den Grundstein für ein differenziertes Verständnis der Komplexität des Themas.
2.2 Merkmale: Hier werden allgemeine Merkmale der Jugendsprache weltweit vorgestellt. Es werden typische Merkmale wie Gesprächspartikeln, Vagheitsformeln, Intensivierungspartikeln, Tabuwörter und Nonstandardvarianten genannt. Weiterhin wird auf den spezifischen Wortschatz für jugendspezifische Lebensformen, Interessen und soziale Kategorien eingegangen, sowie auf Zitate aus Film, Fernsehen und Musik. Der Anteil an Fremdsprachenentlehnungen, insbesondere Anglizismen, wird ebenfalls hervorgehoben. Dieser Abschnitt liefert eine umfassende Beschreibung der sprachlichen Eigenschaften, die Jugendsprache charakterisieren.
2.3 Funktionen: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Funktionen von Jugendsprache. Es wird betont, dass Jugendsprache als gruppenspezifischer Code dient, der Abgrenzung und gleichzeitig Gruppenidentität schafft. Sie repräsentiert die Konfrontation mit der Erwachsenenwelt und dient der Selbst- und Fremddarstellung sowie der Identitätsbildung. Kreativität, Spontanität und Flexibilität werden als kennzeichnend für die jugendliche Kommunikation beschrieben, die dem Erproben sozialer und diskursiver Kompetenz dient. Der Abschnitt verdeutlicht die soziale und identitätsstiftende Rolle der Jugendsprache.
3 Jugendsprache in Deutschland: Dieses Kapitel befasst sich mit den sprachlichen Besonderheiten der deutschen Jugendsprache, die sowohl Gemeinsamkeiten mit anderen Ländern als auch spezifische Eigenheiten aufweisen. Es werden allgemeine Merkmale wie Reduktion, Assimilation, Klitisierung, Neubildungen, Umdeutungen und Anglizismen erwähnt, aber auch spezifisch deutsche Phänomene wie die parataktische Syntax von "weil", die Dativrektion bestimmter Präpositionen und der Nominativ-Akkusativ-Zusammenfall. Der Abschnitt analysiert auch die Frage, ob diese Merkmale tatsächlich typisch für die Jugendsprache sind oder ob es sich eher um generationenspezifische Anwendungsformen handelt.
3.1 Spezifisches: Dieser Abschnitt beleuchtet spezifische Merkmale des deutschen Jugendsprachgebrauchs, die von allen Sprechern leicht erkennbar sind, wie z.B. die parataktische Syntax, die Dativrektion, der Nominativ-Akkusativ-Zusammenfall, die Tilgung von Endkonsonanten und der unflektierte Negationsartikel. Er diskutiert auch die Wortbildung mit "mäßig" und die Tendenz, dass viele dieser Merkmale im Laufe der Zeit in die Umgangssprache der Erwachsenen übergehen. Die Frage nach der tatsächlichen Typizität dieser Merkmale für die Jugendsprache wird diskutiert.
3.2 Sprachpolitisches: Der Abschnitt behandelt den Sprachwandel in Deutschland und den zunehmenden Einfluss anderer Sprachen, insbesondere im Hinblick auf die Übernahme von Begriffen. Der Text erwähnt die Debatte um "falsche" Sprachverwendung in der Jugendsprache, womit der Fokus auf die sprachpolitischen Implikationen dieser sprachlichen Entwicklungen gelegt wird.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, deutsch-französischer Vergleich, Sprachwandel, Soziolinguistik, Identität, Gruppensprache, Anglizismen, Sprachpolitik, Integration, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Deutsch-Französischer Vergleich der Jugendsprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Jugendsprache im deutsch-französischen Vergleich. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und den soziokulturellen Kontext sowie die Integration zu berücksichtigen. Die Arbeit beleuchtet Definitionen und Merkmale der Jugendsprache, um anschließend die Besonderheiten in beiden Ländern und die jeweiligen sprachpolitischen Ansätze zu analysieren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Merkmale der Jugendsprache; spezifische Merkmale der Jugendsprache in Deutschland und Frankreich; sprachpolitische Ansätze in Deutschland und Frankreich; soziokultureller Kontext und Integration der Jugendsprache.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung; 2. Allgemeines zur Jugendsprache (mit Unterkapiteln zu Begriffen, Merkmalen und Funktionen); 3. Jugendsprache in Deutschland (mit Unterkapiteln zu spezifischen Merkmalen und sprachpolitischen Aspekten); 4. Jugendsprache in Frankreich.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik der Jugendsprachforschung ein, beschreibt den Anstieg an Studien seit den 1980er Jahren und formuliert die Forschungsfrage nach Begriffen, Funktionen und Gesetzmäßigkeiten der Jugendsprache. Sie kündigt einen deutsch-französischen Vergleich an, der Unterschiede und Gemeinsamkeiten, den soziokulturellen Kontext und die Integration berücksichtigen soll.
Was wird im Kapitel "Allgemeines zur Jugendsprache" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der Jugendsprachforschung (mündliche Natur der Äußerungen, Kosten von Studien), die internationale Relevanz und unterschiedliche Perspektiven und Begriffsdefinitionen. Es wird deutlich, dass Jugendsprache ein komplexes Phänomen ist, das sich nicht auf eine einheitliche Definition reduzieren lässt.
Was wird in den Unterkapiteln von Kapitel 2 behandelt?
Kapitel 2.1 ("Begriffe") beschreibt verschiedene Begriffe zur Beschreibung von Jugendsprache (Sondersprache, Slang, Varietät, Generationssoziolekt) und betont die gruppenspezifische Natur der Jugendsprache. Kapitel 2.2 ("Merkmale") präsentiert allgemeine Merkmale wie Gesprächspartikeln, Vagheitsformeln, Intensivierungspartikeln, Tabuwörter, Nonstandardvarianten, Fremdsprachenentlehnungen und Zitate aus Medien. Kapitel 2.3 ("Funktionen") konzentriert sich auf die Funktionen von Jugendsprache als gruppenspezifischer Code, Abgrenzung, Gruppenidentität, Konfrontation mit der Erwachsenenwelt, Selbst- und Fremddarstellung und Identitätsbildung.
Was wird im Kapitel "Jugendsprache in Deutschland" behandelt?
Dieses Kapitel behandelt sprachliche Besonderheiten der deutschen Jugendsprache, Gemeinsamkeiten mit anderen Ländern und spezifische Eigenheiten (Reduktion, Assimilation, Klitisierung, Neubildungen, Umdeutungen, Anglizismen, parataktische Syntax, Dativrektion, Nominativ-Akkusativ-Zusammenfall).
Was wird in den Unterkapiteln von Kapitel 3 behandelt?
Kapitel 3.1 ("Spezifisches") beleuchtet leicht erkennbare Merkmale des deutschen Jugendsprachgebrauchs (parataktische Syntax, Dativrektion, Nominativ-Akkusativ-Zusammenfall, Tilgung von Endkonsonanten, unflektierter Negationsartikel, Wortbildung mit "mäßig") und deren Übergang in die Umgangssprache. Kapitel 3.2 ("Sprachpolitisches") behandelt den Sprachwandel in Deutschland, den Einfluss anderer Sprachen und die Debatte um "falsche" Sprachverwendung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Jugendsprache, deutsch-französischer Vergleich, Sprachwandel, Soziolinguistik, Identität, Gruppensprache, Anglizismen, Sprachpolitik, Integration, Kommunikation.
- Quote paper
- Daniela Schneevogt (Author), 2012, Jugendsprache. Ein deutsch-französischer Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213582