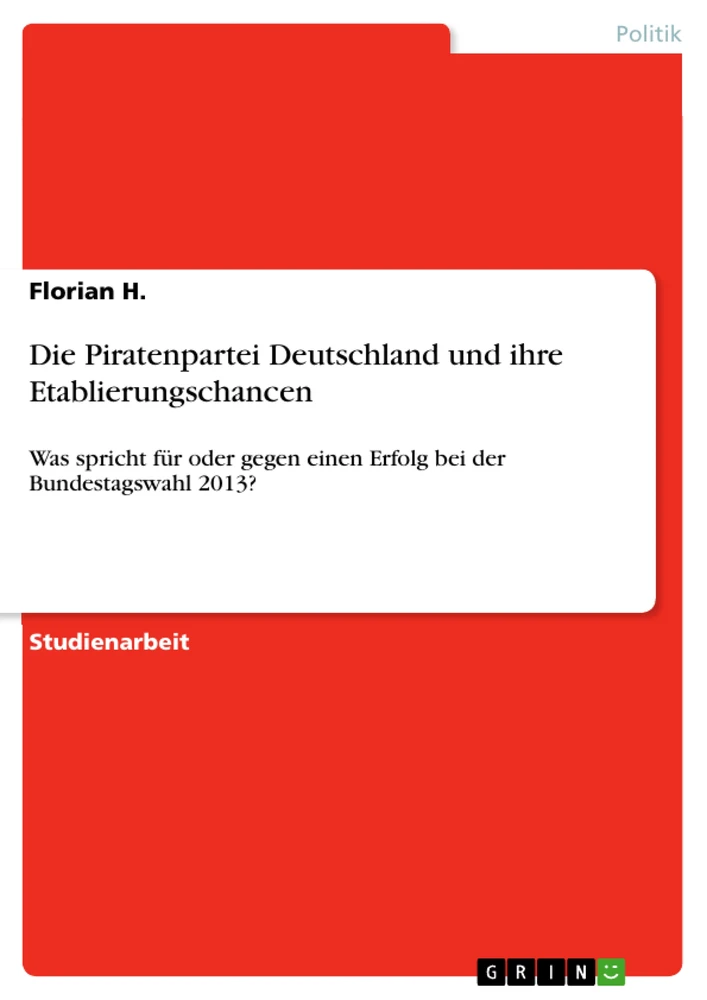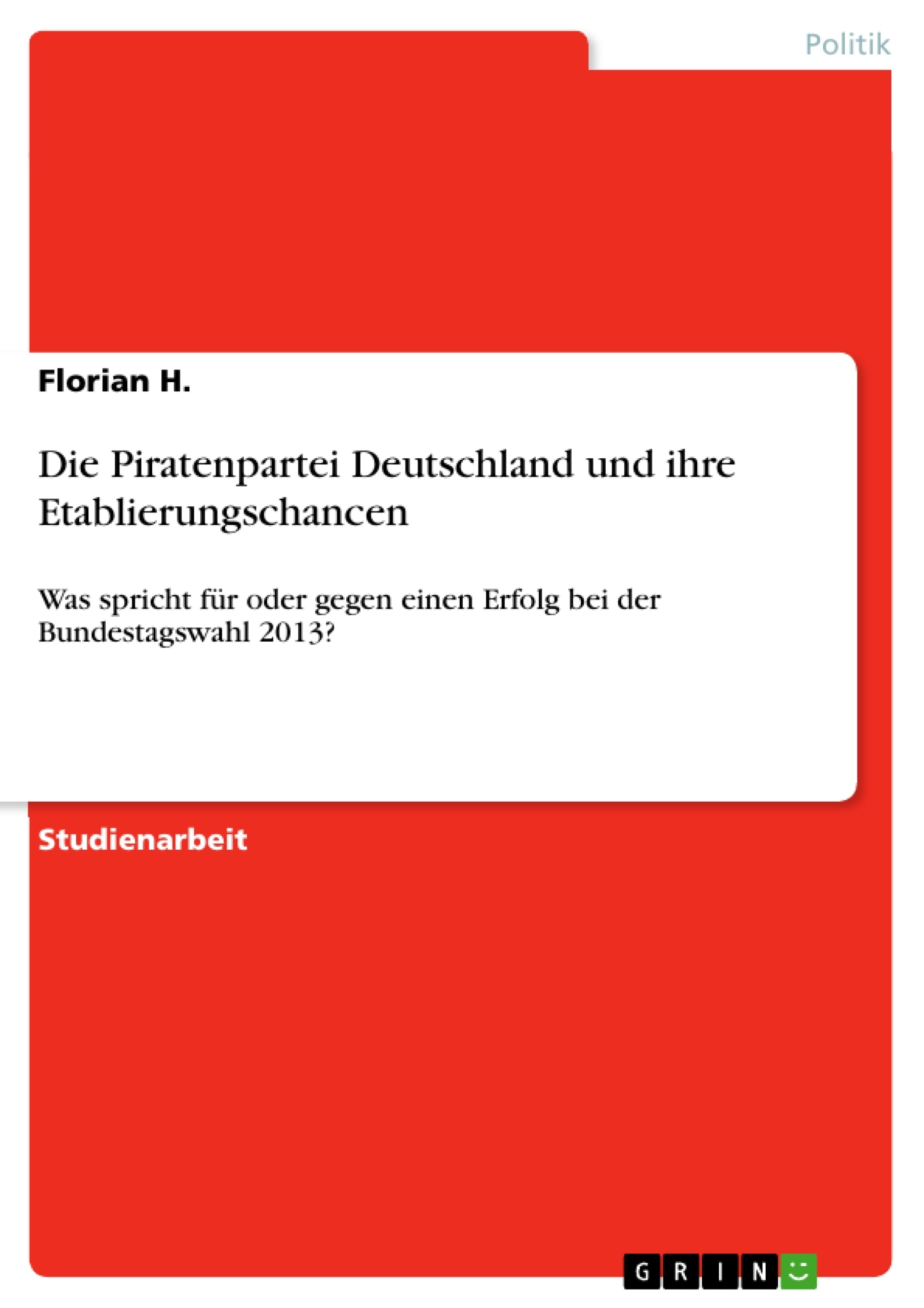Die 2006 gegründete Piratenpartei Deutschland (nachfolgend auch PIRATEN (offizielles Parteikürzel (PIRATEN 2006))) hat in den vergangenen Jahren beachtliche Erfolge erreicht, durch die sie immer mehr in den medialen und auch wissenschaftlichen Fokus rückt. Es stellt sich die Frage, ob diese junge Partei nur eine weitere unbedeutende Kleinpartei ist, die unter die Kategorie „Sonstige“ fällt, oder ob es sich um eine Partei handelt, die sich eine große Wählerbasis aufbauen und damit nachhaltig erfolgreiche Politik im deutschen Parteiensystem betreiben kann.
In der folgenden Hausarbeit soll der Frage nachgegangen werden, welche Aspekte dafür oder dagegen sprechen, dass sich die Piratenpartei im deutschen Parteiensystem etablieren kann. Dabei soll ein besonderer Fokus auf die im September dieses Jahres stattfindende Bundestagswahl gerichtet werden. Die Vorgehensweise in dieser Hausarbeit ist zu einem Teil empirisch-analytisch, zu einem anderen Teil historisch-genetische, indem ein Vergleich mit den Grünen gezogen wird.
Um die Erfolgswahrscheinlichkeit der Piratenpartei zu messen, werden zunächst zwei allgemeine Theorien vorgestellt, die Anhaltspunkte für einen Erfolg neuer Parteien liefern können. Bei der ersten Theorie handelt es sich um die in der Politikwissenschaft weit verbreitete und anerkannte „Cleavage-Theorie“ von Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan, die erklären kann, wieso es zur Entstehung neuer Parteien auf Grund gesellschaftlicher Konfliktlinien kommen kann. Diese Theorie ist deshalb bei der Frage nach den Erfolgsaussichten der Piratenpartei relevant, da das Vorhandensein eines neuen gesellschaftlichen Konflikts als wichtige Bedingung dafür gilt, dass sich die Piratenpartei dauerhaft etablieren kann (Neumann 2011, 10, vgl. auch Onken/Schneider 2012, 612). Außerdem zeigen Beispiele aus der Vergangenheit, dass Parteien nur so lange erfolgreich sein können, wie es ein Cleavage gibt, das für eine breite Wählerschaft sorgt. Wird ein gesellschaftlicher Konflikt gelöst, kann es vorkommen, dass Parteien politisch irrelevant werden (Onken/Schneider 2012, 612).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie
- 2.1. Cleavage-Theorie - Wie neue Parteien entstehen
- 2.2. Lifespan-Modell - Einordnung von Parteien auf Karrierestufen
- 3. Analyse
- 3.1. Steht die Piratenpartei für ein neues Cleavage?
- 3.2. Auf welcher Karrierestufe befindet sich die Piratenpartei?
- 3.3. Analyse der aktuellen Situation anhand von Statistiken und Umfragen
- 4. Fazit Was spricht für oder gegen einen Erfolg bei der Bundestagswahl 2013?
- 5. Auswertung der Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Etablierungschancen der Piratenpartei Deutschland im deutschen Parteiensystem, insbesondere im Hinblick auf die Bundestagswahl 2013. Es wird analysiert, welche Faktoren für oder gegen einen dauerhaften Erfolg sprechen. Der Fokus liegt auf der Anwendung etablierter politikwissenschaftlicher Theorien auf den Fall der Piratenpartei.
- Anwendung der Cleavage-Theorie auf die Piratenpartei
- Einordnung der Piratenpartei anhand des Lifespan-Modells
- Analyse der aktuellen politischen und soziologischen Situation der Partei
- Bewertung der Erfolgsaussichten der Piratenpartei bei der Bundestagswahl 2013
- Vergleich mit anderen Parteien und historischen Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Etablierungschancen der Piratenpartei in Deutschland vor dem Hintergrund der Bundestagswahl 2013. Sie skizziert die Vorgehensweise der Arbeit, die sowohl empirisch-analytische als auch historisch-genetische Elemente umfasst, unter anderem durch den Vergleich mit den Grünen. Die begrenzte Verfügbarkeit von Forschungsmaterial aufgrund des jungen Alters der Partei wird angesprochen.
2. Theorie: Dieses Kapitel präsentiert zwei politikwissenschaftliche Theorien, die zur Analyse der Erfolgsaussichten neuer Parteien dienen: die Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan und das Lifespan-Modell von Pedersen, erweitert durch Niedermeyer. Die Cleavage-Theorie wird in ihren verschiedenen Ausprägungen erläutert, einschließlich der Kritik an ihrer Anwendbarkeit auf heutige Gesellschaften und der Weiterentwicklung durch Neumann und Mielke. Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die anschließende Analyse der Piratenpartei.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Etablierungschancen der Piratenpartei
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Etablierungschancen der Piratenpartei Deutschland im deutschen Parteiensystem, insbesondere im Hinblick auf die Bundestagswahl 2013. Es wird analysiert, welche Faktoren für oder gegen einen dauerhaften Erfolg sprechen.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit verwendet zwei politikwissenschaftliche Theorien: die Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan und das Lifespan-Modell von Pedersen (erweitert durch Niedermeyer). Die Cleavage-Theorie wird in ihren verschiedenen Ausprägungen erläutert, inklusive Kritikpunkte und Weiterentwicklungen. Diese Theorien dienen der Analyse der Erfolgsaussichten neuer Parteien.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit besteht aus fünf Kapiteln: einer Einleitung, einem Theoriekapitel, einem Analysekapitel, einem Fazit und einer Auswertung der Analyse. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage vor und skizziert die Vorgehensweise. Das Theoriekapitel erläutert die verwendeten Theorien. Das Analysekapitel wendet diese Theorien auf die Piratenpartei an, indem es deren mögliche Etablierung als neues Cleavage und ihre Position im Lifespan-Modell untersucht. Das Fazit bewertet die Erfolgsaussichten der Partei bei der Bundestagswahl 2013. Die Auswertung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Aspekte der Piratenpartei werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf folgende Punkte: ob die Piratenpartei ein neues Cleavage repräsentiert, ihre Position auf der Karrierestufe nach dem Lifespan-Modell, die aktuelle politische und soziologische Situation der Partei und deren Erfolgsaussichten bei der Bundestagswahl 2013. Vergleiche mit anderen Parteien und historischen Entwicklungen werden ebenfalls gezogen.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit verwendet empirisch-analytische und historisch-genetische Elemente. Die begrenzte Verfügbarkeit von Forschungsmaterial aufgrund des jungen Alters der Partei wird in der Arbeit thematisiert. Statistiken und Umfragen werden zur Analyse der aktuellen Situation herangezogen.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Faktoren sprechen für oder gegen die dauerhafte Etablierung der Piratenpartei im deutschen Parteiensystem im Hinblick auf die Bundestagswahl 2013? Die Arbeit untersucht dies anhand der Anwendung politikwissenschaftlicher Theorien auf den Fall der Piratenpartei.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beinhaltet eine detaillierte Beschreibung des Inhalts jedes Kapitels, beginnend mit der Einleitung, die die Forschungsfrage und Vorgehensweise beschreibt. Das Theoriekapitel wird als Einführung in die Cleavage-Theorie und das Lifespan-Modell dargestellt. Die Zusammenfassung der Analyse beschreibt die Anwendung der Theorien auf die Piratenpartei. Schließlich werden die Schlussfolgerungen und die Auswertung der Ergebnisse zusammengefasst.
- Quote paper
- Florian H. (Author), 2013, Die Piratenpartei Deutschland und ihre Etablierungschancen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213571