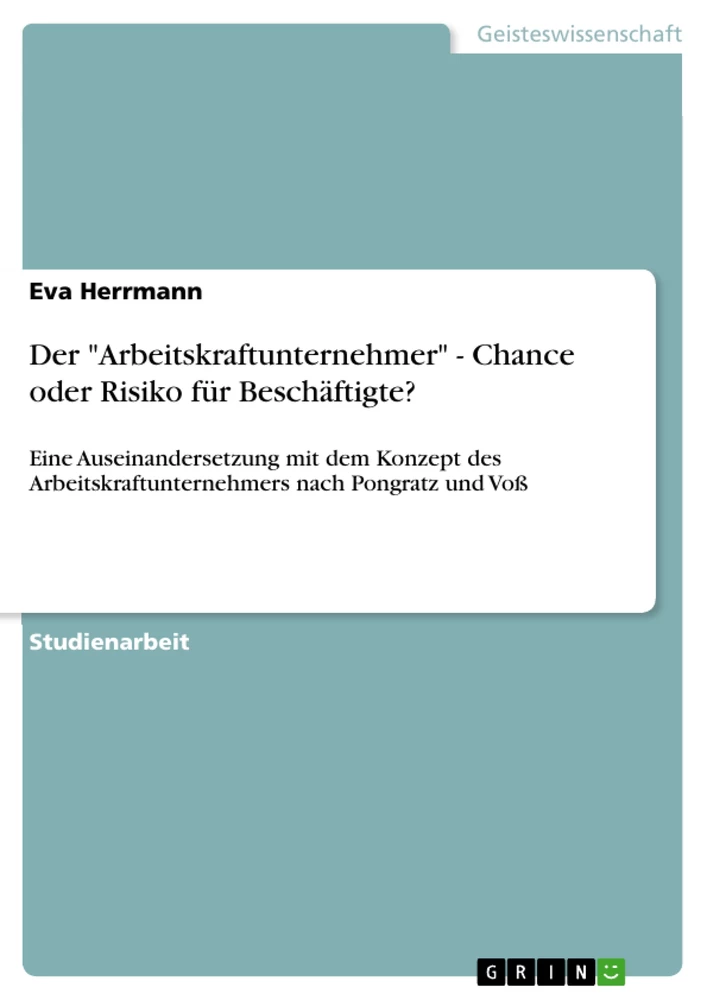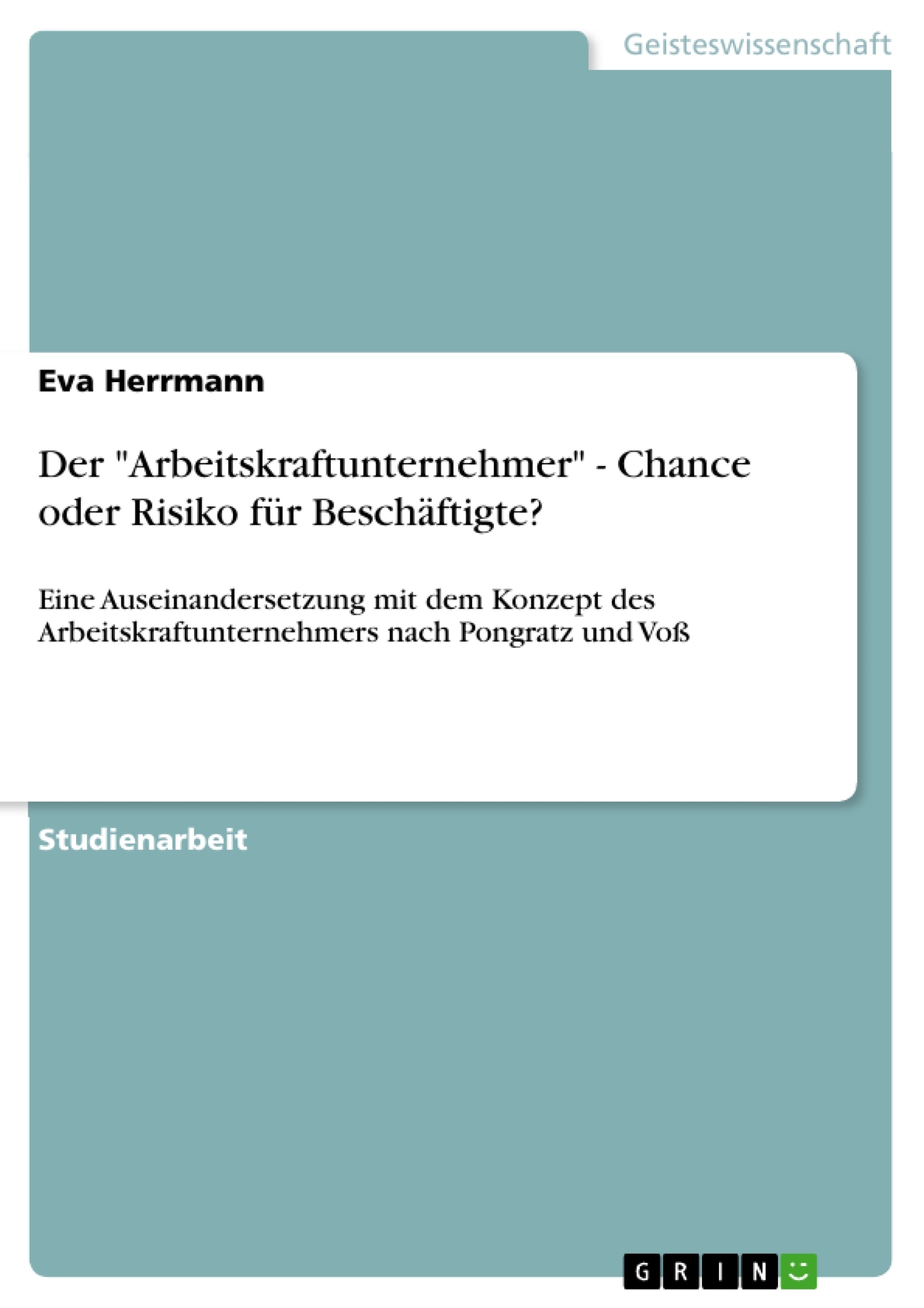Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung..............................................................3
2. Der historische Wandel von Arbeitskraft – Die drei Typen von
Arbeitskraft nach Pongratz und Voß......................................4
2.1 Der proletarisierte Lohnarbeiter zu Zeiten der
Frühindustrialisierung..............................................5
2.2 Der verberuflichte Arbeitnehmer im Fordismus........................5
2.3 Der Wandel vom verberuflichten Arbeitnehmer zum
verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmer...........................7
3. Der verbetrieblichte Arbeitskraftunternehmer als neuer Typus von
Arbeitskraft im Postfordismus...........................................9
3.1 Der Arbeitskraftunternehmer und seine drei idealtypischen
Kennzeichen .........................................................9
3.2 Die Verortung des Arbeitskraftunternehmers auf dem
Arbeitsmarkt........................................................12
4. Der Arbeitskraftunternehmer – Chance oder Risiko für Beschäftigte?......14
5. Schlussteil.............................................................16
6. Literaturverzeichnis....................................................18
6.1 Verwendete Primärliteratur........................................18
6.2 Verwendete Sekundärliteratur......................................18
6.3 Verwendete Internetquellen........................................18
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der historische Wandel von Arbeitskraft— Die drei Typen von Arbeitskraft nach Pongratz und Voß
- 2.1 Der proletarisierte Lohnarbeiter zu Zeiten der Frühindustrialisierung
- 2.2 Der verberuflichte Arbeitnehmer im Fordismus
- 2.3 Der Wandel vom verberuflichten Arbeitnehmer zum verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmer
- 3. Der verbetrieblichte Arbeitskraftunternehmer als neuer Typus von Arbeitskraft im Postfordismus
- 3.1 Der Arbeitskraftunternehmer und seine drei idealtypischen Kennzeichen
- 3.2 Die Verortung des Arbeitskraftunternehmers auf dem Arbeitsmarkt
- 4. Der Arbeitskraftunternehmer —Chance oder Risiko für Beschäftigte?
- 5. Schlussteil
- 6. Literaturverzeichnis
- 6.1 Verwendete Primärliteratur
- 6.2 Verwendete Sekundärliteratur
- 6.3 Verwendete Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept des Arbeitskraftunternehmers, einem neuartigen Typus von Arbeitskraft, der von den Soziologen Hans J. Pongratz und G. Günter Voß im Kontext des Wandels von Arbeit und Beschäftigungsverhältnissen im Postfordismus eingeführt wurde. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung von Arbeitskrafttypen, wobei der Fokus auf den Wandel vom verberuflichten Arbeitnehmer zum verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmer liegt. Die Arbeit untersucht die charakteristischen Merkmale des Arbeitskraftunternehmers und seine Verortung auf dem Arbeitsmarkt. Schließlich wird die Frage diskutiert, ob der Arbeitskraftunternehmer eine Chance oder ein Risiko für Beschäftigte darstellt.
- Historischer Wandel von Arbeitskrafttypen
- Merkmale des Arbeitskraftunternehmers
- Verortung des Arbeitskraftunternehmers auf dem Arbeitsmarkt
- Chancen und Risiken des Arbeitskraftunternehmers für Beschäftigte
- Ambivalenz der Folgen des Arbeitskraftunternehmers
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in die Thematik des Wandels von Arbeit und Beschäftigungsverhältnissen im Postfordismus ein. Es wird die Bedeutung der Begriffe „Entgrenzung von Arbeit und Leben“ und „Subjektivierung von Arbeit“ erläutert und der Zusammenhang mit dem Konzept des Arbeitskraftunternehmers hergestellt.
Das zweite Kapitel analysiert den historischen Wandel von Arbeitskrafttypen anhand der drei von Pongratz und Voß beschriebenen Idealtypen: den proletarisierten Lohnarbeiter zu Zeiten der Frühindustrialisierung, den verberuflichten Arbeitnehmer im Fordismus und den verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmer im Postfordismus. Es werden die charakteristischen Merkmale jedes Typs sowie die jeweiligen historischen Bedingungen und Entwicklungen beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Konzept des verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmers. Es werden die drei idealtypischen Kennzeichen des Arbeitskraftunternehmers – Selbst-Kontrolle, Selbst-Ökonomisierung und Selbst-Rationalisierung – erläutert und anhand von idealtypischen Thesen von Pongratz und Voß veranschaulicht. Weiterhin wird die Verortung des Arbeitskraftunternehmers auf dem Arbeitsmarkt betrachtet, wobei die Branchen und Berufsgruppen hervorgehoben werden, in denen er bereits empirisch zu beobachten ist.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Chancen und Risiken, die der Arbeitskraftunternehmer für Beschäftigte mit sich bringt. Es werden die ambivalenten Folgen des Wandels vom Arbeitnehmer zum verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmer diskutiert, wobei die Bedeutung von Schlüsselqualifikationen und die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Wandel von Arbeitskraft, den Arbeitskraftunternehmer, die Subjektivierung von Arbeit, den Postfordismus, die Entgrenzung von Arbeit und Leben, die Selbst-Kontrolle, Selbst-Ökonomisierung und Selbst-Rationalisierung, die Chancen und Risiken für Beschäftigte und die Ambivalenz der Folgen des Arbeitskraftunternehmers. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Arbeitskraftunternehmers als neuen Typus von Arbeitskraft, seine Verortung auf dem Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Herausforderungen für Beschäftigte.
- Quote paper
- Eva Herrmann (Author), 2013, Der "Arbeitskraftunternehmer" - Chance oder Risiko für Beschäftigte? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213484