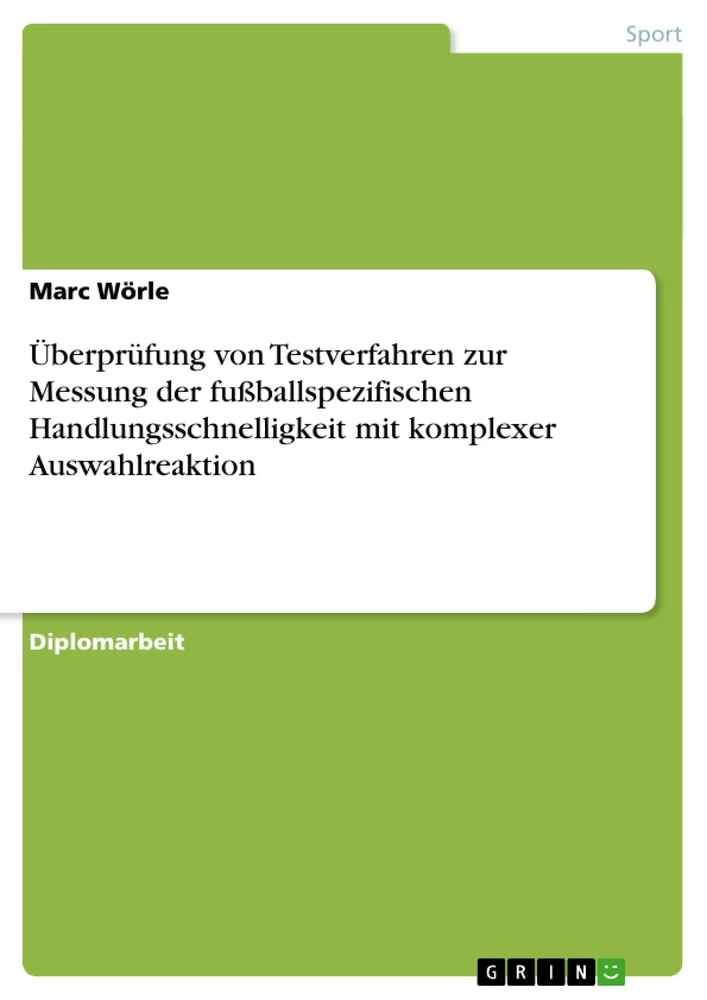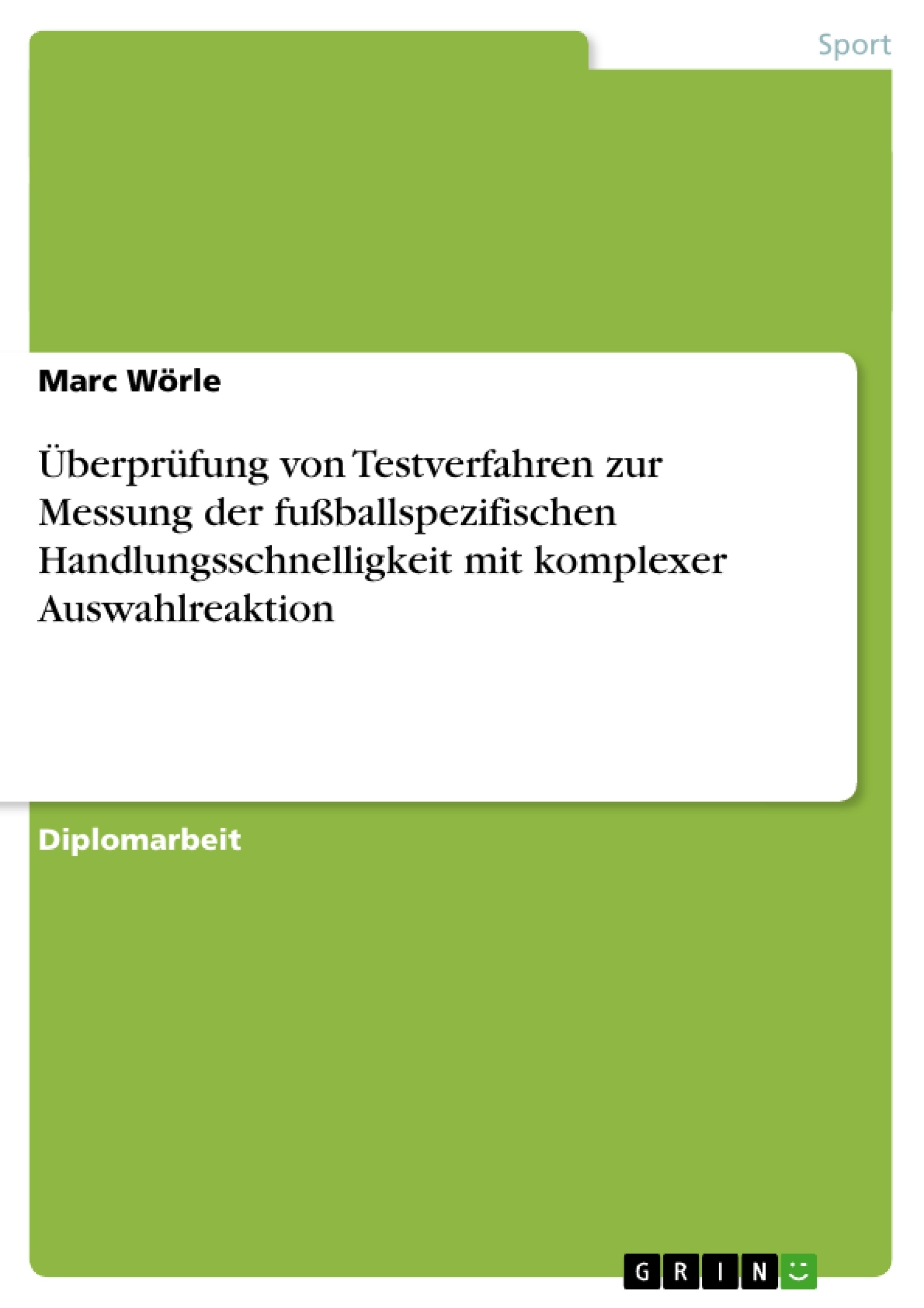Moderner Fußball zeichnet sich durch deutliche Fortschritte hinsichtlich Athletik, Dynamik und Tempoausprägung aus. Die Schnelligkeit hat unter den konditionellen Leistungsvoraussetzungen im Fußball die größte Bedeutung und stellt einen leistungslimitierenden Faktor dar. Untermauert wird dies dadurch, dass die Schnelligkeit weniger trainierbar als die Kraft oder
die Ausdauer ist. Schuld daran ist die genetisch festgelegte Verteilung der verschiedenen Fasertypen im Muskel. Gleichzeitig ist die Schnelligkeit am wenigsten untersucht und unter Experten am kontroversesten diskutiert. Das mag daran liegen, dass Schnelligkeit eine außergewöhnlich komplexe Erscheinung darstellt, die im Fußball nicht nur die reine Sprintschnelligkeit, sondern
auch das möglichst schnelle Reagieren und Handeln auf einen spieltypischen Reiz, die Beschleunigungsfähigkeit und das Erkennen der jeweiligen Spielsituation umfasst. Ein Schnelligkeitstraining muss sich an diesen Teilkomponenten orientieren. Eine rein läuferische Ausbildung wird den komplexen Anforderungen des Fuballs nicht gerecht (Schlumberger, 2010).
Schnelligkeit resultiert aus der Leistungsfähigkeit von Nervenleitprozessen und steht somit in direktem Zusammenhang mit Steuerungs- und Regelungsmechanismen. Sie wiederum bilden ein Merkmal koordinativer Fähigkeiten. Koordinative Aspekte (das Nerv-Muskel-Zusammenspiel legt fest, wie schnell die Muskeln aktiviert werden können) spielen somit eine wichtige Rolle. Die Schnelligkeit wird daher heute nicht mehr nur als reine konditionelle Fähigkeit, sondern als koordinativ-konditionelle Fähigkeit gesehen. Neben koordinativen Aspekten ist auch das Maximalkraft- bzw. Schnellkraftniveau von Bedeutung. Schnelligkeit kann als koordinatives
Resultat mit den konditionellen Grundlagen der Kraft und der Ausdauer bezeichnet werden. Ein entscheidender Faktor für die Schnelligkeit ist die Zusammensetzung der Muskeln aus verschiedenen Muskelfasern. Sie weisen Unterschiede hinsichtlich der Kontraktionsgeschwindigkeiten sowie der Ermüdungsresistenz auf. Durch taktische Veränderungen (schnelles Umschalten nach Ballgewinn, schnelle Spielverlagerungen)in den letzten Jahren hat sich auch das physische Anforderungsprofil im Fußball verändert. Es besteht primär aus explosiven schnellen und schnellkräftigen Aktionen wie Sprints, Sprüngen, Richtungswechseln, Torschüssen und Zweikampfsituationen. Diese werden
als dominierende Aktionen bezeichnet, da sie wesentlich zum Spielerfolg beitragen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Allgemein
1.2 Zielsetzung/Problemstellung der Arbeit
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Sportartanalyse im Fußball
2.1.1 Anforderungsprofil
2.1.2 Belastungsprofil
2.1.3 Leistungsstrukturmodell
2.2 Schnelligkeit und deren Bedeutung im Fußball
2.2.1 Motorische Schnelligkeit
2.2.2 Informatorische Schnelligkeit
2.3 Schnelligkeitsdiagnostik
2.4 Handlungsschnelligkeit
2.5 Zwischenfazit
3 Untersuchungsmethodik und Versuchsdurchfuhrung
3.1 Merkmalsstichprobe und Forschungsmethode
3.1.1 Azyklischer Sprint- und Dribblingtest mit Lichtschranken
3.1.2 Passtest auf Lichtsignale
3.2 Personenstichprobe
3.3 Datenverarbeitung
3.4 Versuchsdurchführung
4 Darstellung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse
4.1 Objektivität/Reliabilität der Handlungsschnelligkeitstests
4.1.1 Gesamtgruppe
4.1.2 Untergruppen
4.2 Statistische Kennzahlen und Validität der Handlungsschnelligkeitstests
4.2.1 Gesamtgruppe
4.2.2 Untergruppen
5 Diskussion
5.1 Methodendiskussion
5.2 Ergebnisdiskussion
6 Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Grafische Darstellung der Gesamtlaufstreckenentwicklung
2 Grafische Darstellung der Sprintstreckenentwicklung
3 Durchschnittliche Distanz der Spielergruppen je Intensitatsbereich [in m] (Broich, 2009)
4 Komponenten der sportlichen Leistungsfahigkeit (mod. nach Weineck, 2004, 17)
5 Strukturpyramide der Handlungsschnelligkeit (Brack & Bubeck, 1999)
6 Angriffssituationen im Überblick (Stöber et al., 2010)
7 Motorische Schnelligkeit und ihre Erscheinungsformen (mod. nach Grosser & Renner, 2007, 18)
8 Reaktionszeiten bei motorischen Handlungen (Friedrich, 2007, 173)
9 Modell zur Beziehung zwischen den konditionellen Fühigkeiten Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer (mod. nach Steinhofer, 2003)
10 Prozess von der Informationsaufnahme bis zur Handlungsausführung (Eigene Darstellung in Anlehnung an Konzag, Krug & Lau, 1988)
11 Vertikales und horizontales Gesichtsfeld beim Menschen (Platen, 2009)
12 Anordnung der Lichtschranken beim 30m Sprintest
13 Komponenten der Handlungsschnelligkeit (mod. nach Steinhofer, 2003)
14 Aufbau des Gewandtheit und Dribbling Parcours (DSHS Küln, 2006)
15 Aufbau des Ballkontrolltests (DSHS Koln, 2006)
16 Aufbau des azyklischen Sprint- und Dribblingtests mit Lichtschranken
17 Lichtschranke und Reflektor der Firma Fusion Sport Smartspeed
18 Aufbau des Passtests auf Lichtsignal
19 hp iPAQ der Firma Fusion Sport Smartspeed
20 Histogramm der Gesamtgruppe beim Sprint
21 Streudiagramm der Gesamtgruppe beim Sprint
22 Streudiagramm der Gesamtgruppe beim Dribbling
23 Streudiagramm der Gesamtgruppe beim Pass
24 Vergleich des Mittelwertes aller Versuche je Verein beim Sprint und Dribbling .
25 Vergleich des Mittelwertes aller Versuche je Verein beim Pass
26 Haufigkeitsverteilung der Mittelwerte beim Sprint des SVK
27 Haufigkeitsverteilung der Mittelwerte beim Dribbling des SVK
28 Haufigkeitsverteilung der Mittelwerte beim Pass des SVK
29 Streudiagramm des SVK beim Sprint
30 Streudiagramm des SVK beim Dribbling
31 Streudiagramm des SVK beim Pass
32 Vergleich der Mittelwerte beim Sprint und Dribbling bezogen auf die Untergruppen
33 Vergleich der Mittelwerte beim Pass bezogen auf die Untergruppen
Tabellenverzeichnis
1 Gesamtlaufleistungen und anteilige Sprintstrecken im Spitzenfußball (nach Ver- heijen (1996) und amisco-system (2004))
2 Antrittsbeschleunigung (Zeit über 10m in Sekunden) (Geese, 2009, 52)
3 Sprintschnelligkeit (Zeit über 30m in Sekunden) (Geese, 2009, 53)
4 Anzahl der Versuchspersonen je Mannschaft
5 Einstufung des Korrelationskoeffizienten (Zöfel, 2003)
6 Bewertung von Reliabilitötskoeffizieten (Lienert & Raatz, 1998)
7 Anzahl der Testergebnisse und Messwerte aller Versuchspersonen
8 Reliabilitatskoeffizienten aller Mannschaften unterschiedlicher Spielklasse ...
9 Reliabilitatskoeffizienten bei unterschiedlichen Mannschaften bezogen auf die verschiedenen Tests
10 Korrelationskoeffizienten aller Mannschaften je Test bezogen auf das Exper- tenranking
11 Korrelationskoeffizienten aller Mannschaften je Test bezogen auf die Ergebnisse beim DFB-Talenttest
12 Ergebnisse der einfaktoriellen Varianzanalyse (F-Test) mit SPSS
13 Ergebnisse des Tukey-HSD-post-hoc-Tests
14 Rangfolge beim Sprinttest des SVK (1.Messung)
15 Rangfolge beim Sprinttest des SVK (2.Messung)
16 Rangfolge beim Dribblingtest des SVK (1.Messung)
17 Rangfolge beim Dribblingtest des SVK (2.Messung)
18 Rangfolge beim Passtest des SVK (1.Messung)
19 Rangfolge beim Passtest des SVK (2.Messung)
20 Summe der z-Werte vom SVK U
21 Summe der z-Werte vom SVK U
22 Platzierungen der U14 des SVK bei den einzelnen Tests
23 Platzierungen der U15 des SVK bei den einzelnen Tests
24 Rangfolge aller Teilnehmer des DFB beim Sprinttest
25 Rangfolge beim Sprinttest des DFB U14
26 Rangfolge beim Sprinttest des DFB U15
27 Rangfolge aller Teilnehmer des DFB beim Dribblingtest
28 Rangfolge beim Dribblingtest des DFB U15
Rangfolge beim Dribblingtest des DFB U15
Rangfolge aller Teilnehmer des DFB beim Passtest
Rangfolge beim Passtest des DFB U14
Rangfolge beim Passtest des DFB U15
Summe der z-Werte vom DFB U14
Summe der z-Werte vom DFB U15
Platzierungen der U14 des DFB bei den einzelnen Tests
Platzierungen der U15 des DFB bei den einzelnen Tests
Rangfolge aller Teilnehmer des VfB beim Sprinttest
Rangfolge beim Sprinttest des VfB U14
Rangfolge beim Sprinttest des VfB U15
Rangfolge aller Teilnehmer des VfB beim Dribblingttest . .
Rangfolge beim Dribblingtest des VfB U14
Rangfolge beim Dribblingtest des VfB U15
Rangfolge aller Teilnehmer des VfB beim Passtest
Rangfolge beim Passtest des VfB U14
Rangfolge beim Passtest des VfB U15
Summe der z-Werte vom VfB U14
Summe der z-Werte vom VfB U15
Platzierungen der U14 des VfB bei den einzelnen Tests
Platzierungen der U15 des VfB bei den einzelnen Tests
Zeiten der besten Versuche aller drei Gruppen je Test
Zeiten der schlechtesten Versuche aller drei Gruppen je Test
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Allgemein
Moderner Fußball zeichnet sich durch deutliche Fortschritte hinsichtlich Athletik, Dynamik und Tempoausprägung aus. Die Schnelligkeit hat unter den konditionellen Leistungsvoraussetzungen im Fußball die gräßte Bedeutung und stellt einen leistungslimitierenden Faktor dar. Untermautert wird dies dadurch, dass die Schnelligkeit weniger trainierbar als die Kraft oder die Ausdauer ist. Schuld daran ist die genetisch festgelegte Verteilung der verschiedenen Fasertypen im Muskel. Gleichzeitig ist die Schnelligkeit am wenigsten untersucht und unter Experten am kontroversesten diskutiert. Das mag daran liegen, dass Schnelligkeit eine außergewöhnlich komplexe Erscheinung darstellt, die im Fußball nicht nur die reine Sprintschnelligkeit, sondern auch das moglichst schnelle Reagieren und Handeln auf einen spieltypischen Reiz, die Beschleunigungsfahigkeit und das Erkennen der jeweiligen Spielsituation umfasst. Ein Schnelligkeitstraining muss sich an diesen Teilkomponenten orientieren. Eine rein läuferische Ausbildung wird den komplexen Anforderungen des Fußballs nicht gerecht (Schlumberger, 2010). Schnelligkeit resultiert aus der Leistungsfähigkeit von Nervenleitprozessen und steht somit in direktem Zusammenhang mit Steuerungs- und Regelungsmechanismen. Sie wiederum bilden ein Merkmal koordinativer Fähigkeiten. Koordinative Aspekte (das Nerv-Muskel-Zusammenspiel legt fest, wie schnell die Muskeln aktiviert werden konnen) spielen somit eine wichtige Rolle. Die Schnelligkeit wird daher heute nicht mehr nur als reine konditionelle Fahigkeit, sondern als koordinativ-konditionelle Fähigkeit gesehen. Neben koordinativen Aspekten ist auch das Maximalkraft- bzw. Schnellkraftniveau von Bedeutung. Schnelligkeit kann als koordinatives Resultat mit den konditionellen Grundlagen der Kraft und der Ausdauer bezeichnet werden (Damerow, 2005). Ein entscheidender Faktor fur die Schnelligkeit ist die Zusammensetzung der Muskeln aus verschiedenen Muskelfasern. Sie weisen Unterschiede hinsichtlich der Kontraktionsgeschwindigkeiten sowie der Ermudungsresistenz auf. Folgende Muskelfasertypen werden unterschieden: Typ-I (ST-Fasern) sind rote langsame Fasern mit hoher Ermudungsresistenz, Typ-IIa (FTO-Fasern) sind weiße schnelle Fasern mit hoher Ermudungsresistenz, Typ-I Id (FTG- Fasern) sind weiße schnelle Fasern, die schnell ermuden und Typ-IIc (Intermediarfasern) sind zwischen Typ I und II einzuordnen (Weineck, 2002; Hohmann, Lames & Letzelter, 2007; Scheid & Prohl, 2007). Entscheidend fur die schnelle Bewegungen sind die Typ-II-Fasern. „Sie kontrahieren schneller als die roten Fasern, ermuden aber auch eher“ (Scheid & Prohl, 2007, 62).
Eine Umwandlung von langsamen zu schnellen Fasern ist nicht möglich. Wohingegen schnelle Fasern durch langfristiges Ausdauertraining dauerhaft in langsame ST-Fasern umgewandelt werden können (Steinacker, Wang, Lormes, Reißnecker & Liu, 2002; Hohmann et al., 2007). Durch taktische Verönderungen (schnelles Umschalten nach Ballgewinn, schnelle Spielverlagerungen) in den letzten Jahren hat sich auch das physische Anforderungsprofil im Fußball veröndert. Es besteht primar aus explosiven schnellen und schnellkröftigen Aktionen wie Sprints, Sprungen, Richtungswechseln, Torschössen und Zweikampfsituationen. Diese werden als dominierende Aktionen bezeichnet, da sie wesentlich zum Spielerfolg beitragen. So fuhrt ein Spieler in einem 90-minutigen Spiel im Mittel 1000 bis 1400 Kurzaktionen aus, die alle vier bis sechs Sekunden wechseln (Schlumberger, 2010). Untersuchungen der Sprintleistungen von Verheijen (1996) und amsico-system (2004) ergaben, dass heute etwa 20 bis 30% mehr Antritte verlangt werden. Dabei werden 70% der Sprints im Bereich von 1-10m absolviert. Es gibt auch positionsspezifische Unterschiede, so absolvieren die Sturmer die meisten Sprints, die Abwehrspieler die wenigsten und die Mittelfeldspieler legen die langsten Sprints zuruck. In Anbetracht der Tatsache, dass die Spieler ca. 90% der Zeit und Aktionen auf dem Spielfeld ohne Ball absolvieren, kommt dem schnellen vorausschauenden Verhalten ohne Ball große Bedeutung zu. Die Handlungsschnelligkeit ist aufgrund der Informationsaufnahme und - verarbeitung sowie der situationsgerechten Handlungsausfuhrung die komplexeste Form der Schnelligkeit (Daum & Gerisch, 2005). Zu den haufigsten Empfehlungen zur Verbesserung der Schnelligkeit gehoren schnellkraftorientierte Trainingsformen. Hinlanglich bekannt ist, dass ein Krafttraining mit quasi maximalen Lasten sowohl fur den Sprintantritt als auch die maximale Sprintgeschwindigkeit einen effektiven Trainingsreiz darstellt. So kann nach einem ballistischen Schnellkrafttraining mit mittleren Lasten (Sprung auf einen Erhohung mit Zusatzgewicht) eine signifikante Verbesserung beim 30m Sprint festgestellt werden. Daruber hinaus scheinen Sprungkraftubungen den Sprintantritt effektiv zu verbessern (Schlumberger, 2010). Optimale Wirkung kann durch die Kombination von individuellem Kraft- und Sprungkrafttraining erzielt werden (Wienecke, 2007). Nach Damerow (2005) ist jede Form der Schnelligkeitsbewegung eine Schnelligkeitsausdauerbewegung und unterliegt von Beginn an Leistungsverlusten aufgrund von Ermudungserscheinungen. Taktische Veranderungen und das hohere Spieltempo verandern das Anforderungsprofil der Fußballspieler und rucken die Thematik Handlungschnelligkeit (als moglichen spielentscheidenden Faktor) in den Vordergrund.
1.2 Zielsetzung/Problemstellung der Arbeit
Die bereits erwähnten dominierenden Aktionen werden in technomotorischen Leistungstests an den 366 DFB-Stutzpunkten untersucht. Diese Leistungstests stellen einen wichtigen Bestandteil der Talentdiagnostik im Fußball dar. Hinsichtlich der inhaltlichen Aussagekraft können im Gruppenvergleich leistungsstärkere von leistungsschwacheren Spielern voneinander unterschieden werden. Spieler mit äberdurchschnittlichen Testergebnissen erreichen mit größerer Wahrscheinlichkeit zukunftig ein hohes Leistungsniveau. Ein Problem der Talentdiagnostik ist, dass jedes noch so gute Talentmodell nur Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen kann. Eine exakte Vorhersage des zukänftigen Leistungsniveaus eines Spielers lasst sich nicht realisieren. Daher ist die Einhaltung wissenschaftlicher Gätekriterien bei der Auswahl und Durchfährung der Talenttests erforderlich. Die Objektivität beschreibt die Unabhangigkeit der Ergebnisse eines Messverfahrens von der Person des Versuchsleiters. Die Reliabilität bezieht sich auf die Genauigkeit, mit der ein Messverfahren ein Merkmal misst. Die Validität erfasst, ob ein Messverfahren inhaltlich tatsachlich jenes Merkmal misst, fär das es konstruiert worden ist. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Versuchsaufbau und -durchfuhrung der Testbatterie zur talentorientierten Technikdiagnostik. Die von Lottermann, Lautenklos und Friedrich entwickelte Testbatterie (2002) umfasst sechs Einzeltest (Linearsprint, Gewandheitslauf, Dribbling, Torschuss, Ballkontrolle und Jonglieren). Der Linearsprint erstreckt sich uber 20m (Zwischenzeit bei 10m). Der Start erfolgt nach eigenem Ermessen aus beliebiger Schrittstellungfindet. Hierbei ist die Strecke vorgegeben und der Start erfolgt nicht auf ein (z.B. optisches) Signal. Beim Ball- kontrolltest muss der Spieler aus einem begrenzten Feld (1,5 x 1,5m) eine vorgegebene Anzahl an Passen abwechselnd gegen zwei Ruckprallwande (im Winkel 180) spielen. Der Ablauf nach dem Start ist ebenfalls determiniert und es findet z.B. keine Informationsverarbeitungsprozess statt, da keine Entscheidung (aufgrund der Wahrnung eines Signals) selbststandig getroffen werden muss. Die Technikdiagnostik konzentriert sich ausschließlich auf die Uberprufung technisch-koordinativer Fahigkeiten und nicht auf die Handlungsschnelligkeit. In Anlehnung an die bestehende Testbatterie, die vorallem die konditionelle und sportmotorische Komponente bewertet, beinhalten die in dieser Arbeit vorgestellten Testverfahren, im Rahmen der Dissertation von Kristian Krause, zusatzlich eine kognitive Komponente. Das optische Signal veranlasst den Spieler zu starten und gibt die Richtung vor. Hierbei findet also eine Informationsaufnahme und - verarbeitung statt, die sich in einer motorischen Ausfuhrung (Aktion) entsprechend dem Signal außert.
Ziel dieser empirischen Arbeit ist es, die entwickelten Testverfahren zur Messung der fußballspezifischen Handlungsschnelligkeit (mit komplexen Auswahlreaktionen) hinsichtlich der Gutekriterien zu evaluieren. Wie reliabel und valide sind die entwickelten Testverfahren? Wie zuverlassig sind die Testergebnisse? Unterscheiden sich leistungsstarkere von leistungsschwacheren Spielern? Mit diesen Fragen beschaftigt sich die Arbeit, die wie folgt aufgebaut ist.
1.3 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. Nach diesem einleitenden Kapitel wird in Kapitel 2 auf die theoretischen Grundlagen eingegangen. Dabei wird zunachst die Sportart Fußball analysiert. Dazu gehört das Anforderungsprofil, das Belastungsprofil sowie das Leistungsstrukturmodell. Im Anschluss wird die Schnelligkeit und deren Bedeutung im Fußball dargestellt. Motorische und informatorische Schnelligkeit werden getrennt von einander bearbeitet und jeweils die Bedeutung sowie die Diagnostik herausgearbeitet. Untersuchungsmethodik und Versuchsdurchfuhrung stehen in Kapitel 3 im Vordergrund. Der genaue Versuchsaufbau und die Messeinrichtungen werden vorgestellt. Die Darstellung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse folgt in Kapitel 4. Die daraus resultierende Diskussion der Untersuchungsergebnisse bildet Kapitel 5. In Kapitel 6 werden die wichtigsten Punkte zusammengefasst und ein kurzer Ausblick gegeben. Am Schluss stehen das Literaturverzeichnis und der Anhang mit allen wichtigen Daten.
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Sportartanalyse im Fußball
Die Sportartanalyse ist die wichtigste theoretische Wissensgrundlage des Trainers. Sie soll Kenntnisse zu den aktuellen Ausprägungen von Leistungsvoraussetzungen und -bedingungen und deren internem Beziehungsgefäge vermitteln (Hohmann, Lames & Letzelter, 2007, 231). Also Kenntnisse äber die biomechanischen, physiologischen und funktionell-anatomischen Bedingungen der Bewegungsabläufe und Belastungen sowie des konditionellen, kognitiven, psychischen, anthropometrischen, sozialen und materialen Anforderungsprofiles (Grosser & Renner, 2007, 121). Ein Anforderungsprofil beschreibt einen anzustrebenden Sollzustand auf Grundlage der momentanen Anforderunngs- und Belastungsstruktur und ist das Ergebnis einer Analyse der im Fußball geforderten Fahigkeiten. Fundierte Kenntnisse des fußballspezifischen Anforderungsprofils sind die Voraussetzung fur eine Leistungssteuerung. Das Belastungsprofil erfasst die Art, Umfang und Intensitat aller Bewegungsaktivitaten denen die Spieler im Wettkampf ausgesetzt sind. Aus der Analyse werden die leistungsbestimmenden (hauptsächlich konditionelle) Faktoren im Fußball abgeleitet (Reinhold, 2008, 21). Das Leistungsstrukturmodell zeigt schließlich die verschiedenen Komponenten der körperlichen Leistungsfahigkeit des Fußballspielers.
2.1.1 Anforderungsprofil
Die Anforderungen an einen Fußballspieler sind sehr vielseitig. Die Grundtechniken wie Ballan- und -mitnahme oder Passen mässen beherrscht werden. Heutzutage werden die Räume eng gemacht, daher darf der Ball nicht weit vom Fuß weg springen. Die Umsetztung einstudierter Pass- und Laufwege auf dem Platz ist genauso wichtig wie die Kreativitat am Ball. Optimal wäre es, wenn Spieler eine gute Spieläbersicht (z.B. peripheres Sehen) haben. Immer wichtiger werden Bezeichnungen wie „mannschaftsdienlich spielen“ oder „teamfahig sein“. Zu diesen technisch-taktischen und sozialen Anforderungen kommt zusatzlich Druck von Außen durch die Medien oder den eigenen Trainer. Eine starke Psyche und eine gereifte Spielerpersönlichkeit sind da enorm hilfreich. Diese Anforderungen gelten fär alle Spieler gleichermaßen, jedoch gibt es auch positionsspezifische Anforderungen. Der Torspieler sollte exzellente Reflexe und gute Sprungkraft besitzen. Daruber hinaus muss er heutzutage mit dem Ball umgehen kännen und die Grundtechniken der Feldspieler beherrschen. Die Innenverteidiger sollten möglichst groß sein, um lange Balle des Gegners im Kopfballduell för sich zu entscheiden. Da der Spielaufbau häufig von diesen Positionen eingeleitet wird, ist sicheres Passspiel eine Grundvoraussetzung för diese Position. Zweikampfstarke ist auf allen Positionen wichtig, doch auf dieser Position kann sie spielentscheidend sein, da der gegnersiche Störmer frei zum Torschluss kommen kann. Außenverteidiger und Mittelfeldspieler gestalten das kreative Offensivspiel und verteidigen bei Ballverlust. Diese Spieler sollten sich im 1-gegen-1 durchsetzen können und Tore vorbereiten. Im Idealfall werden sie selbst torgefährlich. Die Sturmer bzw. die Sturmspitze sollte den Ball halten können, d.h. gegen mehrere Gegenspieler verteidigen können, um den Mittelfeldspielern die nötige Zeit zum Nachrucken zu geben. Desweiteren sollte auch die Sturmspitze kopfballstark sein, um Flanken von Außen direkt zu verwerten.
Das physische Anforderungsprofil im Fußball hinsichtlich der Ausdauerleistungsfahigkeit leitet sich von der Laufarbeit während eines Spiels ab. Die Laufintensitat, -dauer und Streckenlangen wechseln im Verlauf eines Spiels oft (azyklischer Charakter), daher benötigt der Fußballer eine optimal entwickelte Grundlagenausdauer (GLA). Die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) und die individuelle anaerobe Schwelle (IAS) werden als Indikatoren verwendet. Die VO2max för Profifußballer liegt zwischen 55 und 69ml/kg x min (Helgerud, Engen, Wisloff & Hoff, 2001). Die GLA ist wegen des enormen Laufpensums (8-12km) notwendig. Diese bildet die Basis der fußballspezifischen Schnelligkeitsausdauer (durch viele unregelmößige Sprints gekennzeichnet), welche der Aufrechterhaltung eines hohen Spieltempos bis zum Spielende dient. Mit zunehmendem Spieltempo gewinnt sie an Bedeutung, da sie oft daruber entscheidet, wer sich zum Beispiel im Zweikampf durchsetzt, mit welcher Qualitöt Technik und Taktik umgesetzt werden oder wie genau Pösse gespielt werden.
Die Anforderungen an die Schnelligkeit verandern sich ebenfalls durch die Erhöhung des Spieltempos. Das moglichst schnelle Reagieren (Reaktionsschnelligkeit) auf sich stets veröndernde Situationen und das damit verbundene schnelle Handeln (Handlungsschnelligkeit) ist wichtig. Die meisten Sprints liegen im Bereich von 1-10m, daher kommt der Antrittsschnelligkeit besondere Bedeutung zu. Die Relevanz des Beschleunigungsvermogens kommt zum Tragen, wenn in relativ kurzer Zeit die Höchstgeschwindigkeit erreicht werden soll. Bei lönger andauernden Sprints wird die Schnelligkeitsaudauer (Sprintausdauer) zur wichtigsten Schnelligkeitskomponente. Viele schnelle Richtungswechsel pragen das Bewegungsverhalten der Spieler ebenso wie lineare Sprints. Hinzu kommen die informatorischen (kognitiven) Faktoren: Wahrnehmungs-,
Antizipations- und Entscheidungsfähigkeit, die die Leistungsfähigkeit des Fußballers beeinflussen.
Für die dynamische Richtungswechsel, Sprunge, explosive Antritte oder Schusse ist eine schnellkräftige Muskulatur erforderlich. Neben der Schnellkraft ist auch die Maximalkraft (durch die Fähigkeit der willkürlichen Aktivierung) von Bedeutung. Kraftausdauer spielt eine wichtige Rolle, da die Spieler uber die gesamte Spieldauer schnellkraftig agieren (ohne Einbußen) mochten. Verheijen nennt funf Teilbereiche der Kraft, die sich an den fußballspezifischen Aktionen orientieren: Antrittskraft fur wiederholte schnelle Antritte, Sprungkraft fur Kopfballe und Sprunge, Stoßkraft fur Passe und Schusse, Zweikampfkraft fur Stabilitat im Zweikampf und die Grundkraft, die fur alle Sportarten grundsatzlich erforderlich ist (Verheijen, 1999/2000, 89). Zu den Komponenten der Leistungsfahigkeit des Fußballers gehören auch noch koordinative Fa- higkeiten und Bewegungsfertigkeiten (Technik). „Koordination ist die Fahigkeit, technische Handlungen mit und ohne Ball zielgerichtet, schnell, prazise und okonomisch durchzufuhren“ (Bisanz & Gerisch, 2008, 235). Koordinative Fahigkeiten bestimmen die Fußballtechnik. Zu diesen gehoren:
„Die kinasthetische Differenzierungsfahigkeit, Reaktionsfahigkeit, Kopplungsfahig- keit, raumliche Orientierungsfahigkeit, Gleichgewichtsfahigkeit, Umstellungsfahig- keit bzw. Anpassungsfahigkeit und die Rhythmisierungsfahigkeit“ (Bisanz & Gerisch, 2008, 235).
2.1.2 Belastungsprofil
Die effektive Spielzeit eines 90-minutigen Fußballspiels betragt ca. 60 Minuten. Computergestutzte Analysen belegen, dass die durchschnittliche Laufdistanz von Mittelfeldspieler bei ca. 12km pro Spiel liegt. Zwei Drittel davon werden gegangen oder getrabt, 20 bis 25% mit mittlerer und 10% mit hoher Intensitat gelaufen oder gesprintet (Kindermann, 2006). Bangsbo (1994) kommt zu ahnlichen Ergebnissen bei der Untersuchung der danischen Profiliga: 17% Stehen, 40% Gehen, 35% langsames Laufen, 8% Laufen mit hohem Tempo und 0,6% maximale Sprints. In einem Spiel sprinten die Spieler uber 300 mal (Der Spiegel, 2008, 127). Dabei sind Strecken uber 20 Meter eher die Seltenheit. Verheijen (1996) und amisco-system (Spielerdaten der ersten Liga in Spanien, England und Frankreich) (2004) haben folgenden Vergleich bezuglich der Laufintensitaten und Gesamtlaufleitungen erstellt:
Anhand dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass die Lauftstrecke insgesamt und speziell die Sprintstrecke erheblich zugenommen hat. Die durchschnittliche Laufstrecke hat sich demnach um A 1000m und die durchschnittliche Sprintstrecke um ca. 30% (A 342m) erhöht. Den deutlichsten Zuwachs an Laufstrecke (A 2000m) verzeichneten die Verteidiger, wohingegen die Werte der Mittelfeldspieler (A 500m) und Sturmer (A 200m) nur leicht gestiegen sind. Sturmer absolvieren vergleichsweise die höchste Anzahl an Sprints. Mittelfeldspieler sprinten im Positionsvergleich am wenigsten, ihre Sprintstrecken sind im Durchschnitt am langsten. Diese Analysen der Gesamtlaufstrecken und deren anteiligen Sprintstrecken von Verheijen (1996) und amsico-system (2004) zeigen, dass die Ausdauer und Schnelligkeit an Bedeutung gewonnen hat. Inter Mailand lief im Schnitt 103,172km pro Spiel und lag damit weit unter jenem von ZSKA Moskau (118,041km) (Roxburgh & Turner, 2010, 63). Dennoch gewann Mailand die UEFA Champions League in der Saison 2009/2010. Neuere Untersuchungen von Broich (2009) zeigen ahnliche Ergebnisse hinsichtlich der Laufstecken von Profifußballern:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Durchschnittliche Distanz der Spielergruppen je Intensitätsbereich [in m] (Broich, 2009)
Im Unterschied zu anderen Untersuchungen wurden die Verteidiger der Viererkette in zwei Gruppen (Innen- und Außenverteidiger) geteilt und diffenziert betrachtet. Das macht Sinn, da sich die Außenverteitiger (AV) im Angriffsspiel beteiligen und somit mehr Laufarbeit verrichten als die Innenverteidiger (IV), deren Aufgabe in der Absicherung des Zentrums vor dem Tor besteht. Auch bei diesen Untersuchungen kommt es zum selben Ergebniss, dass die Mittelfeldspieler (MF) in der Gesamtdistanz mit 11357m ± 510m die deutlich höchsten Distanzwerte laufen. Die geringste Gesamtdistanz erreichen Innenverteidiger, die im Durchschnitt 10170m ± 576m in 90 Minuten zuröcklegen. Die durchschnittliche Strecke aller Spieler betragt hierbei 10787,1m ± 485,9m. Zusatzlich wurde bei diesen Untersuchungn die Laufstrecken in festgelegten Geschwindigkeits- oder auch Intensitatsbereichen erhoben. Diese Bereiche reichen von 0-11,0km/h, 11,1-14,0km/h, 14,1-17,0km/h, 17,1-21,0km/h, 21,1-24,0km/h sowie uber 24,0km/h. Die Sturmer legen z.B. im ersten Bereich (0-11,0km/h) die geringste Strecke mit 6553 ± 40m, jedoch im schnellsten Bereich (uber 24km/h) mit 324 ± 116m die langste Strecke zuruck.
Nach der Betrachtung der konditionellen Belastungsstruktur hinsichtlich der Gesamtlaufleistungen und deren Abhangigkeit von der Spielerposition soll nun das energetische Beanspruchungsprofil ins Auge gefasst werden. Durch den azyklischen Charakter der Sportart Fußball variiert die Intensitat in den Aktionen standig. Der menschliche Körper kann Energie fur die Muskelkontraktion uber drei Energiesysteme gewinnen: das Sauerstoffsystem (aerober Stoffwechsel), das Phophatsystem (ATP-KP-System) und das Milchsauresystem (anaerobe laktazide Glykolyse).
Die Anaerobe-alaktazide Energiegewinnung ist fur kurze, exposive Antritte in den ersten 6-8 Sekunden von Bedeutung. Bei hochintensiven Belastungen dominiert die ATP-Resynthese im Sarkoplasma aus dem energiereichen Kreatinphosphat (De Marees, 2002). Diese erste Phase wird als alaktazid bezeichnet, weil sie ohne Laktat-Bildung stattfindet:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hochintensive schnellere Dribblings oder Sprints Uber ca. 10-15 Sekunden hinaus, stellen die zweite Phase dar und erfolgen ebenfalls ohne Sauerstoff Uber den Abbau von Kohlenhydraten. Bei der anaerob-laktaziden Energiegewinnung entsteht Laktat (Salz der Milchsaure), die schnell zur Ermudung fuhrt, wenn sie sich verstarkt anhauft. Diese Phase umfasst die anaerobe Glykolyse (De Marees, 2002):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei Belastungen uber zwei Minuten Dauer wird die Energie unter Verwendung von ausreichend Sauerstoff in den Mitochondrien (.Kraftwerke“ der Zellen) (De Marees, 2002):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die aerobe Verbrennung von Gluokose eine größere Energiemenge zur Verfugung stellt als die anaerobe Oxidation. „Die Energiebereitstellung lauft relativ langsam bei der aeroben Oxidation im Vergleich zur anaeroben Oxidation“ (Weineck, 2010, 149). Dennoch sind beide Wege der ATP-Resynthese fur den Fußballer wahrend eines 90-minutigen Spiels relevant. Eine gut entwickelte aerobe Grundlagenausdauer wird benotigt, da die Laufstrecke im Spiel zwischen 10 bis maximal 14km pro Spieler (mit Ausnahme des Torspielers) betragt. Kurze Sprints werden von der anaerob-alaktaziden Energiebereitstellung gedeckt, wohingegen bei langeren (mehr als 30m) Sprints auf die anaerob-laktazide Energiebereitstellung zurnckgegriffen wird (Friedrich, 2007; De Marees, 2002).
Zu hohen Belastungen und Beanspruchungen des Stutz- und Bewegungsapparates kommt es im Fußball insbesondere im Bereich der unteren Extremitaten. Gerade die Oberschenkelmuskulatur wird aus vorgedehnter Position durch explosive Kraftentfaltung bei Schussen oder Sprintantritten erheblich belastet. Die Belastung besteht aber nicht nur fur die Oberschenkelvorderseite. Die ischiocrurale Muskulatur der Oberschenkelruckseite muss z.B. als Antagonist der Huft- und Kniegstreckung am Ende der Schussphase in gedehnter Stellung die Tibiabewegung abbremsen und nimmt dabei bis zu 85% der kinetischen Energie auf. Untersuchungen ergaben, dass 60 bis 90% aller Verletzungen betreffen die untere Extremitat (Inklaar, 1994; Kuppig & Heisel, 1993), gefolgt von Verletzungen des Rumpfes, der oberen Extremitat und des Kopfes. 29% aller Verletzungen betreffen das Knie, gefolgt vom oberen Sprunggelenk mit 19% und der Wirbelsaule mit 9%. Distorsionen im oberen Sprunggelenk ereignen sich eher aufgrund externer Einflusse, Verletzungen des Kniegelenkes in uber 50% der Fälle aufgrund interner Faktoren (Junge, Chomiak & Dvorak, 2000). Bei Muskel- und Sehnenverletzungen sind Quadriceps, Adduktoren und ischiocrurale Muskulatur besonders oft betroffen. Andere Faktoren, die zum Spielerfolg und zur Leistungsfahigkeit der Spieler beitragen können, werden im Leistungsstrukturmodell dargestellt.
2.1.3 Leistungsstrukturmodell
Konditionelle, koordinativ-technische, taktisch-kognitive, soziale und psychische Komponenten bedingen die sportliche Leistungsfahigkeit (vgl. Abb. 4). Gesundheit ist die Voraussetzung, um die vorhandenen Fahigkeiten erfolgreich umzusetzen. Top-Spieler weisen in allen Bereichen uberdurchschnittliche Leistungen auf. Die unterschiedlichen Komponenten stehen in Wechel- beziehung zueinander. So hat zum Beispiel die Kondition direkten Einfluss auf die Technik, Taktik und Konzentration. Umgekehrt nutzen einem Spieler die besten konditionellen Fahigkeiten nichts, wenn er nicht die technischen Voraussetzungen zur adaquaten Umsetzung besitzt. Bei den Leistungsfahigkeiten handelt es sich lediglich um eine Voraussetzung fur den Spielerfolg. Sie durfen nicht als Garantie fur Erfolg gesehen werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Komponenten der sportlichen Leistungsfähigkeit (mod. nach Weineck, 2004, 17)
Die Psychischen Fähigkeiten sind Wille, Motivation, Leistungsbereitschaft, Einstellung und (Spiel-) Intelligenz. Hinzu kommen Fahigkeiten wie Konzentration und Aufmerksamkeit auch im ermudeten Zustand. Technische Fertigkeiten (Dribbling, Ballannahme) sind heutzutage vorallem auf engstem Raum und unter Gegnerdruck gefragt. Sie beruhen auf Koordinations- und Wahrnehmungsfahigkeiten (Geese, 2009, 18f). Die Kondition als Sammelbegriff fur die motorischen Grundfahigkeiten Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit/Flexibilitat wurde bereits in Unterkapitel Anforderungs- und Belastungsprofil beschrieben. Diese Grundfahigkeiten stehen in Wechelbeziehungen zueinander. Die Kraft und Schnelligkeit in Form der Schnellkraft, die wichtig fur die Antritte oder Schusse ist. Fur das schnelle Umschalten (z.B. beim Konter) uber langere Stecken ist die Schnelligkeitsausdauer gefordert. Im Bereich der sozialen Fahigkeiten kommt der Teamfahigkeit die größte Bedeutung zu. Im nachsten Kapitel soll speziell die Schnelligkeit genauer betrachtenwerden, da Kenntnisse uber sie als Basiswissen fur die Testdurchfuhrungen dienen.
2.2 Schnelligkeit und deren Bedeutung im Fußball
Die theoretische Aufarbeitung der Thematik Schnelligkeit und deren Bedeutung im Fußball sowie deren Diagnostik sind für diese empirische Überprüfung relevant. Dominanter Gegenstand ist die Handlungsschnelligkeit im Sportspiel Fußball. Wie bereits in der Einleitung erwühnt, lasst die Schnelligkeit sowohl eine Zuteilung zu den konditionellen Fühigkeiten (Ausdauer und Kraft) als auch zu den koordinativen Fahigkeiten zu (Grosser, 1991; Martin, Carl, & Lehnertz, 1991; Weineck, 2004; Schnabel & Thieß, 1993). Allgemein wird unter der Schnelligkeit im Fußball die Fühigkeit, motorische Handlungen mit hüchstmoglicher Geschwindigkeit und Genauigkeit auszuführen (Daum & Gerisch, 2005), verstanden. Grosser (1995) versteht unter dem in der Sportpraxis gewachsenen Begriff Schnelligkeit:
„Die Fahigkeit, aufgrund kognitiver Prozesse, maximaler Willenskraft und der Funk- tionalitüt des Nerv-Muskel-Systems hüchstmogliche Reaktions- und Bewegungsgeschwindigkeiten zu erzielen“ (Grosser, 1995, 45).
Dabei bezieht er sich auf verschiedene Möglichkeiten schneller Bewegungen:
1. Beginnende Bewegungsaktionen nach Signalwirkung (Reaktionsschnelligkeit)
2. Einzelbewegungen bzgl. der Schnelligkeit bei azyklischen Bewegunungen (Sequenzschnelligkeit)
3. Fortlaufend gleichfürmige Bewegungen bzgl. der Schnelligkeit bei zyklischen Bewegungen (Frequenzschnelligkeit)
4. Komplexe Bewegungshandlungen bzgl. der Kombination von azyklischen und zyklischen Bewegungen.
Die Komplexitat der Erscheinung Schnelligkeit manifestiert sich in der Umschreibung als komplexe pyscho-physische Fähigkeit. In Anlehnung an die Strukturpyramide der Handlungsschnelligkeit (vgl. Abb. 5) von Brack & Bubeck (1999) differenziert sich die Handlungschnelligkeit in die motorische und informatorische Schnelligkeit mit ihren Teilkomponenten. Die Teilkomponenten der motorischen Schnelligkeit (vgl. Kapitel 2.2.1) sind die Ausdauer, Kraft und Koordination. Wahrnehmungs-, Antizipations- und Entscheidungsschnelligkeit sind Bestandteil der informatorischen Schnelligkeit (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Teilfühigkeit Reaktionsschnelligkeit wird in diesem Modell nicht berücksichtigt, spielt jedoch für die Interpretation der Messdaten eine wichtige Rolle. Die Ebene der Handlungsschnelligkeit unterteilt sich in die Bereiche „Aktionsschnelligkeit mit Ball“ und „Bewegungsschnelligkeit ohne Ball“. Daher werden die azyklischen
Sprinttests ohne Ball durchgeführt und die azyklischen Dribblingtests mit Ball (vgl. Kapitel 3.3.1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Strukturpyramide der Handlungsschnelligkeit (Brack & Bubeck, 1999)
Basis dieses Modells bilden die Einflussgrüßen der Schnelligkeit. Unter den anlagebdingten Einflussgrüßen spielt die das Alter und das Talent eine wichtige Rolle. Koordination, Informationsverarbeitung und Wahrnehmung fallen unter die motorisch-sensorischen Einflussgrößen.
Folgende Teilfahigkeiten der Schnelligkeit lassen sich nach Weineck (2004) zusammenfassen: Handlungsschnelligkeit, Aktionsschnelligkeit mit Ball, Bewegungsschnelligkeit ohne Ball, Reaktionsschnelligkeit, Entscheidungsschnelligkeit, Antizipationsschnelligkeit und Wahrnehmungsschnelligkeit (Weineck, 2004, 378). Ihre Bedeutung fur die Leistungsfahigkeit des Fußballers wird in den folgenden Unterkapiteln erlautert.
Erfolgversprechende taktische Veranderungen in Defensive und Offensive fuhren ebenfalls dazu, dass die Schnelligkeit einen immer größeren Stellenwert im Leistungsfußball einnimmt. Anhand der Analyse der Fußball-WM 2010 (Stober, Daniel, Wormuth, Muller, Schomann & Adrion, 2010) haben sich relativ konstante Erfolgsparameter und Qualitatsmerkmale herauskristallisiert:
Hohes Spieltempo
Schnelles Umschalten, schnelles und variantenreiches Kombinieren gepaart mit dynamischen Einzelaktionen sowie enorme Aktionsvariabilität der Spieler sind Kennzeichen des hohen Spieltempos.
Aktive Teamarbeit in der Defensive
Hierbei ist die strategische Zusammenarbeit der kompletten Mannschaft gegen den Ball auffällig. Das sogenannte „Ballorientierte Spiel“ (BOS) zeichnet sich durch das Verengen gegnerischer Angriffsräume in Breite und Tiefe durch ein konsequentes Verschieben zum Ball, um dort ein personelles Übergewicht herzustellen, aus. Das auf Ballgewinn ausgerichtete Agieren in der Defensive soll den Angreifer zu Ballverlusten provozieren.
Variabilität in der Offensive
Flexibilitat im Spielaufbau gegen einen organisierten oder unorganisierten Gegner wird heutzutage immer wichtiger, da alle Mannschaften kompakt stehen und nur wenig Freiräume lassen. Daher werden automatisierte Muster im Spielaufbau gekoppelt mit einer Variabilitat je nach Situation (z.B.: Individuelle Überraschungsmomente). Kombinationsspiel und prazises Flachpass-Spiel mit wenigen individuellen Ballkontakten bis zum Direktspiel machen das Spiel schnell und versucht Läcken in die gegenerische Abwehrreihen zu reißen.
Maximale Fitness als Erfolgsbasis
Athletische Fitness als Basis mentaler Starke sowie lauferische Fitness fur 90 Minuten Tempofußball. Lauferische Qualitäten (wie bereits dargestellt) als Basis fur das Durchbringen spielerischer Qualitaten als Einzelspieler und Team (Stöber et al., 2010).
Es lassen sich Veräanderungen in die Bereichen Grundformation, Offensivspiel und Defensivstrategien erkennen. Das 4-2-3-1-System hat sich bei der WM 20010 als das favorisierte Grundformation herausgestellt, weil variabel angreifen und sicher verteidigt werden kann. Dieses System bildet viele aktuelle Trends im internationalen Fußball ab: Die Dominanz der Viererkette auf der hintersten Linie, zwei Spieler im Mittelfeld zur Sicherung des defensiven Zentrums und fur einen flexiblen Spielaufbau („Doppel-6“), doppelte Besetzung der Außenpositionen sowie die Nominierung nur einer direkten Spitze in vorderster Front. Alle Mannschaften spielen mit Viererkette, weil sie Vorteile in Offensive und Defensive verspricht. „Das gleichmaßige Abdecken der Spielfeldbreite erleichtert das gegenseitige Absichern, das Verstellen der Passwege in die Tiefe und das kompakte Verschieben“ (Stöber et al., 2008). „Doppel-6“ sichert den zentralen Bereich vor dem Tor ab. Dabei agiert einer der beiden Spieler als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff, der andere sichert ab. Durch die zwei zentralen defensiven Spieler wird das Zentral gut abgesichert, sodass die viele Angriffe uber die Flägel erfolgen. Durch das Einschalten (Tempodribbling) der Außenverteidiger (AV) im Angriffsspiel werden die Außenpositionen doppelt besetzt. Der „Stoßstärmer“ wird von einem zentralen Offensivspieler unterstätzt.
Trends im Bereich der Defensivstrategien sind das Perfektionieren des BOS und die Verlagerung der Pressingzonen nach weiter vorne. Greift der Gegner z.B. im Mittelfeld über außen an, rückt der jeweilige AV vor, um Druck auszuUben. Bei der EM 2008 rückten die Innenverteidiger (IV) nach, um den AV abzusichern. Heute rucken die IV nicht mehr nach, sondern sichern das Zentrum. Dafur wird der AV vom offensiven Außenspieler unterstutzt, um die Uberzahlsituation herzustellen. Ein weiterer Trend geht vom extremen „Tiefstehen“, wie bei der EM 2008 praktiziert, weg. „Die perfektere Abstimmung im Mannschaftsverband macht ein weiteres Vorschieben möglich. Die Vorteile fur ein effektives Angreifen durch kurzere Wege zum gegnerischen Tor sind dabei offensichtlich“ (Stober et al., 2010). Die ganze Mannschaft attakiert im vorderen Bereich, vorallem nach Ballverlust wird der Gegner systematisch unter Druck gesetzt. Alle Teams sind defensiv bestens organisiert und stehen kompakt. Die Herausforderung besteht nun darin, gegen gut organisierte Mannschaften, Torchancen herauszuspielen. Angriffssituationen (vgl. Abb. 6) lassen sich danach unterteilen, ob im Moment des Ballgewinns der Gegner einen organisierten Defensivverband aufweist oder unorganisiert ist (Stober et al., 2010).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Angriffssituationen im Überblick (Stöber et al., 2010)
Klassische Kontermannschaften, die extrem tief stehen, sind veraltet. Durch viel Ballbesitz wollen Top-Mannschaften dem Gegner ihr Spiel aufzwingen und gleichzeitig durch schnelle Gegenstoße gefahrlich werden. „In der Saison 2009/2010 entstanden 27% der aus dem Spiel heraus erzielten Treffer aus Kontern“ (Roxburgh & Turner, 2010, 58). Die Quote ist dadurch gesunken (von Werten nahe 40%), dass die Mannschaften bewusst versuchen die Konter zu unterbinden. Gegenangriffe werden oft aus dem zentralen Mittelfeld eingeleitet und durch flexible Angriffsformationen hochstvariabel ausgespielt (Tempodribblings, schnelle Kombinationen, Passe in die Tiefe). Beim Herausspielen von Torchancen bieten sich zwei Moglichkeiten: durch das Zentrum oder uber die Flugel. Viele schnelle, variable Kombinationen durch das Angriffszentrum und flexibles Kombinationsspiel unter extremen Druck selbst im Strafraum des Gegners kennzeichnen Angriffsbemuhungen. Der Trend geht zu langen Sicherungs- und Aufbauphasen. Dagegen stehen die Optionen über den Flugel mit diagonale Seitenwechsel, um aussichtsreiche 1-gegen-1-Situationen auf Außen vorzubereiten. Flexibles Kombinieren uber außen inklusive Einschaltens aus hinteren Positionen spielt immer noch eine wichtige Rolle, jedoch ist das Kombinationsspiel sowie Einzelaktionen von außen in den Strafraum hinein seit der WM 2010 neu. Dadurch verandert sich das Anforderungsprofil vom offensiven Außen: Er sollte sich gut im 1-gegen-1 durchsetzen können, als Torvorbereiter fungieren und gleichzeitig eigene Abschlussqualitaten aufweisen.
Die beschriebenen taktischen Veranderungen fuhren zu Veranderungen im positionsspezifischen Anforderungsprofil der Spieler und dazu, dass die Schnelligkeit im Leistungsfußball auf inter- nationeler Ebene immer wichtiger wird. Das kompakte Verschieben der Viererkette geschieht ebenso im hochsten Tempo, wie die Vorstoße der AV. Das schnelle Umschalten sowohl von Abwehr auf Angriff, als Konter, als auch von Angriff auf Abwehr erfordert intensive Lauf- und Sprintleistungen. Da sich das Spieltempo generell erhoht hat, werden alle Spielaktionen schneller ausgefuhrt. Dazu bedarf es Grundlagen der motorischen und informatorischen Schnelligkeit, die nun genauer betrachtet werden.
2.2.1 Motorische Schnelligkeit
Die motorische Schnelligkeit lässt sich in reine und komplexe Erscheinungsformen unterteilen (Grosser & Renner, 2007). Als „reine“ Formen der Schnelligkeit gelten Reaktions-, Aktions-, Frequenzschnelligkeit. Zu den „komplexe“ Formen zählen Schnellkraftausdauer, Schnellkraft und Sprintausdauer. Die folgende Abbildung veranschaulicht die motorische Schnelligkeit und ihre Erscheinungsformen, die im Anschluss genau erlautert werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7: Motorische Schnelligkeit und ihre Erscheinungsformen (mod. nach Grosser & Renner, 2007, 18)
„Reaktionsschnelligkeit ist die Fähigkeit, auf einen Reiz in kürzester Zeit zu reagieren“ (Weineck, 2010, 610). Sie gehürt zu den psychologisch-kognitiv-taktischen Leistungsfaktoren und damit zu der informatorischen Schnelligkeit (vgl. Kapitel 2.4). Grosser & Renner (2007) kommen in der obigen Abbildung bereits an dieser Stelle auf sie zu sprechen, daher soll sie auch hier beschrieben werden. Unterschiede werden einfache Reaktionen (bestimmte Reaktion auf einen bestimmten Reiz) von Auswahlreaktionen (situationsbedingte Reaktion auf einen Reiz). Die Zeitspanne vom Setzen eines Reizes bis zur adaquaten Muskelkontraktion wird als Reaktionszeit bezeichnet und ist der Indikator der Reaktionsschnelligkeit (Grosser & Renner, 2007, 17). Nach Zaciorskij (1992, 52) werden die einzelnen Phasen folgendermaßen beschrieben:
1. Auftreten der Erregung im Rezeptor,
2. Überführung der Erregung an das ZNS,
3. Bildung des effektorischen Signals,
4. Übertragung des Signals an den Muskel und
5. Reizung des Muskels mit Ausläsung einer mechanischen Aktivitat.
Farfel (1977) untergliedert die motorische Reaktion vereinfacht in die Vorbereitungsphase (Vorbereitungssignal bis zum reaktionsauslösenden Signal), die Latenzphase (Signalgebung bis Reaktionsbewegung) und die Ausfuhrungsphase (Zielabschnitt der Reaktionsbewegung). Die Reaktionszeiten (vgl. Abb. 8) sind je nach Reizwirkung unterschiedlich:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Reaktionszeiten bei motorischen Handlungen (Friedrich, 2007, 173)
Reaktionen auf optische Reize dauern langer als auf akustische Signale. Das liegt daran, dass die Lichtenergie in neuronale Impulse umgewandelt werden mussen und von der Netzhaut des Auges ins Gehirn geleitet werden. Dieser Vorgang benötigt mindestens 30ms langer als die Umwandlung von Schallenergie (Weineck, 2010, 641; Poppel & Poeppel, 1985, 51). Auswahlreaktionen benotigen mehr Zeit als Einfachreaktionen.
Bei der Aktionsschnelligkeit (oder auch: Bewegungsschnelligkeit, Sequenzschnelligkeit; vgl. Abb. 7) werden azyklischen Bewegungen mit hochster Geschwindigkeit gegen geringe Widerstande ausgefuhrt. Bei einem Krafteinsatz uber 30% wird von Schnellkraft und bei langerer Ausfuhrungsdauer von Schnellkraftausdauer gesprochen. ,,Die Fahigkeit, zyklische Bewegungen (= sich wiederholende gleiche Bewegungen) mit hochster Geschwindigkeit gegen geringe Widerstande auzufuhren“, wird Frequenzschnelligkeit genannt. Erfordern diese zyklischen Bewegungen einen Krafteinsatz uber 30%, trifft die Bezeichnung Schnellkraft zu. Werden sie langer anhaltend durchgefuhrt, ist die Rede von der Schnellkraftausdauer. Frequenzschnelligkeit (oder auch: Sprintschnelligkeit, Schnellkoordination) wird die Fahigkeit bezeichnet „zyklische Bewegungen (= sich wiederholende gleiche Bewegungen) mit hochster Geschwindigkeit gegen geringe Widerstande auszufuhren“ (Grosser & Renner, 2007, 18). Bei Krafteinsatz uber 30% handelt es sich um die Sprintkraft bzw. Antrittsschnelligkeit und bei langerer Dauer um Sprintausdauer (Bindeglied zwischen Ausdauer und Schnelligkeit) (Grosser & Renner, 2007, 17ff). Die Antrittsschnelligkeit ist von einem hochgradigem Beschleunigungsvermögen geprägt, welches vom Kraftniveau des Sportlers und vom azyklischen „Zeitprogramm“ (neuromuskulärer Steuer- und Regelprozess) abhangt (Weineck, 2010, 648). Ein entscheidender Faktor fär die Antrittsschnelligkeit ist die Zusammensetzung der Muskeln aus verschiedenen Muskelfasern. Sie weisen Unterschiede hinsichtlich der Kontraktionsgeschwindigkeiten sowie der Ermudungs- resistenz auf. Es differenzieren sich folgende Muskelfasertypen aus (Weineck, 2002; Hohmann et al., 2007; Scheid & Prohl, 2007):
- Typ-I: ST-Fasern = rote langsame Fasern mit hoher Ermudungsresistenz
- Typ-I la: FTO-Fasern = weiße schnelle Fasern mit hoher Ermudungsresistenz
- Typ-I Id: FTG-Fasern = weiße schnelle Fasern, die schnell ermuden
- Typ-IIc: Intermediarfasern sind zwischen Typ I und II einzuordnen.
Entscheidend fur die schnellen Antritte sind demnach die Typ-II-Fasern. „Sie kontrahieren schneller als die roten Fasern, ermuden aber auch eher“ (Scheid & Prohl, 2007, 62). Die Verteilung der Muskelfasern ist genetisch festgelegt. Eine Umwandlung von langsamen zu schnellen Fasern ist nicht möglich. Wohingegen schnelle Fasern durch langfristiges Ausdauertraining dauerhaft in langsame ST-Fasern umgewandelt werden konnen (Steinacker et al., 2002; Hohmann et al., 2007). Die Sprintausdauer hangt wesentlich von der Fahigkeit des Korpers ab, muskulare Energievorrate schnell aufzufullen (vgl. Kapitel 2.1.2).
Die konditionellen Fahigkeiten Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander und treten als sportspezifische Anforderung oft in Kombination auf (z.B. Schnellkraft, Schnelligkeitsausdauer):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9: Modell zur Beziehung zwischen den konditionellen Fähigkeiten Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer (mod. nach Steinhofer, 2003)
Das Modell zur Beziehung zwischen den konditionellen Fähigkeiten von Steinhöfer (2003) zeigt, dass die einzelnen Komponenten nie isoliert, sondern immer im Verbund miteinander wirken. Je nach sportlicher Anforderung öberwiegt die Ausprögung einer Komponente. Die Bedeutung der einzelnen Komponenten im Sportspiel Fußball wird nun dargestellt.
Bedeutung im Fußball
Im Fußball sind komplexe Reaktionen typisch. Hierzu gehören Teil- oder Ganzkörperbewegungen. Die Reaktionsfahigkeit wird zum Beispiel beim schnellen Starten in freie Raume, beim Fintieren und Reagieren auf Finten, beim Tackling, beim blitzschnellen Folgen des Gegenspielers und beim Sichlosen vom Gegner benötigt (Weineck, 2004, 390). Hinzu kommen alle unerwartet auftretenden Situationen, auf die der Spieler schnell reagieren und handeln muss. För die Torspieler hat das schnelle Reagieren und Handeln eine besondere Bedeutung. Bei einem Torschuss muss er in wenigen Sekunden die Ballrichtung erkennen und dementsprechend reagieren und handeln. Die Aktionsschnelligkeit (bei azyklischen Bewegungen) mit Ball zeichnet sich dadurch aus wie schnell er den Ball an- und mitnehmen kann, wie schnell sein Dribblingverhalten bei Raum- und Gegnerdruck ist und wie genau er passen oder schießen kann. Die Schnelligkeit ist dabei genauso wichtig wie die Genauigkeit. Mit zunehmender Schnelligkeit sollte die Genauigkeit nicht darunter leiden. Viele Antritte und Sprints kennzeichnen den modernen Fußball, daher ist die Antrittsschnelligkeit eine der wichtigsten konditionellen Eigenschaften im Fußball. Sie ist fur schnelles Freilaufverhalten, (Jberlaufen des Gegners, schnelle Dribblings sowie fur zahlreiche Antritte (zum Ball, aus unterschiedlicher Startposition, auf unterschiedliche Startsignale, mit Richtungswechsel) erforderlich. Auch fur das Durchsetzungsvermögen bzw. die Zweikampfstörke und -effektivitat ist sie mitentscheidend (Weineck, 2004, 400).
Im Idealfall konnen die Fußballer wahrend des gesamten Spiels mehrere maximale Sprints absolvieren und verfögen uber eine gut trainierte Sprintausdauer. Sie höngt von der Erho- lungsfahigkeit des Spielers ab. Diese wiederum vom Muskeltyp und von den muskularen Ener- gievorraten. Auch das Niveau der Grundlagenausdauer beeinflusst die Erholung. Besondere Bedeutung kommt der Antrittsschnelligkeit bei Standardsituationen zu. Etwa 30% der Tore werden im direkten Anschluss an Stardardsituationen erzielt (Loy, 1991). Ist ein Spieler durch einen explosiven Antritt eher als der Gegner am Ball, kann dies uber Erfolg der Angriffsoder Abwehraktion entscheiden. Die Schnelligkeitsausdauer spielt fur den Fußballer eine untergeordnete Rolle, da die meisten Sprints im Bereich unter 10 Meter liegen. Die Schnellkraft manifestiert sich in der Schusskraft, der Sprungkraft sowie der Wurfkraft bei den Einwurfen (oder Abwurfen des Torspielers) (Weineck, 2004).
Die informatorische Schnelligkeit wird nun im Kapitel 2.2.2 erlautert.
2.2.2 Informatorische Schnelligkeit
Für schnelles Handeln ist die schnelle Wahrnehmung einen Grundvorausetztung. Lottermann (2005) beschreibt folgende Prozesse, die die taktische Spielfahigkeit eines Spielers maßgeblich beeinflussen: Erstens „Information aus dem laufenden Spiel aufnehmen“, zweitens „sie müg- lichst schnell verarbeiten“ und drittens „in eine motorische Handlung umsetzen“ (Lottermann, 2005). Bereits hier wird deutlich, dass die Wahrnehmung der Spielsituation ganz entscheidend für die Handlungsschnelligkeit ist. Die informatorische Schnelligkeit umfasst daher die Wahrnehmungsschnelligkeit (WS), Antizipationsschnelligkeit (AS) und Entscheidungsschnelligkeit (ES).
„Die Fahigkeit zur Wahrnehmung von Spielsituationen und ihrer Veründerungen in müglichst kurzer Zeit, wird als WS bezeichnet. Unter AS versteht Weineck die Fahigkeit zur geistigen Vorwegnahme der Spielentwicklung und insbesondere des Verhaltens des direkten Gegenspielers in möglichst kurzer Zeit. Die ES außert sich in der Fahigkeit, sich in kurzester Zeit fur eine der potentiell moglichen Handlungen zu entscheiden“ (Weineck, 2004, 377).
Sie sind alle eng miteinander verbunden und bilden den Komplex der psychischen Handlungsregulation. Folgende Komponenten lassen sich diesbezuglich vereinfacht darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 10: Prozess von der Informationsaufnahme bis zur Handlungsausführung (Eigene Darstellung in Anlehnung an Konzag, Krug & Lau, 1988)
Das von der Spielsituation (Umwelt) ausgehende Signal muss vom Spieler wahrgenommen und anschließend einer Bedeutung zugeordnet (Identifikation der Nachricht) werden. Die Information wird mit den im Gedachtnis gespeicherten Inhalten verglichen und eine Hypothese generiert. Dieser letzte Schritt wird auch als Antizipation bezeichnet. Im Anschluss kommt es zur Entscheidungsbildung, hier mussen Handlungsziel und Handlungsprogramm aufeinander abgestimmt werden, sodass die Handlung schließlich ausgefuhrt werden kann. Eine Handlung oder eine Entscheidung kann nur getroffen werden, wenn zuvor die visuell aufgenommene Informationen eindeutig sind, denn diese bilden die Grundlage fur die Handlungsentscheidung. Wird zum Beispiel die Position des Gegners nicht richtig erkannt, so kann es zu einem Fehlpass kommen, da die zur Handlungsentscheidung gefuhrten Informationen nicht richtig waren. Schwierig wird es wenn der ballführende Spieler durch Gegnerdruck die Umgebung wahrnehmen muss und dementsprechend schnellstmüglich entscheiden soll. Die Bedeutung der informatorischen Schnelligkeit im Fußball soll nun nüher betrachtet werden.
Bedeutung im Fußball
Aus einer Vielzahl an verschiedenen Informationen muss ein Spieler schnellstmüglich die wichtigsten herausfiltern. Dabei handelt es sich vorallem um optische und akustische Reize. Die qualitative Auspragung der Sinnesorgane ist genetisch bedingt und nicht trainierbar. Die durch Training oder Erfahrung gewonnene „Spielintelligenz“ jedoch ist hilfreich, um die spielrelevanten Informationen von den unwichtigen zu unterscheiden. Die visuelle Verarbeitung dynamischer Reize ist bei höchstqualifizierten Fußballspielern hochentwickelt (Weineck, 2004, 380). Somit kann die Ballrichtung und -geschwindigkeit in kürzester Zeit ermittelt werden. Schnell wahrnehmende Spieler benotigen (bis zur Entscheidung) nur ein bis zwei Blicke, wohingegen langsame hierfür sechs bis zehn Blicke. In Anbetracht der Tatsache, dass jeder Blick etwa 0,1 bis 0,2 Sekunden in Anspruch nimmt, ist hier schon ein Unterschied zu erkennen. Die visuelle Wahrnehmung im Sport allgemein ist entscheidend für die Bildung einer Orientierungsgrundlage als Raumwahrnehmung, für die Kontrolle von Eigenbewegungen als Bewegungswahrnehmung und für die Antizipation von Fremdbewegung als Grundlage für Entscheidungen und Voraussetzung für eigenes Handeln. Gesichtsfeld ist der Teil der visuellen Umwelt, der bei fixierter Blickachse wahrgenommen wird. Es umfasst vertikal ca. 130 Grad, horizontal ca. 180 bis 200 Grad.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 11: Vertikales und horizontales Gesichtsfeld beim Menschen (Platen, 2009)
Also kann ein Spieler auch Gegner bzw. Mitspieler erkennen, die sich leicht hinter ihm befinden. Zentrales (foveales) und peripheres Sehen sind beides Teile des wahrgenommenen Gesichtsfeldes. Zentrales Sehen entspricht der visuellen Wahrnehmung auf der Fovea centralis (Stelle des schärfsten Sehens auf der Netzhaut) und deckt einen Sehwinkel von ca. 2 Grad ab. Der übrige Teil der Netzhaut, die Netzhautperipherie entspricht dem peripheren Sehen (Schober, 1957). Aufmerksamkeit und der psychische Anspannungszustand spielen neben der kognitiven Leistungsfahigkeit eine wichtige Rolle. Dies wird deutlich bei der Betrachtung von technischtaktischen Fehlverhalten aufgrund von zu starker Aufgeregtheit und dem damit verbundenen Stresshormonanstieg.
Die Spielerfahrung ermüglicht es dem Spieler die über seine WS aufgenommene Informationen schneller auswerten zu kännen. Durch die geistige Vorwegnahme der sich entwickelnden Spielsituation, hat er mehr Zeit um sich auf diese einzustellen. Dies verschafft ihm möglicherweise einen Vorteil, welcher sich bei Stürmern im sogenannten „Torinstinkt“ manifestiert. Die Anforderungen an die Antizipation im Sportspiel beziehen sich nach Konzag et al. (1988) auf Fremdbewegungen und Eigenbewegungen. Ersteres zeichnet sich durch die Ziel- und Programmantizipation der mäglichen Spielhandlungen von Mitspielern und Gegnern sowie des Balles aus. Besondere Bedeutung kommt der AS bei der Reaktion des Torspielers beim Elfmeter zu. Die Stellung es Standfußes (vom Elfmeterschützen) kann dem Torspieler mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schussrichtung verraten. Die Genauigkeit seiner Beobachtungen und das schnelle Ablaufen kognitiver Prozesse erhohen die Abwehrchancen des Torspielers.
Nachdem die aktuelle Spielsituation wahrgenommen wurde, muss die Entscheidung für einen bestimmten Handlungsvollzug fallen. Wird diese Entscheidung nicht getroffen, bleibt es bei der bloßen Beobachtung der Situation - der Spieler greift aber nicht ins Spielgeschehen ein. Auch hier spielt die Erfahrung des Spielers eine Rolle, insofern dass Entscheidungsalternativen eingegrenzt werden und sich dadurch der Entscheidungsprozess verkurzt. „Je umfangreicher der Entscheidungskomplex ist, desto langer dauert der Entscheidungsprozess“ (Weineck, 2004, 384). Welche Entscheidung getroffen wird, hangt auch von der individuellen Disposition ab. Es gibt dementsprechend „entscheidungsfreudige“ Spielertypen und Spieler, die „sich nicht entscheiden künnen“. Die Fahigkeit zur schnellen Verarbeitung gilt als genetisch bedingt, kann aber durch gezieltes Training verbessert werden. Die Informationsverarbeitung (Interpretation und Entscheidung) wird auch als „Denkzeit“ bezeichnet. Die geistige Schnelligkeit nimmt etwa 7080% des Zeitbedarfs für die Lüsung technotaktischer Aufgaben in Anspruch (Friedrich, 2007, 172). Die motorische Ausführung mit etwa 10-20% sowie 20-30% fur die Wahrnehmung sind im Vergleich dazu gering. Untersuchungen von Torschusshandlungen zeigen, dass die Spanne von der Signalerkennung bis zum Handlungsabschluss zwischen 1,55 und 3,75 Sekunden betrügt. Das ergibt eine Differenz von 2,2 Sekunden (Lottermann, 2005).
„Zwischen der Handlungszeit bei Aufgaben ohne und mit Entscheidungsanforderungen bestehen in allen Altersklassen hoch signifikante Unterschiede. Das bedeutet, dass Zielhandlungen mit Entscheidungsanforderungen zu ihrer Realisierung aufgrund der komplizierten Anforderungen an Wahrnehmungs- und Denkprozesse wesentlich langere Zeiten beanspruchen.“ (Weineck, 2004, 389)
Die Entscheidungsbildung im Rahmen der Gesamthandlung nimmt einen hohen Zeitanteil in Anspruch. Aus taktischen Gründen kann sich ein Spieler bei identischen Situationen unterschiedlich entscheiden. Damit versucht er den Gegenspieler in die Irre zu führen. Auffallig ist auch, dass die Entscheidungen überwiegend unter Zeitdruck gefallt werden.
Die nun folgende Schnelligkeitsdiagnostik ist der dritte Punkt im Kapitel der theoretischen Grundlagen.
[...]
- Quote paper
- Marc Wörle (Author), 2011, Überprüfung von Testverfahren zur Messung der fußballspezifischen Handlungsschnelligkeit mit komplexer Auswahlreaktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212625