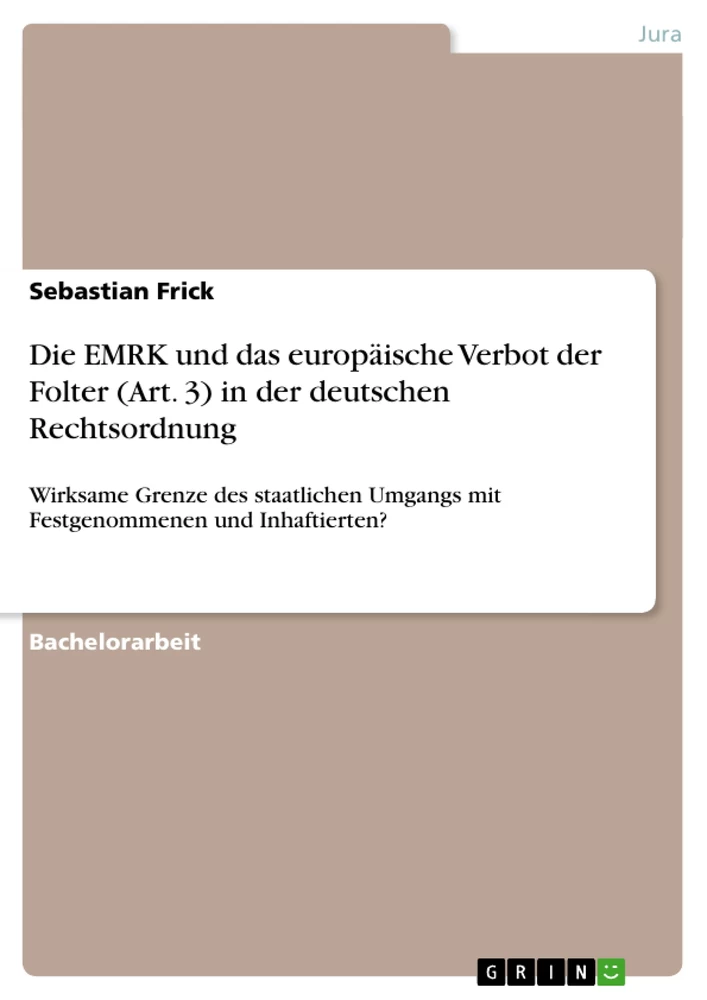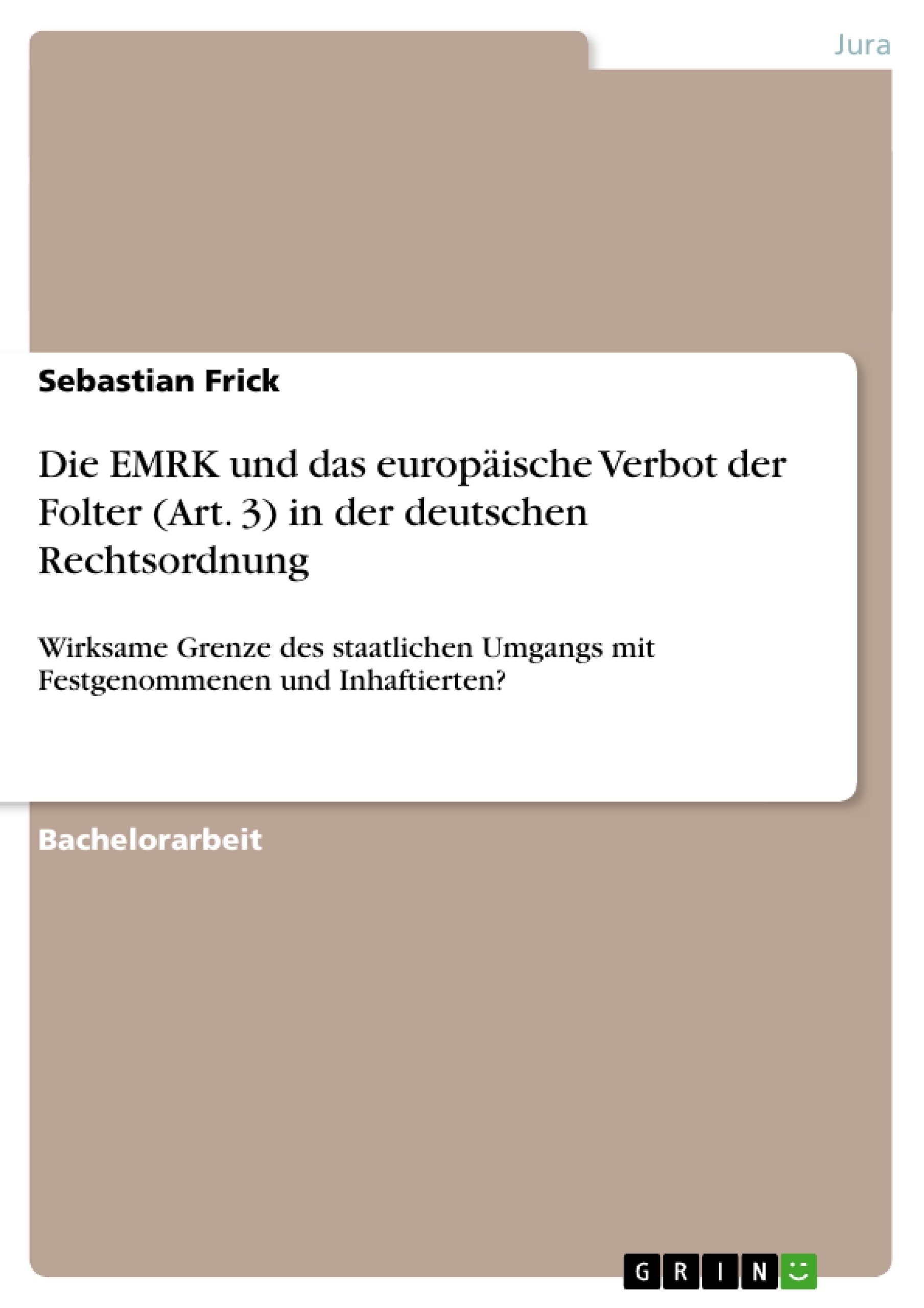Die Existenz von Folter ist bekannt, jedoch sieht man sich in Deutschland nicht damit konfrontiert. Sollte das Verbot der Folter somit nicht als Selbstverständnis Einzug in die europäischen Gesellschaften erhalten?
Ein Fall, der sich im Jahre 2002 in Frankfurt am Main abgespielt hat, zeigte, dass dieses Selbstverständnis eben nicht existiert und auch nicht immer angenommen werden kann. Schnell ist zu erkennen, dass die Vorwürfe gegen das Frankfurter Polizeipräsidium keinen Einzelfall darstellen. In den letzten Jahren sahen sich Behörden in vielen anderen europäischen Staaten ähnlichen Foltervorwürfen gegenüber.
Das eben noch als existenzieller Bestandteil der Werteordnung angesehene Verbot der Folter gerät ins Wanken. Es besteht die Gefahr, dass es unterwandert wird. Eine Ächtung der Folter ausschließlich auf moralischer Ebene ist als unrealistisch und unwirksam anzusehen.
Der Europarat hat dies bereits nach dem 2. Weltkrieg erkannt. Mit der Verabschiedung der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten,2 kurz EMRK im Jahre 1950, wurde der Folter auf der europäischen, völkerrechtlichen Ebene ihre Legitimität entzogen. Seither unterliegen Folter und ähnliche Handlungen dem europäischen Verbot der Folter aus Art. 3 EMRK.
Eben dieser Art. 3 ist der elementare Gegenstand dieser Arbeit. Sowohl die EMRK als auch die Inhalte, die Charakteristik und die Auswirkungen des Art. 3 werden beleuchtet. Dies soll mittels einer umfassenden Betrachtung geschehen, in der verschiedene Wirkungsweisen des Art. 3 aufgezeigt werden. Anhand dieser wird dann beurteilt, ob die EMRK und Art. 3 getreu dem Titel dieser Arbeit eine wirksame Grenze des staatlichen Umgangs mit Festgenommenen und Inhaftierten darstellen.
Zuerst wird untersucht, ob die EMRK als Instrument im Völkerrecht die geeigneten Voraussetzungen für die Durchsetzung des Verbots der Folter schafft (Kap. 2). Nachdem die Inhalte des Art. 3 thematisiert wurden (Kap. 3) werden dann zwei spezielle Einflussfaktoren des Art. 3 analysiert: Die Verurteilungen Deutschlands durch den EGMR (Kap. 4) und die Fallgruppe der Inhaftierten (Kap. 5).
Ziel der Arbeit ist es nicht, die einzelnen Faktoren (bspw. die „Rettungsfolter“3) vollständig zu beurteilen, sondern eben die angesprochenen verschiedenen Wirkungsweisen des Art. 3 aufzuzeigen.
An drei Stellen der Arbeit wird anhand von kurzen Resümees beurteilt, welche verschiedenen Auswirkungen das europäische Verbot der Folter zur Folge hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)
- 2.1 Allgemeines zur EMRK
- 2.2 Die EMRK als Teil des allgemeinen Völkerrechts
- 2.3 Die EMRK und das Recht der Europäischen Union
- 2.4 Die EMRK in den nationalen Rechtsordnungen
- 2.4.1 Die Rechtslage in Deutschland
- 2.4.2 Rechtskraftwirkung der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)
- 2.5 Einschub 1: Die EMRK und der EGMR - Zwei wirksame Instrumente?
- 3 Das europäische Verbot der Folter
- 3.1 Historischer Kontext
- 3.2 Artikel 3 EMRK
- 3.2.1 Allgemeines
- 3.2.2 Der Schutzbereich von Artikel 3
- 3.2.3 Der absolute Charakter von Artikel 3
- 3.3 Weitere völkerrechtliche Folterverbote
- 4 Entscheidungen des EGMR
- 4.1 Rechtssachen, in denen Deutschland eine Verletzung des Artikel 3 nachgewiesen wurde
- 4.2 Rechtssache Jalloh /. Deutschland
- 4.3 Rechtssache Gäfgen /. Deutschland
- 4.3.1 Das Verfahren vor dem EGMR
- 4.3.2 Die Debatte um die „Rettungsfolter“ als Auswirkung des Urteils
- 4.4 Einschub 2: Die Urteile des EGMR - Wirksame Grenze des staatlichen Umgangs mit Festgenommenen in Polizeiverhören?
- 5 Umgang mit Inhaftierten in deutschen Haftanstalten
- 5.1 Allgemeines zur Behandlung Inhaftierter
- 5.2 Das Europäische Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (EPCT) und der Europäische Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT)
- 5.3 Einschub 3: Artikel 3 und das CPT - Wirksame Grenze des staatlichen Umgangs mit Inhaftierten?
- 6 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Wirksamkeit des Verbots der Folter nach Artikel 3 EMRK in der deutschen Rechtsordnung im Umgang mit Festgenommenen und Inhaftierten. Ziel ist es, die praktische Anwendung und die Grenzen dieses Verbots zu analysieren.
- Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und ihr Stellenwert im deutschen Recht
- Artikel 3 EMRK und sein absoluter Charakter
- Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zu Foltervorwürfen gegen Deutschland
- Der Umgang mit Inhaftierten in deutschen Haftanstalten im Lichte des Folterverbots
- Die Rolle des Europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter (CPT)
Zusammenfassung der Kapitel
2 Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK): Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die EMRK, beleuchtet ihren Stellenwert im Völkerrecht und im Verhältnis zum EU-Recht sowie ihre Umsetzung in der deutschen Rechtsordnung. Es wird die Bedeutung der Rechtskraft der EGMR-Entscheidungen betont und die Frage der Effektivität der EMRK und des EGMR als Instrumente zum Schutz der Menschenrechte diskutiert. Der Fokus liegt auf der Integration der EMRK in das deutsche Rechtssystem und der Bedeutung ihrer Anwendung in konkreten Fällen.
3 Das europäische Verbot der Folter: Das Kapitel behandelt das europäische Folterverbot, setzt es in einen historischen Kontext und analysiert detailliert Artikel 3 EMRK. Es erklärt dessen Schutzbereich, seinen absoluten Charakter und die Unzulässigkeit jeglicher Ausnahmen. Darüber hinaus werden weitere völkerrechtliche Folterverbote betrachtet und in Relation zu Artikel 3 EMRK gesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf der Definition von Folter und der Begründung des absoluten Schutzes nach Artikel 3.
4 Entscheidungen des EGMR: Dieser Abschnitt analysiert Entscheidungen des EGMR, in denen Deutschland eine Verletzung von Artikel 3 vorgeworfen wurde. Die Rechtssachen Jalloh und Gäfgen werden im Detail untersucht, wobei das Verfahren vor dem EGMR, die Argumente der Parteien und die Urteilsbegründung beleuchtet werden. Die Diskussion über "Rettungsfolter" im Zusammenhang mit dem Urteil Gäfgen wird ebenfalls eingehend behandelt. Der Fokus liegt auf der Rechtsprechung des EGMR als maßgebliche Interpretationsinstanz von Artikel 3 EMRK und ihrer Auswirkungen auf die deutsche Praxis.
5 Umgang mit Inhaftierten in deutschen Haftanstalten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Behandlung von Inhaftierten in deutschen Gefängnissen. Es beschreibt die allgemeinen Bedingungen und analysiert den Einfluss des Europäischen Übereinkommens zur Verhütung von Folter (EPCT) und die Arbeit des Europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter (CPT). Die Relevanz von Artikel 3 EMRK im Kontext der Haftbedingungen wird diskutiert und die Effektivität staatlicher Maßnahmen zur Verhinderung von Folter und unmenschlicher Behandlung hinterfragt. Der Schwerpunkt liegt auf der Prävention von Menschenrechtsverletzungen in Haftanstalten.
Schlüsselwörter
EMRK, Artikel 3 EMRK, Folterverbot, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Menschenrechte, Deutschland, Rechtsordnung, Inhaftierte, Festgenommene, CPT, Rechtssache Jalloh, Rechtssache Gäfgen, Rettungsfolter, Völkerrecht, EU-Recht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Wirksamkeit des Folterverbots nach Artikel 3 EMRK in der deutschen Rechtsordnung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit des Verbots der Folter nach Artikel 3 EMRK im deutschen Rechtssystem im Umgang mit Festgenommenen und Inhaftierten. Analysiert werden die praktische Anwendung und die Grenzen dieses Verbots.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und ihren Stellenwert im deutschen Recht, Artikel 3 EMRK und seinen absoluten Charakter, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zu Foltervorwürfen gegen Deutschland, den Umgang mit Inhaftierten in deutschen Haftanstalten im Lichte des Folterverbots und die Rolle des Europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter (CPT).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), Das europäische Verbot der Folter, Entscheidungen des EGMR, Umgang mit Inhaftierten in deutschen Haftanstalten und Schlusswort. Jedes Kapitel enthält Unterkapitel mit detaillierten Analysen.
Wie wird die EMRK in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die EMRK, beleuchtet ihren Stellenwert im Völkerrecht und im Verhältnis zum EU-Recht sowie ihre Umsetzung in der deutschen Rechtsordnung. Es wird die Bedeutung der Rechtskraft der EGMR-Entscheidungen betont.
Welche Rolle spielt Artikel 3 EMRK?
Artikel 3 EMRK, das europäische Folterverbot, steht im Mittelpunkt der Arbeit. Der absolute Charakter dieses Artikels, sein Schutzbereich und seine Bedeutung in der Praxis werden detailliert analysiert.
Welche Entscheidungen des EGMR werden untersucht?
Die Arbeit analysiert relevante Entscheidungen des EGMR, in denen Deutschland eine Verletzung von Artikel 3 vorgeworfen wurde, insbesondere die Rechtssachen Jalloh und Gäfgen. Das Verfahren vor dem EGMR, die Argumente der Parteien und die Urteilsbegründung werden beleuchtet.
Wie wird der Umgang mit Inhaftierten in deutschen Haftanstalten betrachtet?
Die Arbeit befasst sich mit der Behandlung von Inhaftierten in deutschen Gefängnissen, analysiert den Einfluss des Europäischen Übereinkommens zur Verhütung von Folter (EPCT) und die Arbeit des CPT. Die Relevanz von Artikel 3 EMRK im Kontext der Haftbedingungen und die Effektivität staatlicher Maßnahmen zur Verhinderung von Folter werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: EMRK, Artikel 3 EMRK, Folterverbot, EGMR, Menschenrechte, Deutschland, Rechtsordnung, Inhaftierte, Festgenommene, CPT, Rechtssache Jalloh, Rechtssache Gäfgen, Rettungsfolter, Völkerrecht, EU-Recht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die praktische Anwendung und die Grenzen des Folterverbots nach Artikel 3 EMRK in der deutschen Rechtsordnung im Umgang mit Festgenommenen und Inhaftierten.
- Quote paper
- Sebastian Frick (Author), 2012, Die EMRK und das europäische Verbot der Folter (Art. 3) in der deutschen Rechtsordnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212535