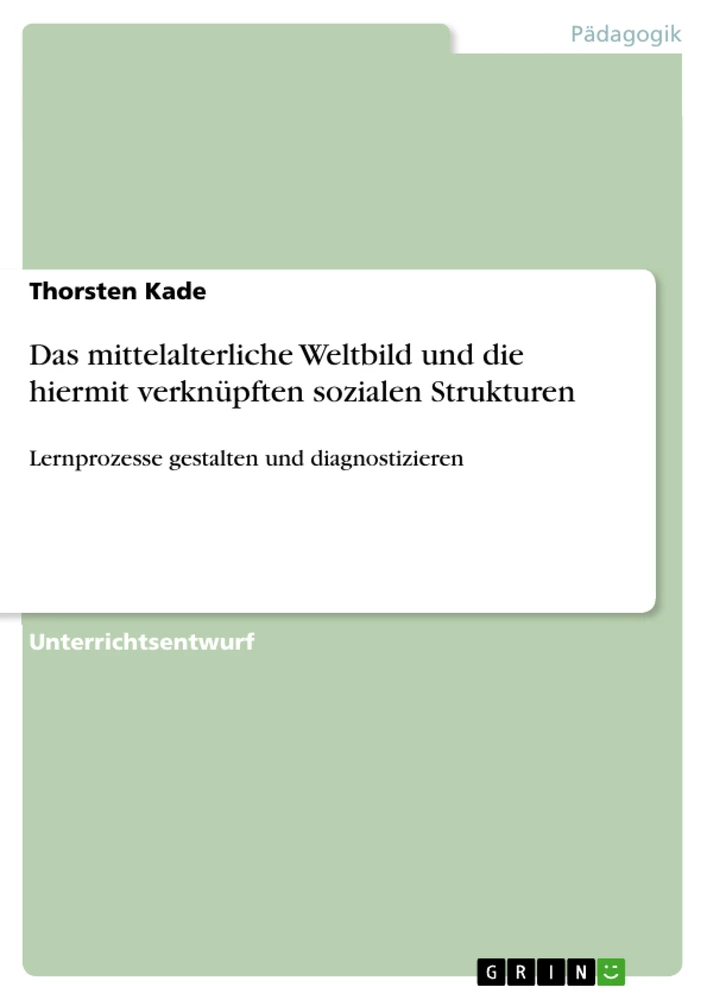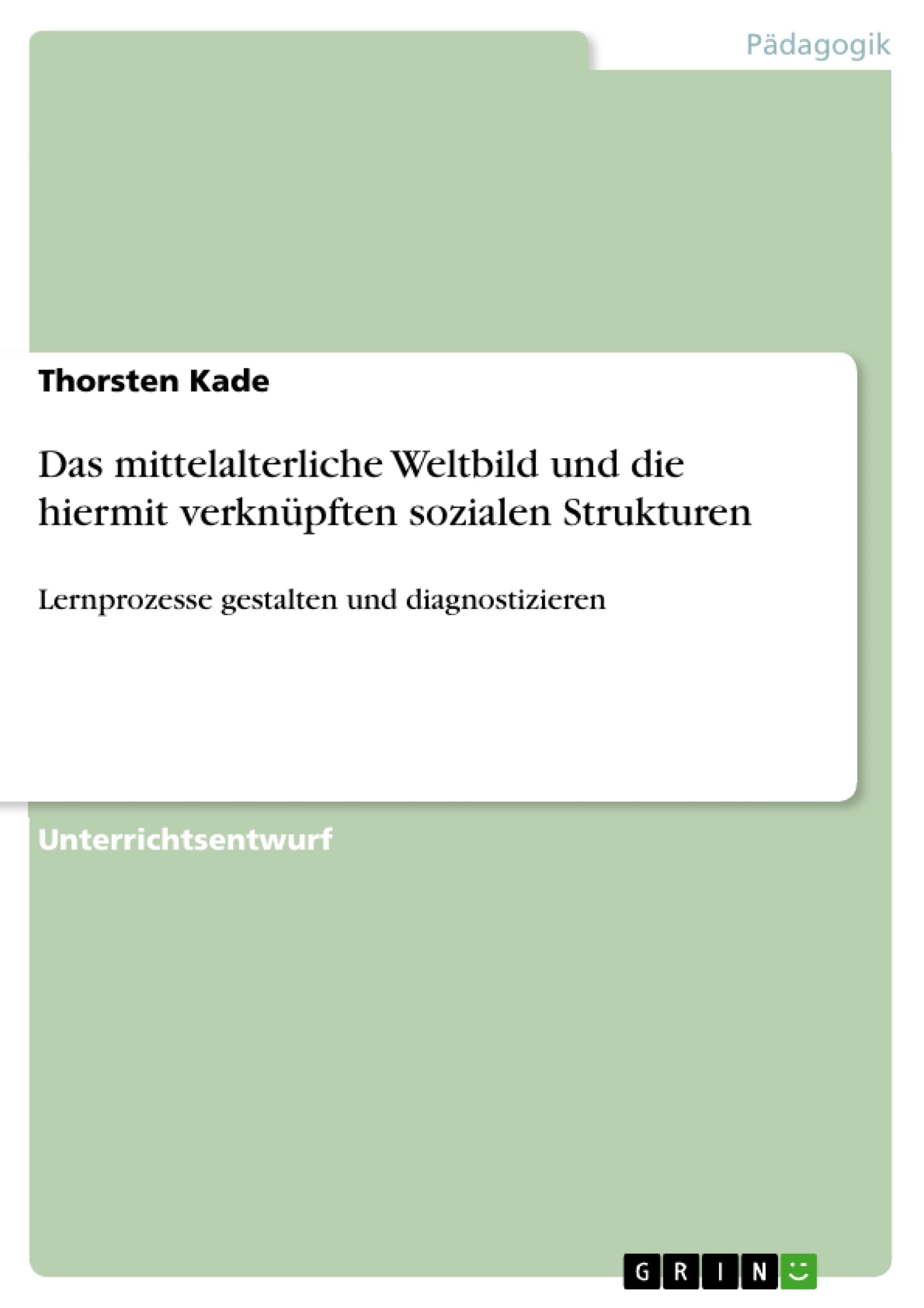Themenblock „Lernen“: Konstruktivismus und behavioristische Sichtweise
Die Form, in welcher eine konstruktivistisch ausgerichtete Lehrperson unterrichtet, unter-scheidet sich innerhalb ihrer Grundannahmen gegenüber der behavioristischen Sichtweise. In dem Fall der in Aufgaben Teil 1 skizzierten Unterrichtsstunde wird deutlich, dass das Verhal-ten und Lernen der Schüler nur begleitet werden soll. Die Lehrperson übernimmt hier nur einen Moderatorenrolle und gibt den Schülern die Möglichkeit ihren Lernweg weitestgehend eigenständig zu planen und durchzuführen. Hierbei ist die Rolle des Lehrers eine passive. Er steht für Rückfragen bereit und gibt Hilfestellungen bei Problemen, die innerhalb der Gruppe nicht gelöst werden können (vgl. Pörksen 2011, S. 463-484). Dieses Vorgehen erfordert eine gute Planung des Unterrichts, da der Verlauf nicht immer abzusehen ist. Der Lehrkörper ist hier mit entsprechenden Vorbereitungen und Nachbereitungen beschäftigt, um einen rei-bungslosen Ablauf zu gewährleisten. Zudem ist in vielen Situationen Feingefühl gefordert, da Schüler, welche sich im Lernprozess befinden, oft zu früh um Unterstützung und Hilfe bitte um sich die Arbeit zu erleichtern. Dies hängt mit der Selbstbestimmungstheorie zusammen und das Verhalten ist hier von jedem Schüler anders. Das Auftreten ist hierbei an die Ent-wicklung und die bereits erreichte Stufe der Selbstbestimmung geknüpft (vgl. Deci/Ryan 1993, S. 223). Eine Reflektion des Schülerverhaltens sollte hier direkt durch den Lehrer erfol-gen um eine bestmögliche Entwicklungschance zu wahren und dem Schüler gegenüber sein Verhalten offen zulegen. Diesem gegenüber steht die behavioristische Sichtweise. Die Vertre-ter gehen hierbei davon, das jedes Handeln eine Reaktion auf Reize ist (vgl Straka 2002, S. 57-67). So lässt sich die Reaktion oder das Verhalten der Schüler schon vorher erkennen, wenn man die einzelnen Parameter kennt. Die Handlungen werden also rein auf das Schema, der Reize und der Reaktion darauf, heruntergebrochen. Dies würde zu einer starken Vereinfa-chung des Lehrens führen, da Unterrichtseinheiten strikt geplant werden könnten und es wäre so möglich dieses exakt genauso umzusetzen. Parameter die sich durch die Tagesform oder individuelle Situationen ergeben werden ausgeblendet und von diesem theoretischen Ansatz nicht miteinbezogen.
Inhaltsverzeichnis
- I1. Unterrichtsentwurf
- 2. Erläuterung zur Unterrichtsplanung
- 2.1 Begründung der Themenwahl
- 2.2 Angestrebte Kompetenzentwicklungen
- 2.3 Vorarbeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Gestaltung und Diagnose von Lernprozessen im Fach Geschichte mit dem Fokus auf das mittelalterliche Weltbild und die damit verbundenen sozialen Strukturen. Die Arbeit präsentiert einen detaillierten Unterrichtsentwurf für eine 7. Klasse, der das Thema anschaulich und interaktiv behandelt.
- Aktivierung des Vorwissens und Einbezug verschiedener Lernperspektiven
- Entwicklung von Kompetenzen im Bereich des kognitiven und sozialen Konstruktivismus
- Förderung von Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und intrapersonellem Lernen
- Anwendung kooperativer Lernformen zur Erarbeitung und Vertiefung des Themas
- Integration von Quellenmaterial und Reflexionsaktivitäten
Zusammenfassung der Kapitel
I1. Unterrichtsentwurf
Der Unterrichtsentwurf umfasst einen Einstieg, einen Hauptteil und einen Schluss. Im Einstieg wird das Vorwissen der Schüler zum Thema „Mittelalter“ aktiviert und durch eine gemeinsame Diskussion gefestigt. Der Hauptteil fokussiert auf die Erarbeitung der Lebenswirklichkeit verschiedener Personen im Mittelalter durch die Analyse von Quellenmaterial in Gruppenarbeit. Im Schluss reflektieren die Schüler den Stundeninhalt und festigen das Gelernte durch eine Hausaufgabe.
2. Erläuterung zur Unterrichtsplanung
2.1 Begründung der Themenwahl
Die Unterrichtseinheit widmet sich der mittelalterlichen Ständegesellschaft als zentralen Bestandteil des Themenfeldes „Europa im Mittelalter“. Sie vermittelt ein tieferes Verständnis der Lebenswirklichkeit der verschiedenen Stände und fördert den Perspektivwechsel auf die damalige Gesellschaft.
2.2 Angestrebte Kompetenzentwicklungen
Der Entwurf fördert eine Vielzahl von Kompetenzen, darunter die Aktivierung des Vorwissens, die selbstständige Auseinandersetzung mit dem Thema, die Entwicklung von Teamfähigkeit und Kooperationsfähigkeit sowie die Anwendung von kollaborativen Lernformen. Die Verwendung verschiedener Quellenmaterialien zielt auf die Berücksichtigung unterschiedlicher Lerntypen ab.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenfeldern „Mittelalterliche Ständegesellschaft“, „Europa im Mittelalter“, „Lernprozesse gestalten“, „Kognitiver Konstruktivismus“, „Sozialer Konstruktivismus“, „Kooperative Lernformen“, „Quellenanalyse“, „Teamfähigkeit“ und „Perspektivwechsel“.
- Quote paper
- Thorsten Kade (Author), 2013, Das mittelalterliche Weltbild und die hiermit verknüpften sozialen Strukturen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212483