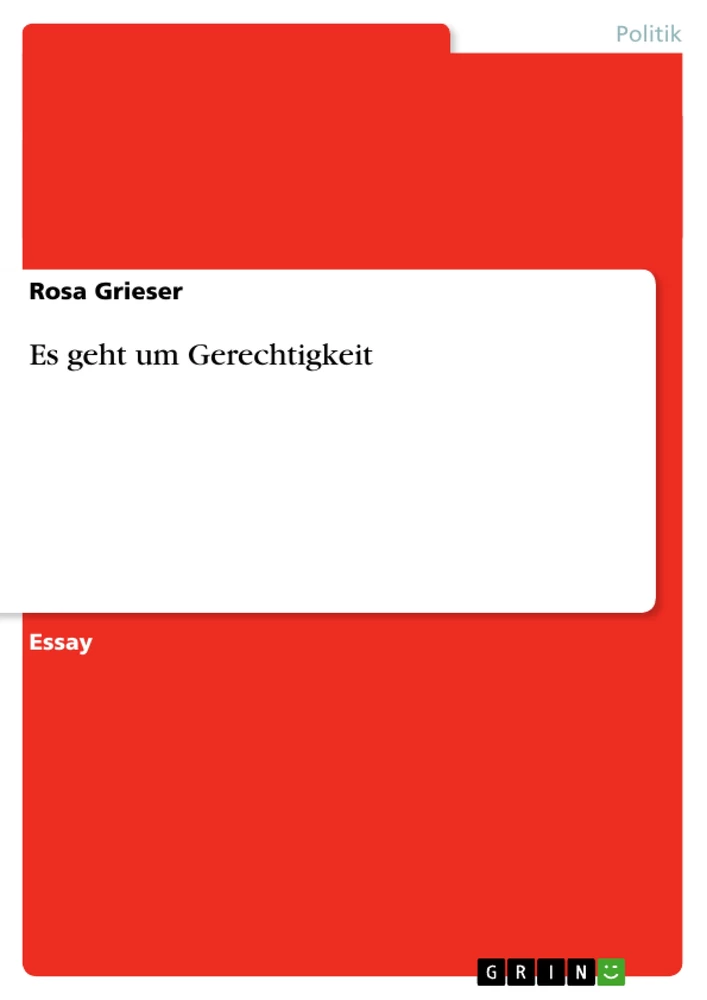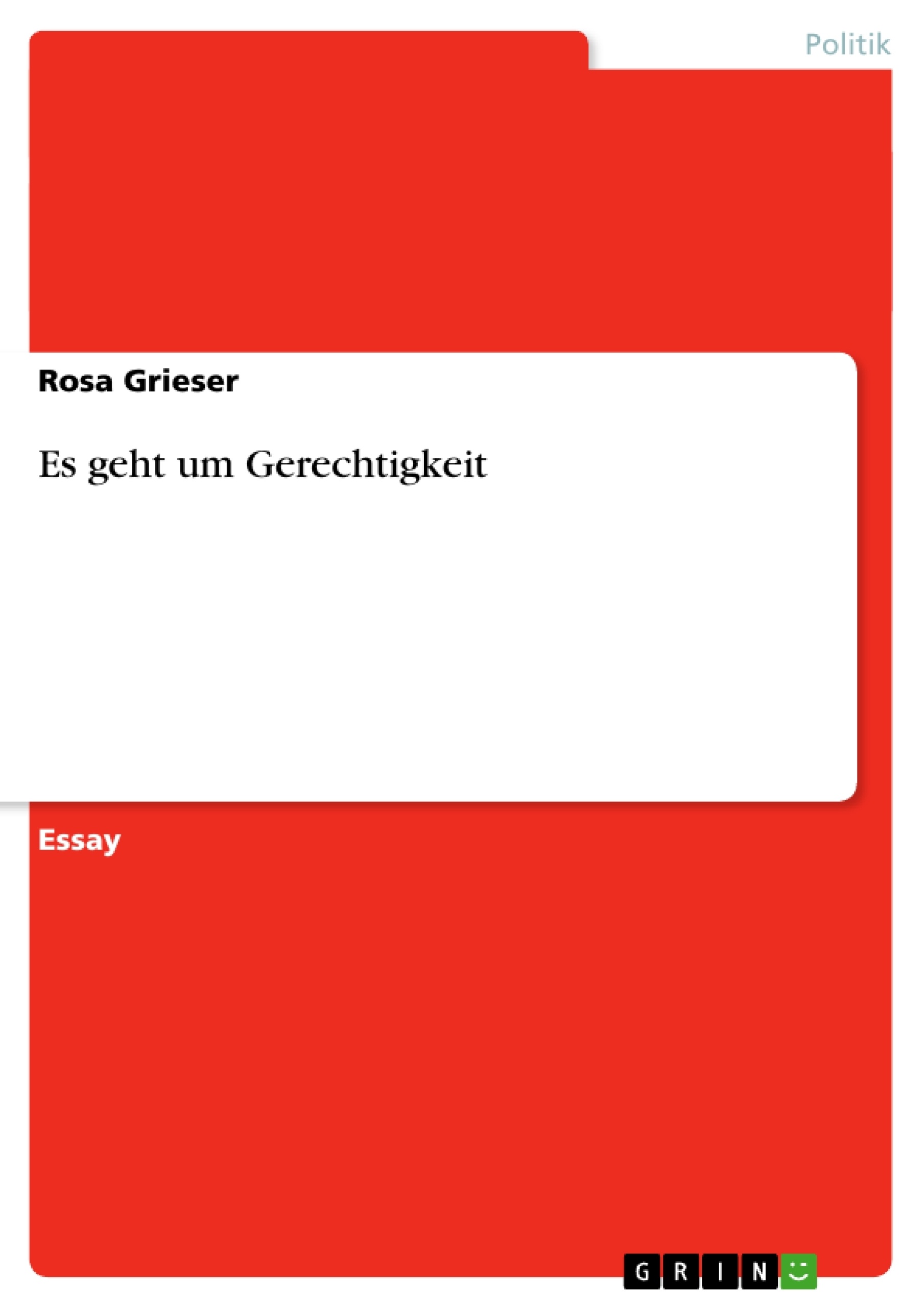Es geht um Gerechtigkeit. Und dagegen wird wohl niemand etwas haben. Doch was ist Gerechtigkeit überhaupt. Friedrich von Metzler gab eine Antwort: „Absolute Gerechtigkeit gibt es nicht, und wenn jemand absolute Gerechtigkeit anstrebt, wird es furchtbar ungerecht.“ Denn Gerechtigkeitsempfinden entstammt einem Wertesystem, und dieses ist nicht überall gleich. Ist es nun gerecht, wenn wir alle als Gleiche anfangen oder wenn wir alle das Gleiche haben?
Gerechtigkeit ein Thema, welches immer wieder auf die öffentlich-politische Agenda rückt, handelt es sich dabei um ein Kriseln des Sozialstaats, eine neue Steuerreform oder die Wirkung der letzten Weltwirtschaftskrise - Gerechtigkeit wird überall gefordert. Was allerdings unter Gerechtigkeit zu verstehen ist, darüber gehen die Meinungen nicht erst heute, sondern schon seit mehr als zwei Jahrtausenden auseinander. Dazu genügt ein Blick auf die zahlreichen Wirtschaftstheorien, welche alle für sich den Anspruch erheben, gerecht zu sein. Daran konnten auch der Versuch der Ausdifferenzierung des Gerechtigkeitsbegriffs und die im Anschluss an die von John Rawls angestoßene Debatte um dessen Bedeutung nichts Wesentliches verändern. Die Komplexität, Unbestimmtheit und ideologische Anfälligkeit des Begriffs der Gerechtigkeit ist dieselbe geblieben. Dennoch können wir innerhalb dieses verworrenen Durcheinanders aus unzähligen Vorstellungen über die Gerechtigkeit zwei große unterschiedliche Prinzipien ausmachen: die Verteilungsgleichheit und die Chancengleichheit.
Es geht um Gerechtigkeit
Es geht um Gerechtigkeit. Und dagegen wird wohl niemand etwas haben. Doch was ist Gerechtigkeit überhaupt. Friedrich von Metzler gab eine Antwort: „Absolute Gerechtigkeit gibt es nicht, und wenn jemand absolute Gerechtigkeit anstrebt, wird es furchtbar ungerecht.“ Denn Gerechtigkeitsempfinden entstammt einem Wertesystem, und dieses ist nicht überall gleich. Ist es nun gerecht, wenn wir alle als Gleiche anfangen oder wenn wir alle das Gleiche haben?
Gerechtigkeit ein Thema, welches immer wieder auf die öffentlich-politische Agenda rückt, handelt es sich dabei um ein Kriseln des Sozialstaats, eine neue Steuerreform oder die Wirkung der letzten Weltwirtschaftskrise - Gerechtigkeit wird überall gefordert. Was allerdings unter Gerechtigkeit zu verstehen ist, darüber gehen die Meinungen nicht erst heute, sondern schon seit mehr als zwei Jahrtausenden auseinander. Dazu genügt ein Blick auf die zahlreichen Wirtschaftstheorien, welche alle für sich den Anspruch erheben, gerecht zu sein. Daran konnten auch der Versuch der Ausdifferenzierung des Gerechtigkeitsbegriffs und die im Anschluss an die von John Rawls angestoßene Debatte um dessen Bedeutung nichts Wesentliches verändern. Die Komplexität, Unbestimmtheit und ideologische Anfälligkeit des Begriffs der Gerechtigkeit ist dieselbe geblieben. Dennoch können wir innerhalb dieses verworrenen Durcheinanders aus unzähligen Vorstellungen über die Gerechtigkeit zwei große unterschiedliche Prinzipien ausmachen: die Verteilungsgleichheit und die Chancengleichheit.
Diese Prinzipien sind nun in den zahlreichen Theorien mehr oder weniger stark ausgeprägt und mehr oder weniger gemeinsam Bestandteil einer Theorie. Ebenfalls sind die Definitionen und damit auch die Ziele der Verteilungs- und der Chancengleichheit höchst umstritten. In der radikalsten Form würde Verteilungsgleichheit wohl bedeuten, dass das erwirtschaftete Einkommen bzw. dessen Nutzen innerhalb einer Volkswirtschaft gleich verteilt wird. Chancengleichheit hingegen bezieht sich auf die Voraussetzungen mit den wir anfangen. Diese Vorstellung von Gerechtigkeit ermöglicht jedem, unabhängig von den Merkmalen, die sich nicht auf Leistung zurückführen lassen, die gleichen Chancen, seine Leistung und Qualifikation frei zu entfalten. Eine Umverteilung des Einkommens wäre demnach nicht gerecht, da jeder entsprechend seiner Leistungen entlohnt werden würde.
[...]
- Citar trabajo
- Rosa Grieser (Autor), 2010, Es geht um Gerechtigkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212407