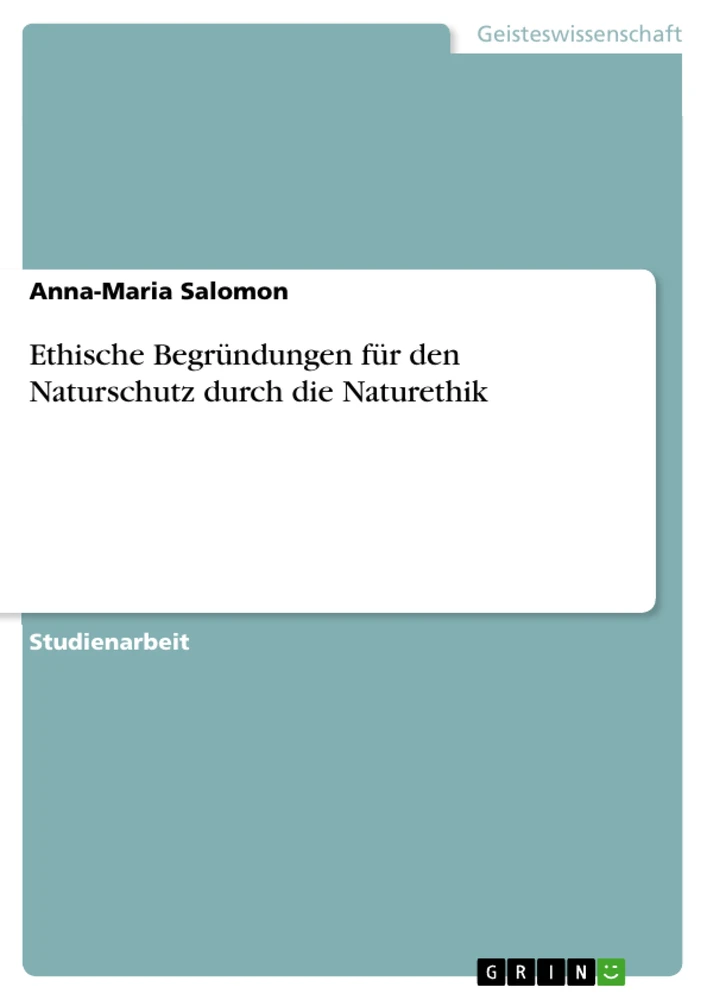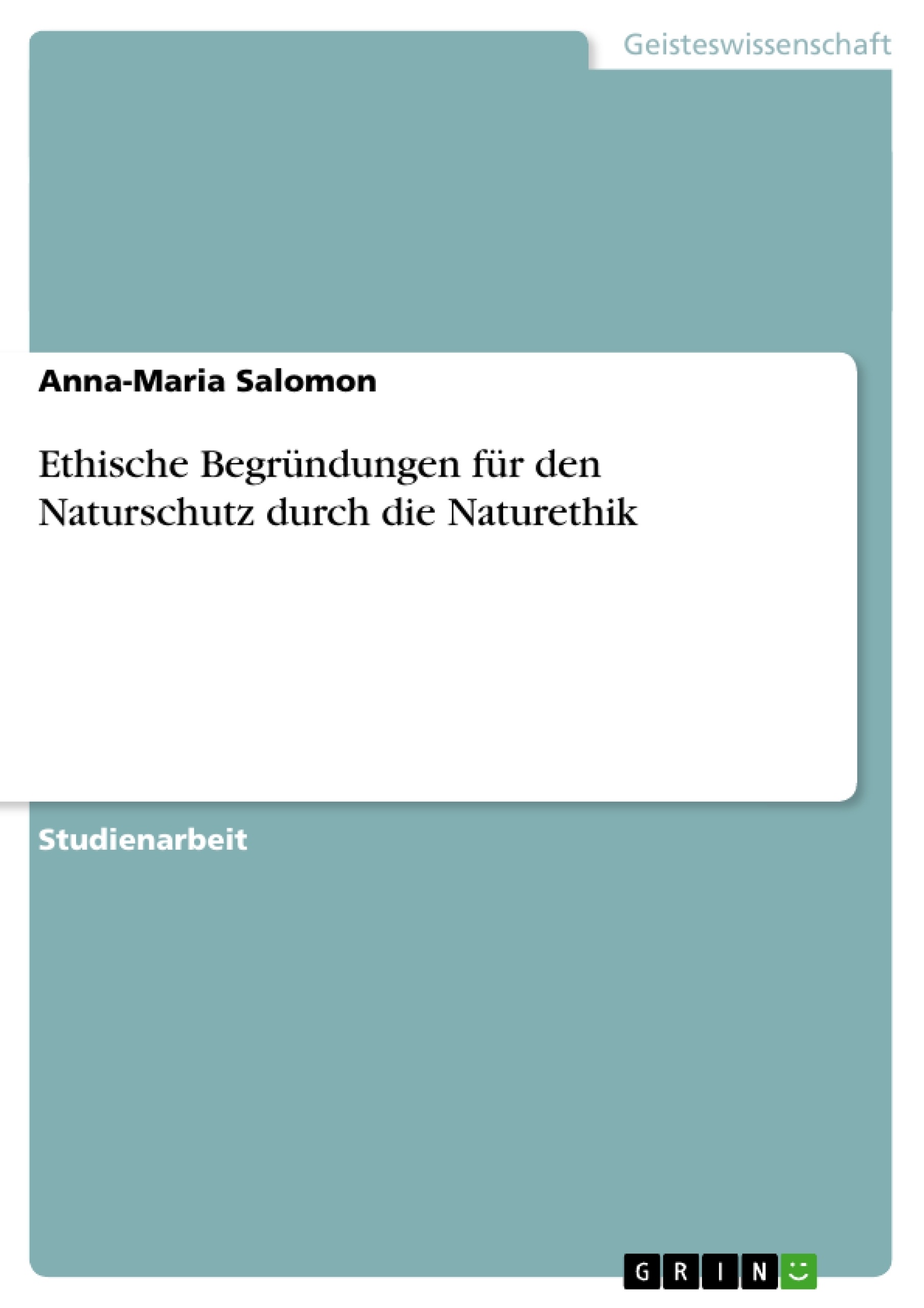Viele Ethiken großer Philosophen behandeln nur das moralische Verhalten zwischen Menschen, die dann als moralisches Subjekt und auch als einziges Objekt gelten. So sind z.B. für Descartes Tiere bloß Maschinen und bei Bentham ist Güte anderen Geschöpfen gegenüber bloß als Übung der Güte gegen Menschen gedacht, ähnliches findet sich auch bei Kant. Im Christentum gibt es ebenfalls kein Gebot zur Fürsorge für die Natur, mit der Begründung, dafür bliebe keine Zeit, da immer das Weltende kurz bevor stehe. Anders in indischen und chinesischen Ethiken, die Tieren und Pflanzen gegenüber, aber zum Teil auch gegenüber der unbelebten Natur Achtung fordern.1 Dieses ist auch ein Ziel der Naturethik. Der Kreis der moralischen Objekte soll erweitern werden, und zwar je nach Argumentart um Tiere, Pflanzen oder auch ganze Ökosysteme. Dies wird vor allem in der heutigen Zeit immer wichtiger. Die natürlichen Ressourcen, von denen die Menschheit abhängig ist, werden immer knapper; der drohende Klimawandel kann die Überlebensbedingungen für Tiere und Menschen zerstören und Katastrophen, wie erst kürzlich das Auslaufen von Unmengen Öl in den Ozean, vernichten Lebensraum von Tieren und Pflanzen. Deswegen sollte der Mensch zum einen um seiner selbst willen, aber auch um der Natur willen sein Verhalten in, mit und gegenüber der Umwelt überdenken. Je nach dem, aus welcher Sicht nun für den Naturschutz plädiert wird, ergeben sich verschiedene Typen der Argumentation, die in den folgenden Kapiteln dargestellt werden. Zuerst sollen die anthropozentrischen Argumente dargelegt werden, diese beziehen sich auf einen Schutz der Natur wegen des Menschen. Danach werden die physiozentrischen Argumentationsweisen erläutert, die die Natur um ihrer selbst willen als schützenswert erachten. Soweit möglich, wird zu jeder Argumentationsart ein Hauptvertreter genannt und seine Ausführungen beschrieben. Jedoch kann nicht jeder Richtung eindeutig ein Vertreter zugeordnet werden. Vor allem manche anthropozentrische Sichtweisen basieren nicht auf der Ansicht eines Autors, sondern sind eher ‚natürlich’ gegeben, so die Argumente der grundlegenden Bedürfnisse und der zukünftigen Generationen.
Ich habe mich in Anlehnung an Krebs2 für diese Art der Einteilung statt einer Gliederung nach Namen oder philosophischen Schulen entschieden, da so die einzelnen Argumentationsweisen am besten herausgegliedert werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anthropozentrische Argumente
- Grundlegende Bedürfnisse
- Ästhetik
- Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen
- Heimat
- Pädagogisches Argument
- Physiozentrische Argumente
- Pathozentrische Argumente
- Biozentrische Argumente
- Albert Schweitzer
- Paul W. Taylor
- Allumfassende physiozentrische Argumente
- Individualistischer Physiozentrismus: Meyer-Abichs Position
- Holismus: Naess' und Rolstons Ausführungen
- Fazit und eigene Meinung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit ethischen Begründungen für den Naturschutz. Sie untersucht verschiedene Argumentationslinien, die den Schutz der Natur rechtfertigen, und analysiert deren Stärken und Schwächen.
- Die Abhängigkeit des Menschen von der Natur und die Folgen von Umweltzerstörung für die menschliche Existenz
- Die Rolle von anthropozentrischen Argumenten, die den Schutz der Natur auf den Nutzen für den Menschen begründen
- Die Entwicklung physiozentrischer Argumentationsweisen, die der Natur einen intrinsischen Wert zuschreiben und sie um ihrer selbst willen schützen wollen
- Die verschiedenen Strömungen innerhalb des Physiozentrismus und deren Vertreter
- Die ethischen Implikationen des menschlichen Umgangs mit der Natur und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Lebensweise
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt den Kontext des Themas dar und verdeutlicht die besondere Relevanz von Naturethik im Angesicht des Klimawandels und der zunehmenden Umweltzerstörung. Im zweiten Kapitel werden anthropozentrische Argumente für den Naturschutz untersucht, die auf den Nutzen der Natur für den Menschen verweisen. Das Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte wie grundlegende Bedürfnisse, ästhetische Erfahrungen und die Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit physiozentrischen Argumentationsweisen, die der Natur einen intrinsischen Wert zuschreiben und sie um ihrer selbst willen schützen wollen. Hier werden unterschiedliche Strömungen innerhalb des Physiozentrismus wie der Pathozentrismus, der Biozentrismus und allumfassende physiozentrische Ansätze vorgestellt.
Schlüsselwörter
Naturethik, anthropozentrische Argumente, physiozentrische Argumente, instrumenteller Wert, intrinsischer Wert, Naturschutz, Nachhaltigkeit, Umweltzerstörung, Klimawandel, zukünftige Generationen, Albert Schweitzer, Paul W. Taylor, Meyer-Abich, Arne Naess, Holmes Rolston III.
- Quote paper
- Anna-Maria Salomon (Author), 2010, Ethische Begründungen für den Naturschutz durch die Naturethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212169