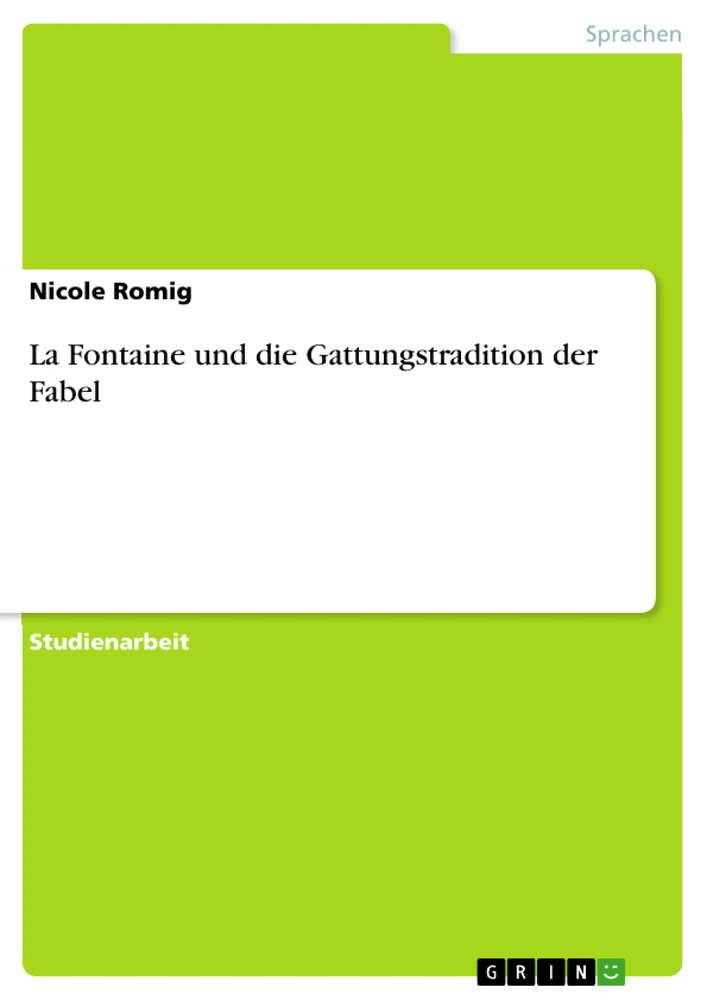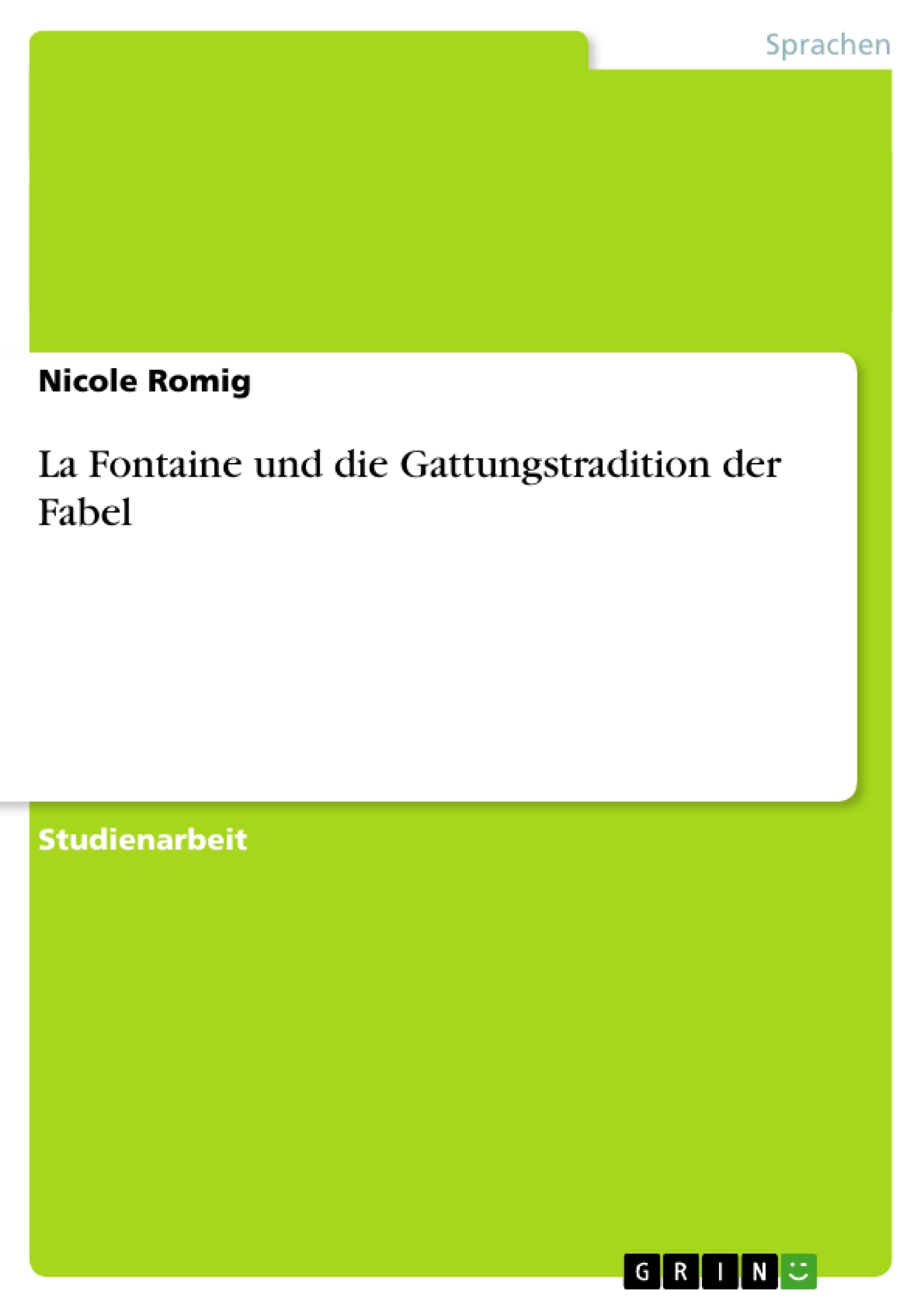Inhalt
A. Einleitung ................................................... 3
B. Definition "Fabel" ............................................ 3
C. Die Fabel vor La Fontaine - Ursprung und Antik................. 4
1. Ursprung ................................................... 4
2. Antike ........................................................ 4
3. Aufbau ........................................................ 5
D. Die Fabel vor La Fontaine - 16. und 17. Jahrhundert............ 6
1. Die Fabel in Frankreich im 16. Jahrhundert .................... 6
2. Ausgangssituation 17. Jahrhundert ............................. 7
a. Beginn 17. Jahrhundert - beliebt aber ignoriert................ 7
b. Mitte 17. Jahrhundert - Fabelliteratur ...................... 7
3. Form der Fabel im 17. Jhdt. und die Literaturtheorie........... 8
E. La Fontaine - Wandel der bisherigen Fabeltradition ............ 8
1. Tradition bewahren? Préface zum Premier Recueil ........... 8
2. Wandel zu geistreicher Unterhaltung ........................... 9
F. Der lafontainische Fabel-Stil im Einzelnen.................... 10
1. Umorganisation der Vorlage ................................... 10
2. Ästhetisierung der moralité................................... 10
3. Überraschung und Vorwegnahme.................................. 11
4. Szenische Darbietung .................................. 11
5. Spurenelemente personalen Erzählens........................... 12
6. Figurengestaltung ............................................ 12
7. Spiegeltechnik ......................................... 13
8. Zeit und Raum in den Fabeln................................... 13
9. Französisierung .............................................. 13
10. Literarisierung ........................................... 14
G. Fazit ....................................................... 14
H. Literaturverzeichnis.......................................... 16
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Definition "Fabel"
- C. Die Fabel vor La Fontaine - Ursprung und Antike
- 1. Ursprung
- 2. Antike
- 3. Aufbau
- D. Die Fabel vor La Fontaine - 16. und 17. Jahrhundert
- 1. Die Fabel in Frankreich im 16. Jahrhundert
- 2. Ausgangssituation 17. Jahrhundert
- a. Beginn 17. Jahrhundert - beliebt aber ignoriert
- b. Mitte 17. Jahrhundert - Fabelliteratur
- 3. Form der Fabel im 17. Jhdt. und die Literaturtheorie
- E. La Fontaine - Wandel der bisherigen Fabeltradition
- 1. Tradition bewahren? Préface zum Premier Recueil
- 2. Wandel zu geistreicher Unterhaltung
- F. Der lafontainische Fabel-Stil im Einzelnen
- 1. Umorganisation der Vorlage
- 2. Ästhetisierung der moralité
- 3. Überraschung und Vorwegnahme
- 4. Szenische Darbietung
- 5. Spurenelemente personalen Erzählens
- 6. Figurengestaltung
- 7. Spiegeltechnik
- 8. Zeit und Raum in den Fabeln
- 9. Französisierung
- 10. Literarisierung
- G. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Fabel, insbesondere ihren Wandel durch das Wirken Jean de La Fontaines. Ziel ist es, die Ursprünge der Fabel, ihre Bedeutung im 16. und 17. Jahrhundert und schließlich La Fontaines innovative Beiträge zur Gattung zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Analyse des lafontainischen Stils und seiner Abweichungen von der traditionellen Fabelform.
- Die Ursprünge und Entwicklung der Fabel von der Antike bis zum 17. Jahrhundert.
- Die Bedeutung der Fabel als literarische Gattung und ihre gesellschaftliche Relevanz.
- Jean de La Fontaine und sein Einfluss auf die Fabeltradition.
- Analyse des lafontainischen Fabel-Stils: Struktur, Sprache und Moral.
- Der Vergleich zwischen traditionellen Fabeln und den Werken La Fontaines.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung der Fabel im Schulunterricht, wobei der Fokus auf Jean de La Fontaine liegt. Sie hebt die oft vernachlässigten Aspekte der Fabeltradition – Ursprünge, Vielfalt der Inhalte, historische Bedeutung – hervor und kündigt den Aufbau der Arbeit an: einen Überblick über die Ursprünge, die Situation der Fabel im 16. und 17. Jahrhundert, die Analyse von La Fontaines Werk und schließlich eine detaillierte Betrachtung seines Stils. Die Einleitung betont La Fontaines Rolle als herausragender klassischer Schriftsteller und sein gesellschaftskritisches Wirken durch seine Fabeln.
B. Definition "Fabel": Dieses Kapitel definiert den Begriff der Fabel und benennt ihre gattungsmäßigen Grundzüge: den Erzählcharakter und die moralisch-didaktische Komponente. Es unterstreicht, dass die Fabel eine konkrete Handlung erzählt, aus der der Zuhörer eine moralische oder lebenskluge Wahrheit ableiten soll.
C. Die Fabel vor La Fontaine - Ursprung und Antike: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursprüngen der Fabel, wobei verschiedene Herkunftsregionen diskutiert werden (Indien, Griechenland, Ägypten, Babylonien). Die Antike wird als Zeitraum betrachtet, in dem die Fabel kein eigenständiges literarisches Genre, sondern eher ein rhetorisches Element darstellte, hauptsächlich in niederen Gesellschaftsschichten verbreitet. Das Kapitel betont den Einfluss von Äsops Fabeln auf die europäische Tradition und beschreibt deren typische Merkmale: klaren Aufbau, anschauliche Szenen und angenehmen Ton. Die Weitergabe und Rezeption von Äsops Fabeln über Phaedrus, Babrios und Avianus ins Mittelalter wird beschrieben, ebenso wie ihre Verwendung in Klosterschulen und Predigten.
D. Die Fabel vor La Fontaine - 16. und 17. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet die Situation der Fabel in Frankreich vor La Fontaine. Es untersucht die Entwicklung der Fabel im 16. Jahrhundert und die unterschiedlichen Phasen im 17. Jahrhundert, von einer anfänglichen Beliebtheit ohne größere Beachtung hin zu einer wachsenden literarischen Anerkennung. Die Diskussion der Literaturtheorie der Zeit im Kontext der Fabelform wird ebenfalls angesprochen.
E. La Fontaine - Wandel der bisherigen Fabeltradition: Dieses Kapitel konzentriert sich auf La Fontaines Werk und seinen Einfluss auf die Fabeltradition. Es analysiert seine "Préface zum Premier Recueil", in der seine Herangehensweise an die Tradition beleuchtet wird. Das Kapitel untersucht den Wandel von der rein moralischen Belehrung hin zu einer geistreicher Unterhaltung, die La Fontaine mit seinen Fabeln schaffte.
Schlüsselwörter
Fabel, Jean de La Fontaine, Moralistik, Literaturgeschichte, Gattungstradition, Äsop, Antike, Frankreich, 17. Jahrhundert, Stilanalyse, Erzähltechnik, Moral, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Jean de La Fontaine und die Fabel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Fabel, insbesondere ihren Wandel durch das Wirken Jean de La Fontaines. Sie beleuchtet die Ursprünge der Fabel, ihre Bedeutung im 16. und 17. Jahrhundert und La Fontaines innovative Beiträge zur Gattung. Der Fokus liegt auf der Analyse des lafontainischen Stils und seiner Abweichungen von der traditionellen Fabelform.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Die Ursprünge und Entwicklung der Fabel von der Antike bis zum 17. Jahrhundert; die Bedeutung der Fabel als literarische Gattung und ihre gesellschaftliche Relevanz; Jean de La Fontaine und sein Einfluss auf die Fabeltradition; die Analyse des lafontainischen Fabel-Stils (Struktur, Sprache und Moral); und der Vergleich zwischen traditionellen Fabeln und den Werken La Fontaines.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in die folgenden Abschnitte: Einleitung, Definition "Fabel", Die Fabel vor La Fontaine - Ursprung und Antike, Die Fabel vor La Fontaine - 16. und 17. Jahrhundert, La Fontaine - Wandel der bisherigen Fabeltradition, Der lafontainische Fabel-Stil im Einzelnen und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Fabelentwicklung und des lafontainischen Schaffens.
Was ist der Fokus des Kapitels "Die Fabel vor La Fontaine - Ursprung und Antike"?
Dieses Kapitel untersucht die Ursprünge der Fabel in verschiedenen Kulturen (Indien, Griechenland, Ägypten, Babylonien) und ihre Rolle in der Antike als rhetorisches Element. Es betont den Einfluss von Äsops Fabeln und deren Weitergabe und Rezeption über Phaedrus, Babrios und Avianus ins Mittelalter.
Was wird im Kapitel über La Fontaine behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf La Fontaines Werk und seinen Einfluss auf die Fabeltradition. Es analysiert seine "Préface zum Premier Recueil" und untersucht den Wandel von der rein moralischen Belehrung hin zu einer geistreicher Unterhaltung in seinen Fabeln.
Welche Aspekte des lafontainischen Fabel-Stils werden analysiert?
Die Analyse des lafontainischen Fabel-Stils umfasst die Umorganisation der Vorlage, die Ästhetisierung der moralité, Überraschung und Vorwegnahme, die szenische Darbietung, Spurenelemente personalen Erzählens, die Figurengestaltung, die Spiegeltechnik, Zeit und Raum in den Fabeln, die Französisierung und die Literarisierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fabel, Jean de La Fontaine, Moralistik, Literaturgeschichte, Gattungstradition, Äsop, Antike, Frankreich, 17. Jahrhundert, Stilanalyse, Erzähltechnik, Moral, Didaktik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursprünge der Fabel, ihre Bedeutung im 16. und 17. Jahrhundert und La Fontaines innovative Beiträge zur Gattung zu beleuchten. Sie untersucht La Fontaines Stil und seine Abweichungen von der traditionellen Fabelform.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich für die Literaturgeschichte, insbesondere die Entwicklung der Fabel und das Werk Jean de La Fontaines interessiert. Sie eignet sich für Studenten und Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchten.
- Citar trabajo
- Nicole Romig (Autor), 2011, La Fontaine und die Gattungstradition der Fabel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212003