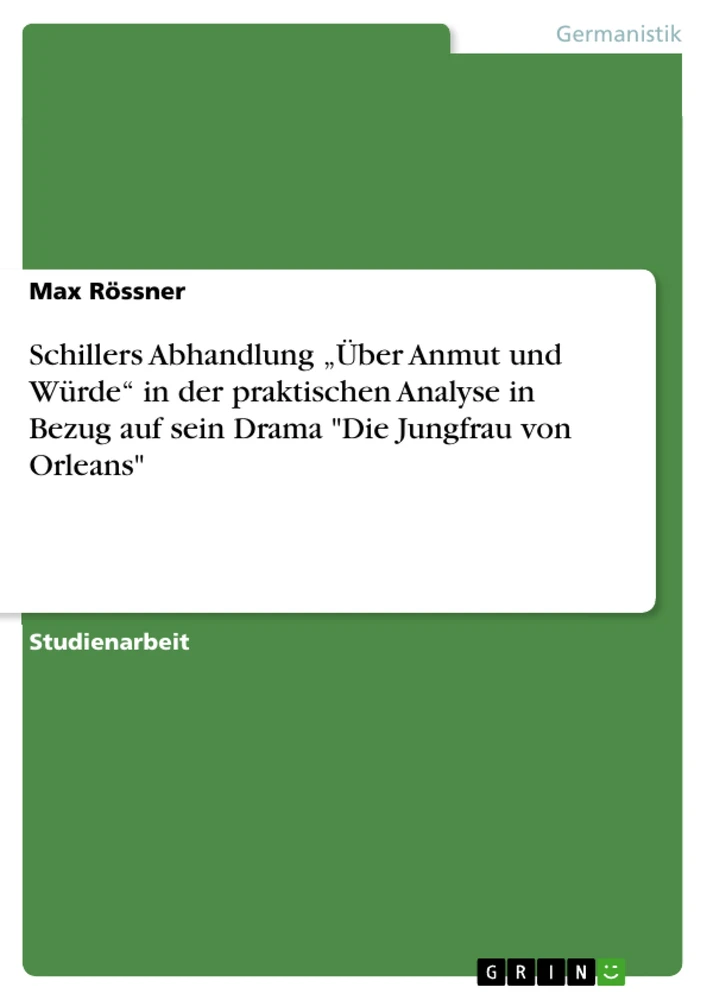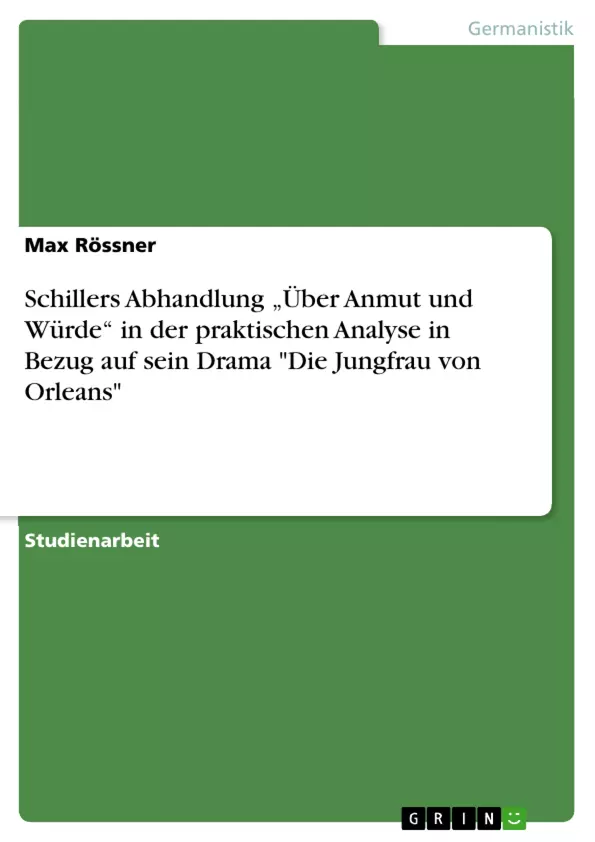Königsberger Sinnensklaverei: Schillers Ausgangslage
Im Jahr 1793, nach nur etwa sechs Wochen Schreibarbeit, erscheint die
Schrift „Über Anmut und Würde“, jenes ästhetische Werk, mit dem sich
Schiller zum ersten Mal auf das fremde Terrain der praktischen
Philosophie begibt, um sich dort an der Gegendarstellung zu einem
äußerst populären Thema zu erproben; doch der Philosoph, den er
herausfordert und revidieren will, ist eine mächtige Instanz: Immanuel
Kant.
Acht Jahre zuvor, 1785, hat Kant mit der „Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten“ eine Ethik vorgelegt, an deren rigider „[…] dualistischer
Erstarrung […]“ von Sinnlichkeit einerseits und Sittlichkeit andererseits
sich der flammende Protest Schillers entzündet. Anders als für den
moralischen Grandseigneur ist für Schiller die Vorstellung unerträglich,
[…] die unterdrückende Vernunft […] selbst zur blinden Macht [zu
erheben], wie sie die Natur ursprünglich ist.“ Anstelle einer
Sollensphilosophie, in deren Konzept die Moral des Individuums stets
über seine natürlichen Begierden herrscht, möchte Schiller eine auf
Harmonie aller Wesenskonstituenten basierende Ethik entwickeln[...]
Inhaltsverzeichnis
- Königsberger Sinnensklaverei: Schillers Ausgangslage
- Über Anmut und Würde führt die Veredelung: Zur Ethik
- Das Haupt der Medusa
- Über Anmut und Würde führt die Veredelung: Zur Ästhetik
- Geschlechterdifferenzen in der Abhandlung
- Die Jungfrau von Orleans- Sinnbild und Querulantin
- Bellizistische Hand Gottes oder anmutige Eigenregie?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Maximilian Rössners Bachelorarbeit untersucht Schillers ästhetisches Werk "Über Anmut und Würde" in Bezug auf sein Drama "Die Jungfrau von Orleans". Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse der Beziehung zwischen Schillers Ethik und Ästhetik im Kontext seiner Kritik an Kants Philosophie.
- Die Kritik an Kants "dualistischer Erstarrung" von Sinnlichkeit und Sittlichkeit
- Schillers Vorstellung von Anmut als einer Synthese von Vernunft und Neigung
- Die Bedeutung der "Veredelung" des Menschen durch die Integration der Natur in die Vernunft
- Die Rolle der "Würde" als Ausdruck der moralischen Freiheit
- Die Anwendung dieser Konzepte auf das Drama "Die Jungfrau von Orleans"
Zusammenfassung der Kapitel
Königsberger Sinnensklaverei: Schillers Ausgangslage
Dieses Kapitel stellt die Ausgangssituation von Schillers Werk "Über Anmut und Würde" dar. Rössner beleuchtet Schillers Kritik an Kants Philosophie, insbesondere an dessen strenge Trennung von Vernunft und Neigung. Schillers Ziel ist es, eine alternative Ethik zu entwickeln, die beide Aspekte harmonisiert.
Über Anmut und Würde führt die Veredelung: Zur Ethik
Hier präsentiert Rössner Schillers Konzept der Anmut als Ausdruck einer gelungenen Synthese von Vernunft und Neigung. Die anmutige Person integriert die Triebe in den Geist und erreicht so eine moralische Einheit.
Über Anmut und Würde führt die Veredelung: Zur Ästhetik
Rössner setzt sich mit Schillers ästhetischen Argumenten auseinander. Er erläutert, wie die Anmut mit einer beweglichen Schönheit verbunden ist und wie Schillers Theorie der Anmut auf die Kunst angewandt werden kann.
Geschlechterdifferenzen in der Abhandlung
In diesem Kapitel untersucht Rössner die Rolle der Geschlechter in Schillers Abhandlung. Er analysiert, wie Schiller die Konzepte von Anmut und Würde auf Männer und Frauen anwendet.
Die Jungfrau von Orleans- Sinnbild und Querulantin
Rössner wendet die Erkenntnisse aus Schillers Abhandlung auf das Drama "Die Jungfrau von Orleans" an. Er analysiert die Figur der Johanna von Orleans als Sinnbild für Schillers Ideale von Anmut und Würde.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Anmut, Würde, Ethik, Ästhetik, Kants Philosophie, Schillers Philosophie, "Die Jungfrau von Orleans" und die Bedeutung der "Veredelung" des Menschen. Die Analyse beleuchtet das Zusammenspiel von Vernunft, Neigung, Moral und Kunst in Schillers Denken.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Schiller an Immanuel Kant?
Schiller kritisiert Kants strenge Trennung (Dualismus) von Sinnlichkeit und Vernunft. Er empfand es als unerträglich, dass die Moral stets die natürlichen Neigungen unterdrücken müsse.
Was versteht Schiller unter "Anmut"?
Anmut ist für Schiller der Ausdruck einer "schönen Seele", bei der Vernunft und Neigung (Pflicht und Lust) in harmonischer Übereinstimmung stehen.
Was bedeutet "Würde" in Schillers Ästhetik?
Würde zeigt sich dann, wenn die Vernunft über die Triebe herrschen muss, insbesondere in Momenten des Leidens oder der moralischen Herausforderung.
Wie wird "Die Jungfrau von Orleans" in der Arbeit analysiert?
Die Figur der Johanna wird als Sinnbild für das Spannungsfeld zwischen anmutiger Eigenregie und der "Hand Gottes" (moralischer Pflicht) untersucht.
Was ist das Ziel der "Veredelung" des Menschen?
Ziel ist die Integration der menschlichen Natur in die Vernunft, um eine ganzheitliche moralische und ästhetische Einheit des Individuums zu erreichen.
- Arbeit zitieren
- Max Rössner (Autor:in), 2010, Schillers Abhandlung „Über Anmut und Würde“ in der praktischen Analyse in Bezug auf sein Drama "Die Jungfrau von Orleans", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211737