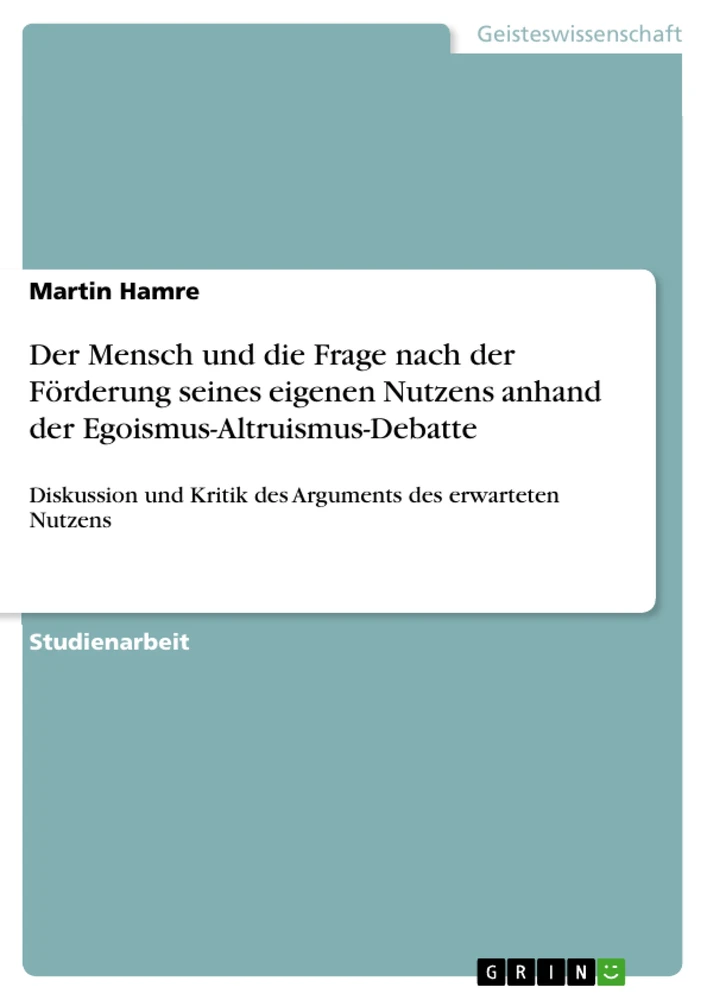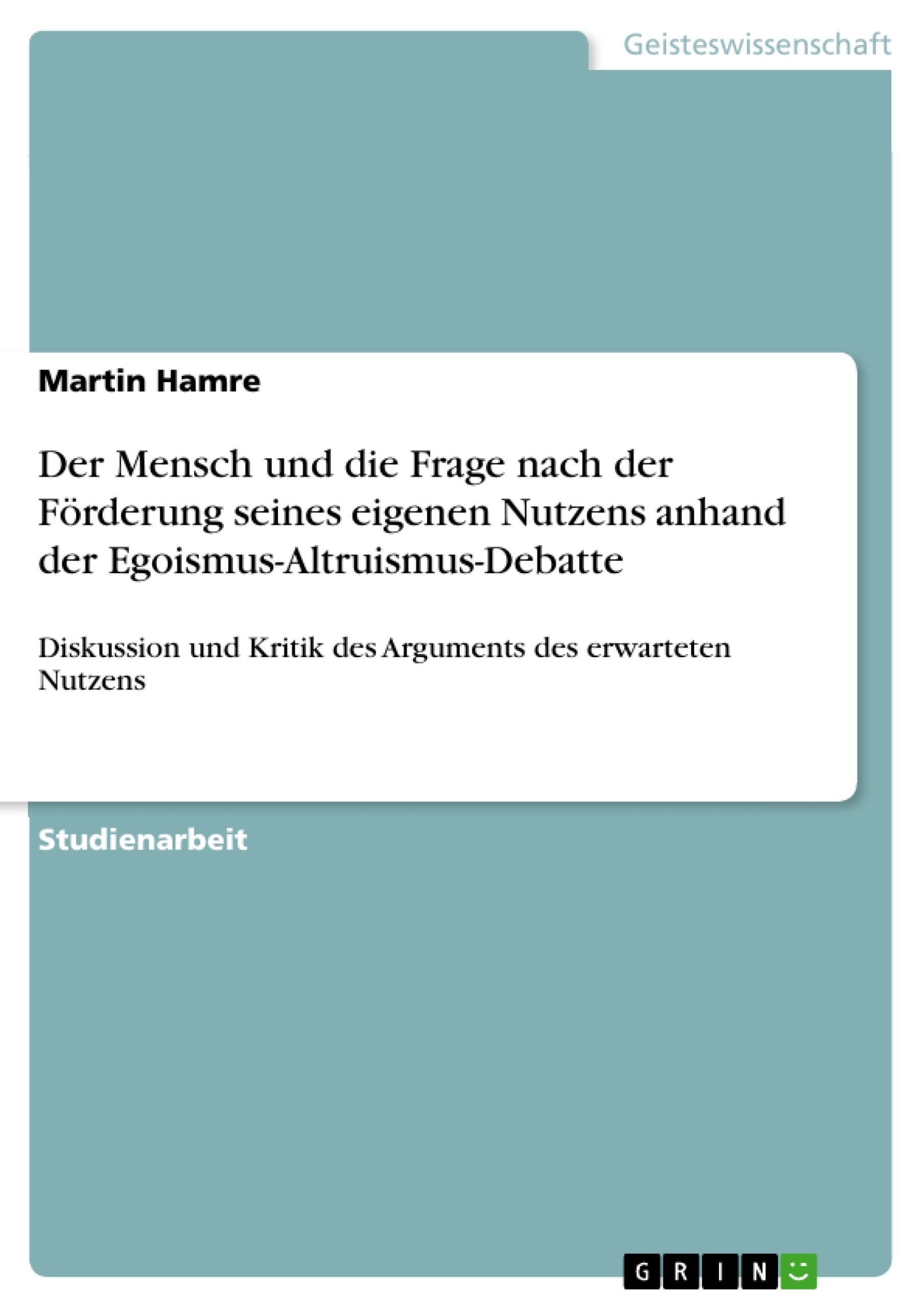Die Hausarbeit setzt sich mit dem so genannten "psychologischen Egoismus" auseinander, der besagt, dass alles, was der Mensch tut, nur zu seinem eigenen Besten geschieht. Da die Beschäftigung mit dem gesamten Egoismus den Rahmen einer Hausarbeit bei weitem Sprengen würde, werde ich mich auf den folgenden Seiten damit begnügen, das Argument des erwarteten Nutzens (im Original The Argument from Expected Benefit), welches Shafer-Landau in seinem Werk „The Fundamentals of Ethics“ als eines von mehreren Elementen des psychologischen Egoismus präsentiert, zu rekonstruieren, zu erläutern, zu diskutieren und zu kritisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Freundschaft als reinen Profit?
- Die Egoismus-Altruismus Debatte
- Hauptteil
- Klärung der zentralen Begriffe
- Erläuterung der ersten Prämisse
- Erläuterung der zweiten Prämisse
- Die Konklusion
- Einwände gegen die erste Prämisse
- Kann Selbstaufopferung egoistisch sein?
- Einwände gegen die zweite Prämisse
- Das Scheitern der Konklusion
- Mögliche Repliken
- Schluss
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Mensch immer nur seinen eigenen Nutzen im Auge hat und sein Handeln stets egoistisch motiviert ist. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion, Erläuterung, Diskussion und Kritik des Arguments des erwarteten Nutzens. Dieses Argument, das von Shafer-Landau im Rahmen des psychologischen Egoismus vorgestellt wird, besagt, dass der Mensch bei jeder Handlung den Eigennutz zu fördern versucht, da er erwartet, dadurch letztendlich besser gestellt zu sein. Die Arbeit zielt darauf ab, dieses Argument zu analysieren und seine Gültigkeit zu überprüfen.
- Der psychologische Egoismus und seine Relevanz für die normative Ethik
- Die Rekonstruktion und Erläuterung des Arguments des erwarteten Nutzens
- Die Kritik des Arguments des erwarteten Nutzens
- Die Einordnung des Arguments in den Gesamtkontext der Egoismus-Altruismus Debatte
- Die Schlussfolgerung und ihre Bedeutung für das Verständnis des menschlichen Handelns
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Argument des erwarteten Nutzens anhand einer alltäglichen Situation vor und führt die Egoismus-Altruismus Debatte ein. Sie erklärt die Relevanz des psychologischen Egoismus für die normative Ethik.
- Klärung der zentralen Begriffe: Dieser Abschnitt erläutert und kontextualisiert die zentralen Begriffe wie Egoismus, Wohlbefinden, Eigennutz und erwarteter Nutzen.
- Erläuterung der ersten Prämisse: Hier wird die erste Prämisse des Arguments, die besagt, dass man bei jeder Handlung erwartet, im Endeffekt besser da zu stehen, genauer betrachtet.
- Erläuterung der zweiten Prämisse: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der zweiten Prämisse, die aussagt, dass man, wenn man erwartet, im Endeffekt besser gestellt zu sein, den Eigennutz fördern will.
- Die Konklusion: Die Konklusion des Arguments wird zusammengefasst und erläutert, dass der Mensch bei jeder Handlung den Eigennutz zu fördern versucht.
- Einwände gegen die erste Prämisse: Dieser Abschnitt präsentiert Einwände gegen die erste Prämisse, indem er argumentiert, dass der Mensch nicht immer erwartet, im Endeffekt besser gestellt zu sein, sondern auch aus anderen Motiven handeln kann, wie z.B. Selbstaufopferung.
- Kann Selbstaufopferung egoistisch sein? : Dieser Abschnitt diskutiert, ob Selbstaufopferung als egoistisch betrachtet werden kann. Er zeigt, dass Selbstaufopferung oft mit dem eigenen Wohlbefinden und der Steigerung des Selbstwertes verbunden ist.
- Einwände gegen die zweite Prämisse: Hier werden Einwände gegen die zweite Prämisse vorgebracht, die besagt, dass man bei der Erwartung, besser gestellt zu sein, den Eigennutz fördern will. Es wird argumentiert, dass der Mensch nicht immer sein eigenes Wohlbefinden maximieren will.
- Das Scheitern der Konklusion: Dieser Abschnitt fasst die Kritik am Argument des erwarteten Nutzens zusammen und zeigt, dass die Konklusion, der Mensch würde bei jeder Handlung den Eigennutz fördern, nicht haltbar ist.
- Mögliche Repliken: Dieser Abschnitt stellt mögliche Gegenargumente zum Scheitern der Konklusion vor und diskutiert, ob das Argument des erwarteten Nutzens dennoch eine gewisse Gültigkeit haben könnte.
Schlüsselwörter
Psychologischer Egoismus, Argument des erwarteten Nutzens, Egoismus, Altruismus, Wohlbefinden, Eigennutz, erwarteter Nutzen, Selbstaufopferung, normative Ethik, Handlungsmotivation
- Quote paper
- Martin Hamre (Author), 2012, Der Mensch und die Frage nach der Förderung seines eigenen Nutzens anhand der Egoismus-Altruismus-Debatte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211735