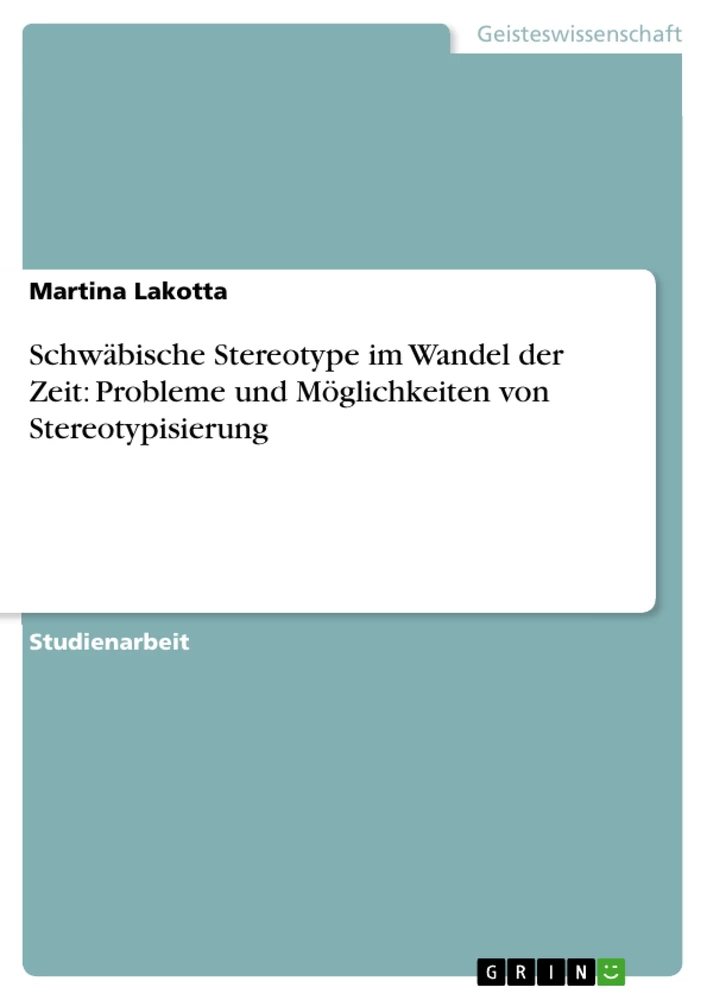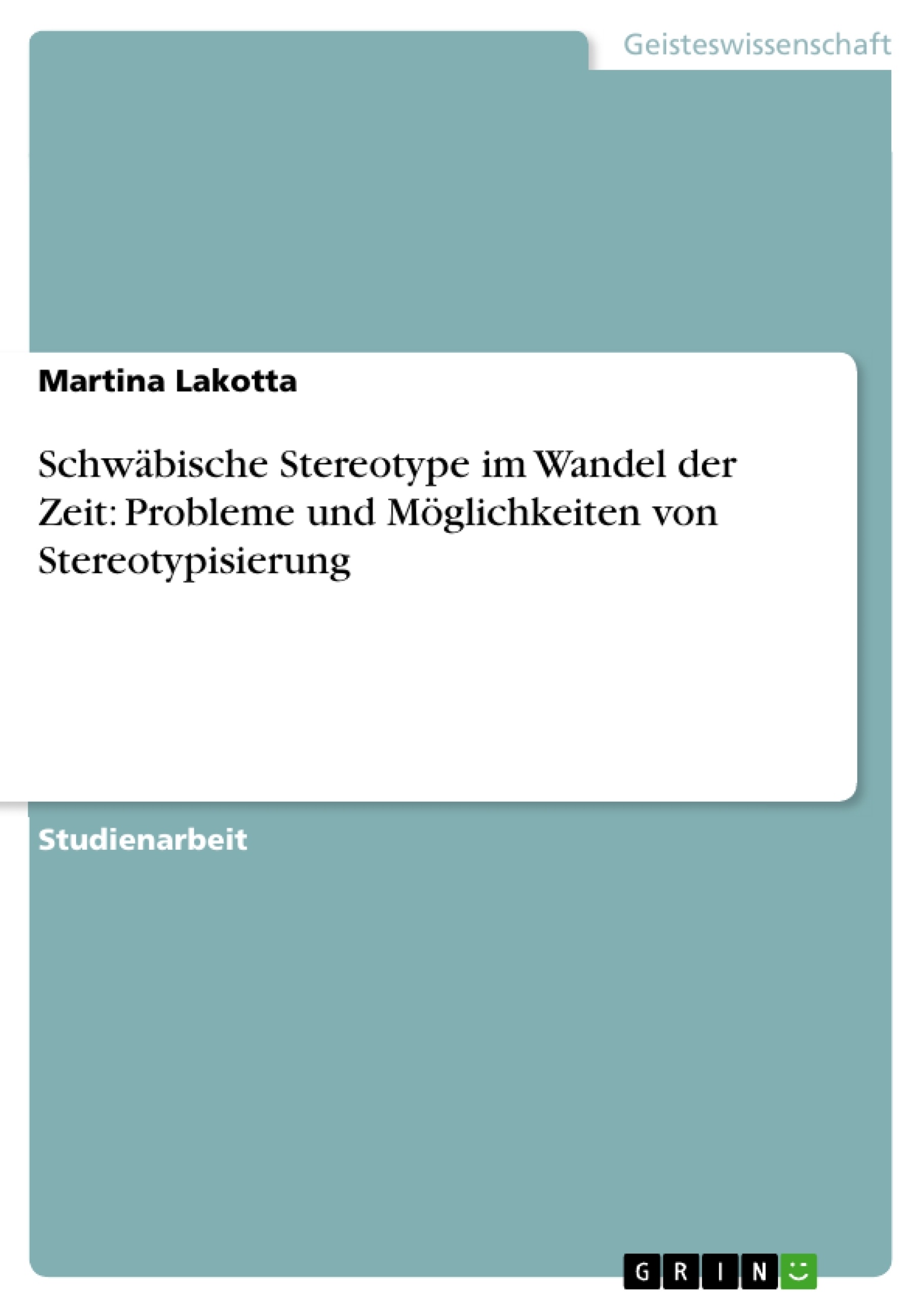Ob nun der Pizza und Pasta liebende Italiener, der es noch versteht das Dolce Vita voll auszuleben, der Pole, der zu viel trinkt und bei dem organisierte Kriminalität und Autodiebstahl an der Tagesordnung stehen oder der Wein schlürfende Franzose, mit einer Baskenmütze auf dem Kopf und einem Baguette unter dem Arm. Stereotype Bilder wie diese verbinden vermutlich die meisten Menschen mit bestimmten Ländern und Kulturen. Doch nicht nur nationale, sondern auch regionale Stereotype geistern in den Köpfen der Menschen umher, so auch über das Schwabenland. Liest man Anton Hunger´s Gebrauchsanweisung für Schwaben, erschienen im Jahr 2006 und das von Tony Kellen 1921 herausgegebene Heimatbuch Das Schwabenland, findet man einige Charakterisierungen zum angeblich typisch Schwäbischen. Diese Arbeit geht mit Hilfe beider genannter Quellen der Frage nach, wie sich schwäbische Stereotype im Laufe der Geschichte verändert haben oder stabil geblieben sind.
Zunächst soll dazu genauer auf den Begriff des Stereotypen in Forschung und Wissenschaft eingegangen werden. Im Anschluss werden beide Autoren, sowie die Quellen und ihre Entstehungshintergründe kurz erläutert, um die Bücher im darauf Folgenden mit Augenmerk auf die schwäbischen Stereotype zu vergleichen. Auf diese Weise soll gezeigt werden, welche Stereotypen sich verändert haben und welche gleich geblieben sind. Um nicht auf der rein deskriptiven Ebene zu verweilen, soll zudem auch der Versuch unternommen werden, die Veränderungen bzw. Nicht-Veränderungen nach Möglichkeit auch zu begründen.
Damit der Umfang dieser Arbeit nicht überschritten wird, soll zur Quellenanalyse nicht Tony Kellen´s gesamtes Buch herangezogen werden, sondern nur die Kapitel „Land und Leute“ und „Der Charakter des schwäbischen Volkes“, sowie das von ihm verfasste Vorwort. Ebenso können nicht alle in den Quellen dargestellten Stereotype vorgestellt werden, sondern nur einige exemplarisch herausgegriffen werden.
Obwohl sich die Forschung seit geraumer Zeit intensiv mit dem Begriff des Stereotypen auseinandersetzt, findet sich meines Wissens keine Arbeit in der die Entwicklung schwäbischer Stereotypen durch Vergleich zweier zeitlich auseinander liegender Quellen vorgenommen wird. Dennoch erlebt die historische Stereotypenforschung „seit einiger Zeit eine zuvor wohl kaum erwartete Konjunktur. Sogar der Stuttgarter Internationale Historikerkongreß [...] machte sie zu einem ihrer ´Grands Thémes`.“ [sic]1
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stereotype
- Definition des Begriffs „Stereotyp“
- Probleme und Möglichkeiten von Stereotypisierung
- Historische Stereotypenforschung
- Zu den Quellen
- Der Autor Anton Hunger und der Herausgeber Tony Kellen
- Schreibanlass der Quellen
- Aufbau und Schreibstil
- Schwäbische Stereotype im Wandel der Zeit
- Die schwäbische Mundart
- Die Trinkgewohnheiten der Schwaben
- Der Schwabe als Dichter und Denker
- Der fleißige Schwabe
- Der Schwabe als Wanderer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung schwäbischer Stereotype im Laufe der Zeit anhand eines Vergleichs zweier Quellen: Anton Hunger's "Gebrauchsanweisung für Schwaben" (2006) und Tony Kellen's "Heimatbuch Das Schwabenland" (1921). Das Hauptziel ist es, herauszufinden, welche Stereotype sich verändert haben und welche stabil geblieben sind, und diese Veränderungen gegebenenfalls zu begründen. Der Umfang der Analyse wird durch die Beschränkung auf ausgewählte Kapitel in Kellens Werk begrenzt.
- Definition und Bedeutung von Stereotypen in der Forschung
- Analyse schwäbischer Stereotype in den ausgewählten Quellen
- Vergleich der Stereotype über die Zeit hinweg
- Begründung der Veränderungen (oder des Fehlens solcher) der Stereotype
- Die Rolle von Auto- und Heterostereotypen im Kontext schwäbischer Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der regionalen Stereotype ein, fokussiert auf das Beispiel Schwaben. Sie stellt die beiden zu vergleichenden Quellen vor (Anton Hunger und Tony Kellen) und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit: Vergleich der schwäbischen Stereotype in den Quellen, um deren Wandel oder Stabilität zu analysieren und zu erklären. Die Arbeit hebt die Forschungslücke hervor: es fehlt an vergleichenden Studien zur Entwicklung schwäbischer Stereotype über die Zeit.
Stereotype: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „Stereotyp“ aus wissenschaftlicher Perspektive. Es beginnt mit einer Definition des Begriffs, untersucht die Problematik und die Möglichkeiten der Stereotypisierung und gibt einen kurzen Überblick über die historische Stereotypenforschung. Es wird betont, dass Stereotype weder angeboren noch unveränderlich sind, sondern kontextabhängig entstehen und oft Identitätsbildung und Abgrenzung dienen. Der Unterschied zwischen Auto- und Heterostereotypen wird erläutert, und die ambivalente Natur von Stereotypen – als vereinfachende Ordnungshilfe, aber auch als Quelle von Vorurteilen – wird hervorgehoben.
Zu den Quellen: Dieses Kapitel präsentiert die beiden Autoren Anton Hunger und Tony Kellen sowie deren Quellen. Es beschreibt den Kontext der Entstehung beider Werke und analysiert Aufbau und Schreibstil. Diese Analyse bildet die Grundlage für den späteren Vergleich der darin enthaltenen schwäbischen Stereotype.
Schwäbische Stereotype im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte schwäbische Stereotype aus den beiden Quellen. Es untersucht, wie sich diese Stereotype im Laufe der Zeit verändert oder erhalten haben. Die Analyse umfasst verschiedene Aspekte der schwäbischen Identität, wie die Mundart, die Trinkgewohnheiten, das Bild des Schwaben als Dichter und Denker, die Arbeitsmoral und die Wanderlust der Schwaben. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Darstellung dieser Aspekte in den beiden Quellen, um Entwicklungen aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Stereotype, Schwaben, Regionalidentität, Historische Stereotypenforschung, Autostereotyp, Heterostereotyp, Anton Hunger, Tony Kellen, Mundart, Trinkgewohnheiten, Fleiß, Wandel der Zeit, Kulturvergleich.
Gebrauchsanweisung für Schwaben & Heimatbuch Das Schwabenland: Häufig gestellte Fragen
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung schwäbischer Stereotype im Laufe der Zeit anhand eines Vergleichs zweier Quellen: Anton Hunger's "Gebrauchsanweisung für Schwaben" (2006) und Tony Kellen's "Heimatbuch Das Schwabenland" (1921). Es werden die Veränderungen und die Stabilität von Stereotypen analysiert und begründet. Die Analyse umfasst ausgewählte Kapitel aus Kellens Werk und fokussiert auf verschiedene Aspekte der schwäbischen Identität.
Welche Quellen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht "Gebrauchsanweisung für Schwaben" von Anton Hunger (2006) und "Heimatbuch Das Schwabenland" von Tony Kellen (1921). Es wird der Kontext der Entstehung beider Werke und deren Aufbau und Schreibstil analysiert, um die darin enthaltenen schwäbischen Stereotype zu vergleichen.
Welche Aspekte der schwäbischen Identität werden untersucht?
Die Analyse umfasst verschiedene Aspekte der schwäbischen Identität, darunter die schwäbische Mundart, die Trinkgewohnheiten, das Bild des Schwaben als Dichter und Denker, die Arbeitsmoral (der "fleißige Schwabe") und die Wanderlust der Schwaben.
Wie wird der Wandel der Stereotype analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf den Vergleich der Darstellung dieser Aspekte in den beiden Quellen, um Entwicklungen aufzuzeigen. Es wird untersucht, welche Stereotype sich im Laufe der Zeit verändert haben und welche stabil geblieben sind.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, um die Entwicklung schwäbischer Stereotype über die Zeit zu analysieren und zu erklären. Es wird der Unterschied zwischen Auto- und Heterostereotypen erläutert und die ambivalente Natur von Stereotypen – als vereinfachende Ordnungshilfe, aber auch als Quelle von Vorurteilen – hervorgehoben.
Welche Forschungslücke wird die Arbeit schließen?
Die Arbeit hebt die Forschungslücke hervor, dass es an vergleichenden Studien zur Entwicklung schwäbischer Stereotype über die Zeit mangelt.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stereotype, Schwaben, Regionalidentität, Historische Stereotypenforschung, Autostereotyp, Heterostereotyp, Anton Hunger, Tony Kellen, Mundart, Trinkgewohnheiten, Fleiß, Wandel der Zeit, Kulturvergleich.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Stereotypen (Definition, Problematik, historische Forschung), ein Kapitel zu den Quellen (Autoren, Entstehungskontext, Schreibstil), ein Kapitel zur Analyse schwäbischer Stereotype im Wandel der Zeit und ein Fazit.
- Quote paper
- Martina Lakotta (Author), 2012, Schwäbische Stereotype im Wandel der Zeit: Probleme und Möglichkeiten von Stereotypisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211564