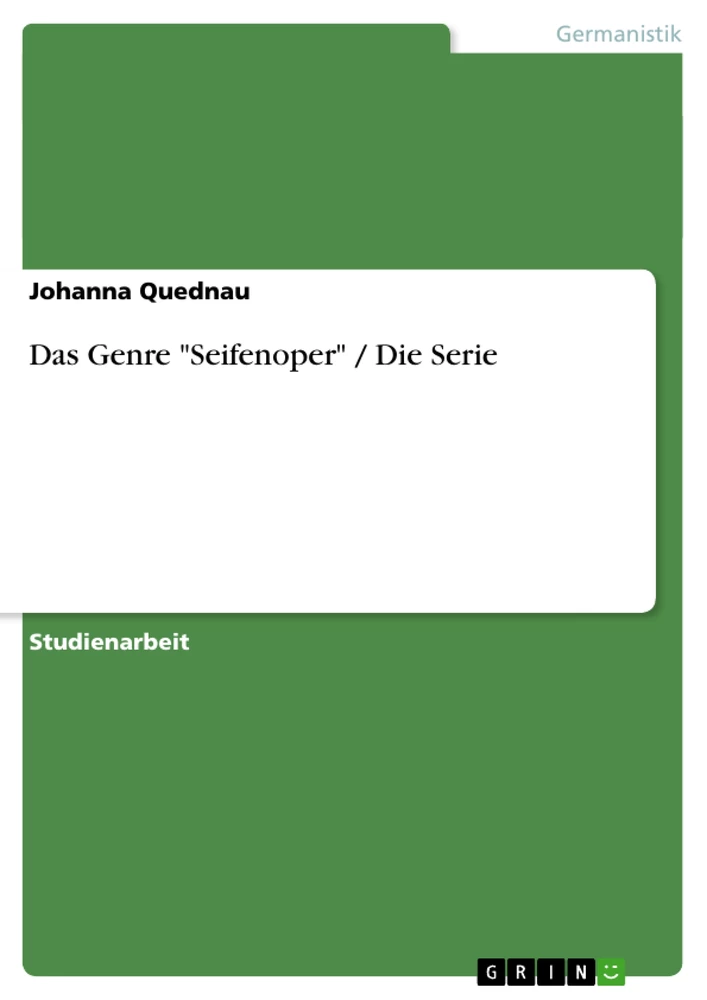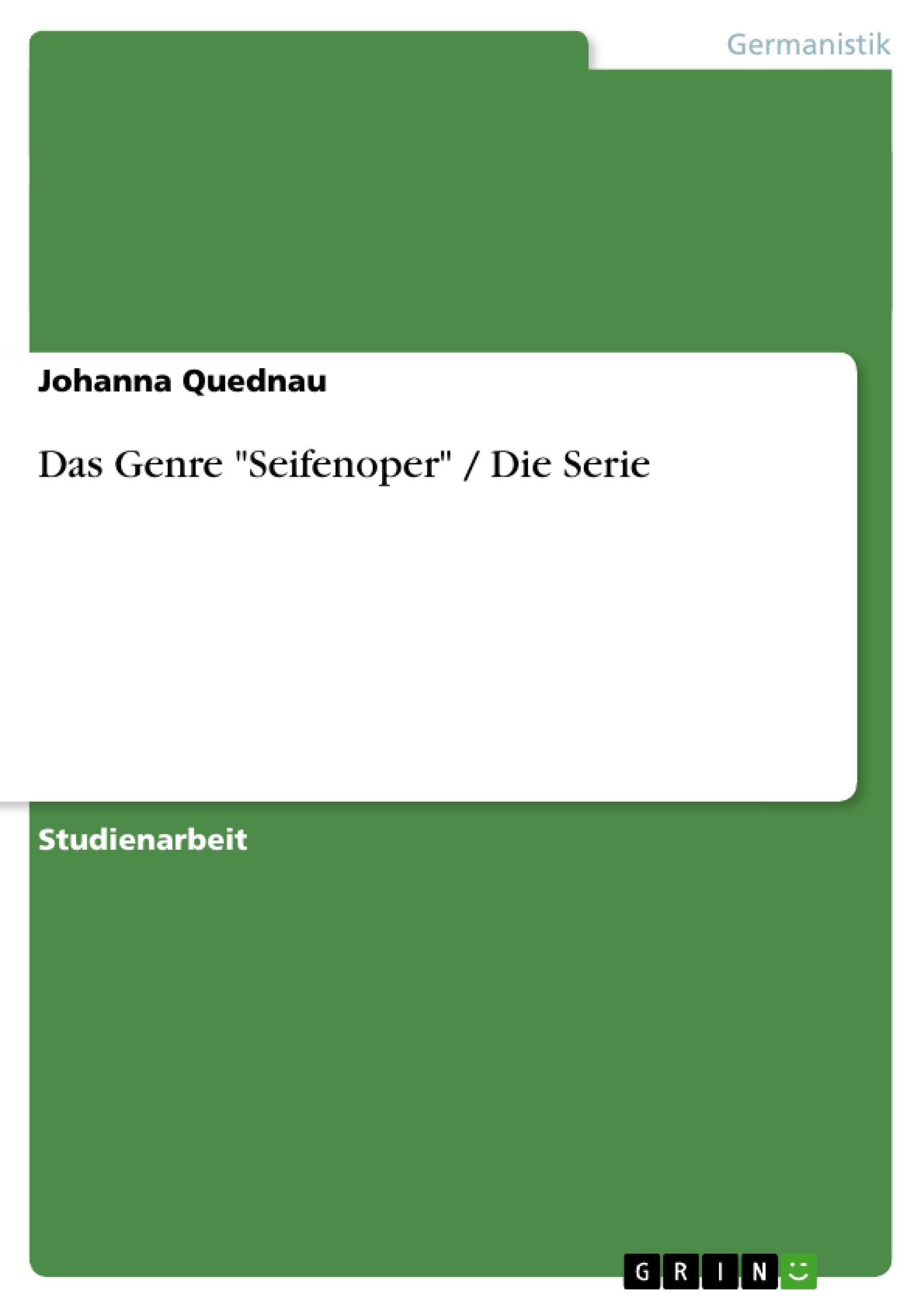In dieser Arbeit soll das Wesentliche des Genres „Seifenoper“ herausgearbeitet werden. Im
ersten Teil wird dabei auf die Serie und ihre Serientypen eingegangen, um die Unterschiede
zwischen Serien kenntlich zu machen. Des weiteren werden allgemeine Informationen zu
Serien und Soapproduktionen gegeben. Im zweiten Teil werden Entwicklungen der Soapopera
aufgeführt und im dritten Teil spezifische Merkmale einer Soap anhand einer Serie aufgelistet.
2. Die Serie
2.1. Definitionen der fiktiven Serie
Egon Netenjakob1 nennt zwei Grundformen und zwei Hauptmerkmale der Serie:
a) die Grundform der Serie als fortlaufende Wiederholung, der immer wieder gleichen bei der
Publikumsmehrheit beliebten Grundkonstellation. Getragen von einem Helden, der sich
weder physisch noch psychisch verändert, in stereotypen Geschichten;
b) die Grundform der Serie als Folge von Entwicklungen und Veränderungen der tragenden
Personen, ihrer Konstellationen oder des tragenden Schauplatzes. Die Personenentwicklung
ist differenziert und die Geschichte umspannt einen ausgedehnten Zeitraum;
c) eine Serie muss eine gewisse Folgenhäufigkeit (mehr als 10 Folgen) haben, die sich prägend
auf die Zuschauergewohnheiten auswirken kann.
d) die Zuschauer müssen sich mit den Hauptpersonen identifizieren können.
Des weiteren kann man verschiedene Serientypen bestimmen.
2.2. Serientypen
Oft wurden in der Forschung die Abgrenzungen zwischen Reihe, Mehrteiler und Serie und
der einzelnen Genres innerhalb dieser Programmformen nicht beachtet. Die Begriffe wurden
sogar gleichgesetzt oder verwechselt. Deshalb muss man zwischen den Grundformen des seriellen
Erzählens unterscheiden.
2.2.1. Der Mehrteiler
Der Mehrteiler steht im Übergang vom Einzelfilm zur Serie. Mindestens zwei Folgen und
höchstens 13 Folgen kennzeichnen ihn. Er besitzt eine Gesamtspieldauer zwischen 4 und 20 Stunden Die einzelnen Folgen enden meist mit einem Cliffhanger, dem Höhepunkt am Ende
einer jeden Folge (z.B. Rainer W. Faßbinders Verfilmung von Döblins „Berlin Alexanderplatz“).
Er ist eigentlich ein Einzelfilm, der aber zu lang für einen Programmplatz ist und deshalb
auf mehrere aufgeteilt wird. [...]
1 In Netenjakob, Egon . Anatomie der Fernsehserie - Fernsehmacher untersuchen ihre Produktionsbedingungen,
Mainz, 1976.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Serie
- Definitionen der fiktiven Serie
- Serientypen
- Der Mehrteiler
- Die Fortsetzungsgeschichte
- Abgeschlossene Folgehandlung
- Die Reihe
- Die langlaufende Serie
- Das „Day-Time-Serial“
- Das „Prime-Time-Serial“
- Serienproduktion
- Serienproduktion in Deutschland
- Das Genre „Soap“
- Geschichte der „Soap“
- Entwicklung von Seifenopern
- „Die Familie Hesselbach“
- Die „Lindenstraße“
- „Verbotene Liebe“
- Untersuchung einer Seifenoper
- Inhaltsangabe „Verbotene Liebe“, 08.-12. Oktober 2001
- Spezifische Merkmale
- Trailer
- Das Erkennungszeichen
- Mehrere Handlungsstränge
- Inhalt und Personenkonfigurationen
- Innenaufnahmen
- Personeneinstellungen
- Gestaltung
- Kameraperspektive
- Der Cliffhanger
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Genre der Seifenoper. Ziel ist es, die wesentlichen Merkmale und Entwicklungen dieses Genres herauszuarbeiten und die Unterschiede zwischen verschiedenen Serientypen zu verdeutlichen. Die Analyse einer konkreten Seifenoper dient dazu, die theoretischen Erkenntnisse zu veranschaulichen.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Serientypen
- Entwicklungsgeschichte der Seifenoper
- Spezifische Merkmale von Seifenopern (z.B. Cliffhanger, Handlungsstränge)
- Produktion und Vermarktung von Serien
- Analyse einer exemplarischen Seifenoper
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Arbeit befasst sich mit dem Genre der Seifenoper und hat zum Ziel, dessen charakteristische Merkmale und Entwicklungen zu beleuchten. Sie gliedert sich in drei Teile: den ersten Teil, der sich mit der Definition von Serien und ihren unterschiedlichen Typen auseinandersetzt, den zweiten Teil, der die Geschichte und Entwicklung von Seifenopern behandelt, und den dritten Teil, der anhand einer konkreten Seifenoper deren spezifische Merkmale untersucht.
Die Serie: Dieses Kapitel liefert zunächst eine Definition von fiktiven Serien, indem es auf die von Egon Netenjakob1 genannten Grundformen und Hauptmerkmale eingeht. Es unterscheidet zwischen fortlaufender Wiederholung derselben Grundkonstellation und der Folge von Entwicklungen und Veränderungen der handelnden Personen und ihrer Umgebung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung verschiedener Serientypen, wie Mehrteiler, Fortsetzungsgeschichte, Serien mit abgeschlossenen Folgehandlungen, Reihen und langlaufenden Serien. Die jeweiligen Charakteristika, wie Folgenhäufigkeit, Handlungsstruktur und Vermarktung werden dabei ausführlich erläutert. Die Unterscheidung der Serientypen ist wichtig, um die spezifischen Merkmale des Genres Seifenoper besser zu verstehen.
Das Genre „Soap“: Dieser Abschnitt beleuchtet die Geschichte und Entwicklung des Genres „Soap Opera“. Er beschreibt den geschichtlichen Verlauf der Seifenoper und analysiert exemplarisch die Entwicklung deutscher Seifenopern anhand von Beispielen wie „Die Familie Hesselbach“, „Lindenstraße“ und „Verbotene Liebe“. Dieser Teil stellt einen wichtigen Kontext für das Verständnis der spezifischen Merkmale dar, die im folgenden Kapitel genauer untersucht werden.
Untersuchung einer Seifenoper: Dieses Kapitel analysiert „Verbotene Liebe“ vom 08.-12. Oktober 2001 als Beispiel für eine Seifenoper. Es werden die spezifischen Merkmale dieser Serie untersucht, wie z.B. die Verwendung von Trailern, Erkennungszeichen, die Anzahl der Handlungsstränge, die Gestaltung von Inhalt und Personenkonfigurationen, die Verwendung von Innenaufnahmen und Personeneinstellungen, die Kameraperspektive, und der Einsatz des Cliffhangers als dramaturgisches Mittel zur Spannungssteigerung und Bindung des Publikums. Die Analyse soll verdeutlichen, wie diese Elemente zum typischen Charakter des Genres beitragen.
Schlüsselwörter
Seifenoper, Serie, Serientypen, Mehrteiler, Fortsetzungsgeschichte, langlaufende Serie, „Soap Opera“, Cliffhanger, Handlungsstränge, Serienproduktion, deutsche Seifenopern, „Lindenstraße“, „Verbotene Liebe“
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse einer Seifenoper
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Genre der Seifenoper, beleuchtet seine charakteristischen Merkmale und Entwicklungen und vergleicht verschiedene Serientypen. Im Fokus steht die Untersuchung spezifischer Merkmale anhand der Seifenoper "Verbotene Liebe".
Welche Serientypen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Serientypen, darunter Mehrteiler, Fortsetzungsgeschichten, Serien mit abgeschlossenen Folgehandlungen, Reihen und langlaufende Serien (Day-Time- und Prime-Time-Serials). Die jeweiligen Charakteristika bezüglich Folgenhäufigkeit, Handlungsstruktur und Vermarktung werden erläutert.
Wie wird die Geschichte der Seifenoper dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die geschichtliche Entwicklung des Genres "Soap Opera" und analysiert exemplarisch deutsche Seifenopern wie "Die Familie Hesselbach", "Lindenstraße" und "Verbotene Liebe".
Welche Aspekte der Seifenoper "Verbotene Liebe" werden analysiert?
Die Analyse von "Verbotene Liebe" (08.-12. Oktober 2001) konzentriert sich auf spezifische Merkmale wie Trailer, Erkennungszeichen, die Anzahl der Handlungsstränge, die Gestaltung von Inhalt und Personenkonfigurationen, Innenaufnahmen, Personeneinstellungen, Kameraperspektive und den Einsatz von Cliffhangern.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die wesentlichen Merkmale und Entwicklungen des Genres Seifenoper herauszuarbeiten, die Unterschiede zwischen verschiedenen Serientypen zu verdeutlichen und die theoretischen Erkenntnisse anhand einer konkreten Seifenoper zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Seifenoper, Serie, Serientypen, Mehrteiler, Fortsetzungsgeschichte, langlaufende Serie, „Soap Opera“, Cliffhanger, Handlungsstränge, Serienproduktion, deutsche Seifenopern, „Lindenstraße“, „Verbotene Liebe“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, ein Kapitel über verschiedene Serientypen, ein Kapitel zur Geschichte und Entwicklung von Seifenopern und ein Kapitel mit der Analyse von "Verbotene Liebe". Eine abschließende Betrachtung rundet die Arbeit ab.
- Quote paper
- Johanna Quednau (Author), 2001, Das Genre "Seifenoper" / Die Serie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21151