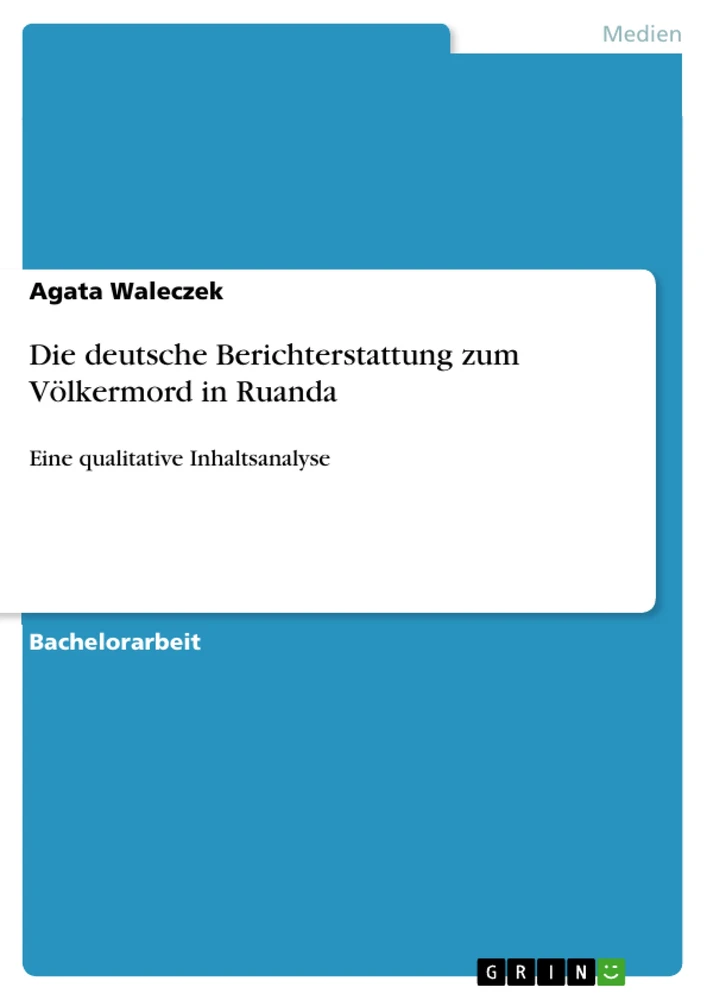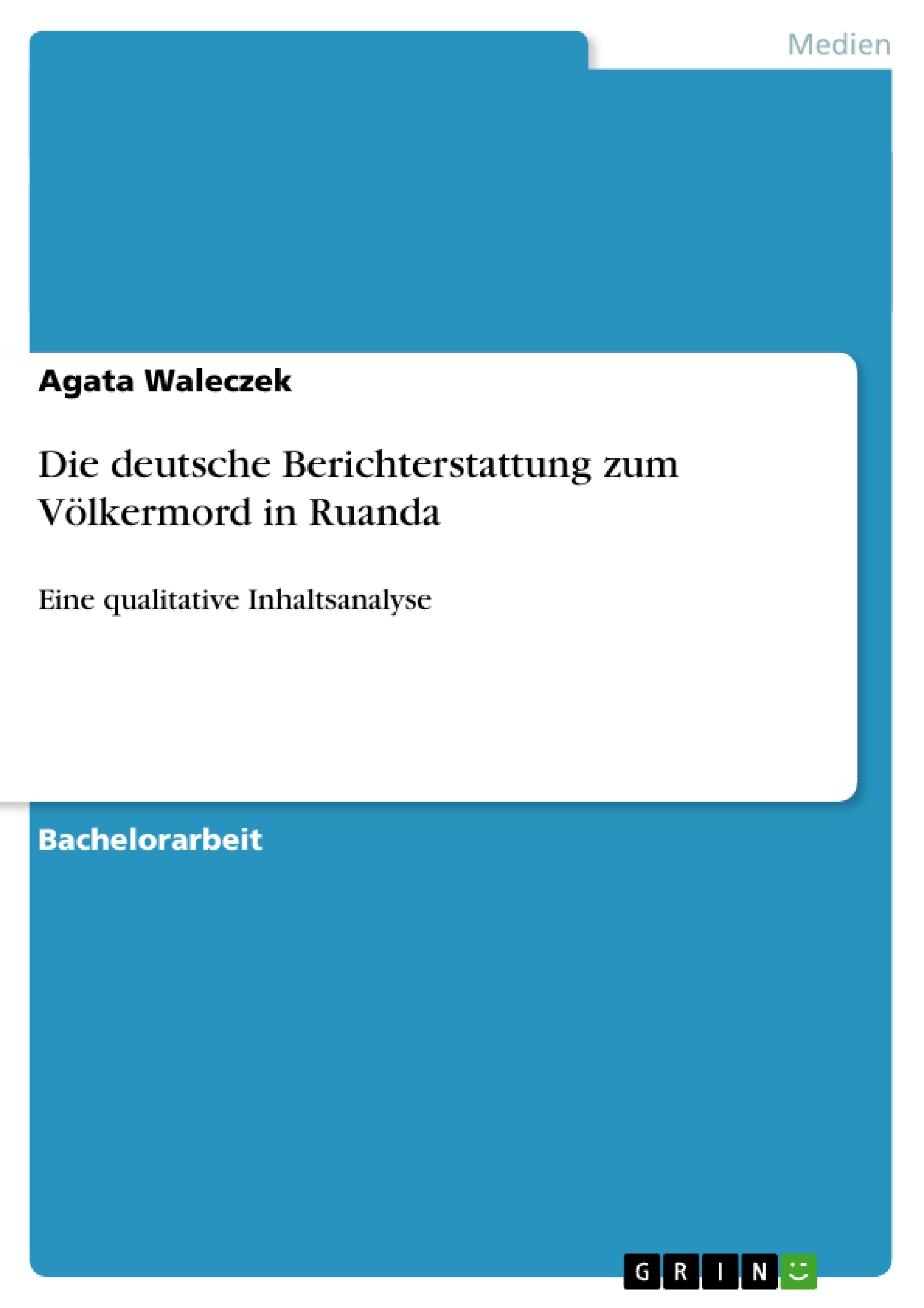Von April bis Juli 1994 wurden in einem ostafrikanischen Land von der Größe Brandenburgs circa 800.000 Menschen, zumeist mit Macheten, abgeschlachtet. Die tägliche Todesrate der geplanten und systematisch ausgeführten Massaker, die der Völkermord in Ruanda einforderte, war fünfmal höher als die der Todescamps der Nationalsozialisten (vgl. Prunier 1998: 261). (...)
Sowohl den Medien, als auch den Vereinten Nationen wurde im Zusammenhang mit dem Genozid in Ruanda vorgeworfen, im Angesicht der Krise versagt zu haben. Die multiple Unfassbarkeit dieses Völkermordes – als Menschenrechtsverbrechen und kommunikative Niederlage – fordert eine kommunikationswissenschaftliche Auseinandersetzung umso mehr heraus, als dass der Forschungsstand zur deutschen Berichterstattung zum Genozid in Ruanda nicht umfangreich ausfällt. Die vorliegende Arbeit fasst die gegebenen Umstände als Chance auf, einen Beitrag zu einem wenig erforschten Gebiet zu leisten.
Die Autorin bedient sich hierfür der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Vorgehen bei der Ausarbeitung
- Begriffsdefinitionen
- Überlegungen zur Verortung des Forschungsinteresses
- Forschungsstand zur Berichterstattung zum Genozid in Ruanda
- Die Vorgeschichte des Völkermordes
- Hutu, Tutsi und Twa
- Kolonialisierung
- Unabhängigkeit und die Zeit bis 1994
- Der Völkermord in Ruanda
- Die Rolle der nationalen ruandischen Medien
- Internationale politische Reaktionen
- Die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung
- Qualitative Inhaltsanalyse
- Ergebnisse
- Ergebnisinterpretation
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Ereignisse des Genozids in Ruanda 1994 zu beleuchten und die Berichterstattung dazu in Deutschland und international zu analysieren, wobei die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung eine zentrale Rolle einnimmt. Das Augenmerk liegt dabei auf der Analyse der Berichterstattung des Afrikakorrespondenten Michael Birnbaum.
- Die Vorgeschichte des Völkermordes in Ruanda, insbesondere die historischen und politischen Faktoren, die zum Genozid führten
- Die Rolle der nationalen ruandischen Medien bei der Verbreitung von Hasspropaganda und der Manipulation der Öffentlichkeit
- Die internationale Reaktion auf den Völkermord, insbesondere das Versagen der Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft
- Die Analyse der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung zum Genozid in Ruanda, unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Michael Birnbaum
- Die Bewertung der Berichterstattung in Bezug auf ihre journalistische Qualität, ihre Auswirkungen auf die öffentliche Meinung und ihre Rolle in der internationalen Krisenkommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Genozids in Ruanda ein und stellt das Forschungsinteresse dar. Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas im Kontext der internationalen Krisenkommunikation und der Informationsfunktion des Journalismus. Die Fragestellung wird definiert, das Vorgehen bei der Ausarbeitung skizziert und relevante Begriffe geklärt.
Das zweite Kapitel beleuchtet den Forschungsstand zur Berichterstattung zum Genozid in Ruanda und verortet das Forschungsinteresse in Bezug auf Krisenkommunikation und Afrikaberichterstattung. Es werden die Ziele und die Methodik der vorliegenden Arbeit erläutert.
Kapitel drei befasst sich mit der Vorgeschichte des Völkermordes in Ruanda. Es werden die historischen Wurzeln des Konflikts zwischen Hutu, Tutsi und Twa, die Kolonialisierung Ruandas und die Zeit nach der Unabhängigkeit bis 1994 untersucht.
Kapitel vier behandelt den Völkermord in Ruanda selbst. Es werden die Rolle der nationalen ruandischen Medien in der Verbreitung von Hasspropaganda und die internationalen politischen Reaktionen auf den Genozid analysiert.
Kapitel fünf konzentriert sich auf die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung zum Genozid. Eine qualitative Inhaltsanalyse der Berichterstattung von Michael Birnbaum wird durchgeführt, und die Ergebnisse werden präsentiert und interpretiert.
Das letzte Kapitel, das in dieser Zusammenfassung nicht berücksichtigt wird, fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen zum Thema.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der internationalen Krisenkommunikation, der Afrikaberichterstattung und der Medieninhaltsforschung. Die Schlüsselwörter umfassen Völkermord, Genozid in Ruanda, Hutu, Tutsi, Medienberichterstattung, Süddeutsche Zeitung, Michael Birnbaum, Qualitative Inhaltsanalyse, Krisenkommunikation, Informationsfunktion, politische Funktion, Medienwirkungen, Internationale Politik, Vereinte Nationen, und die Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
- Quote paper
- Agata Waleczek (Author), 2011, Die deutsche Berichterstattung zum Völkermord in Ruanda, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211327