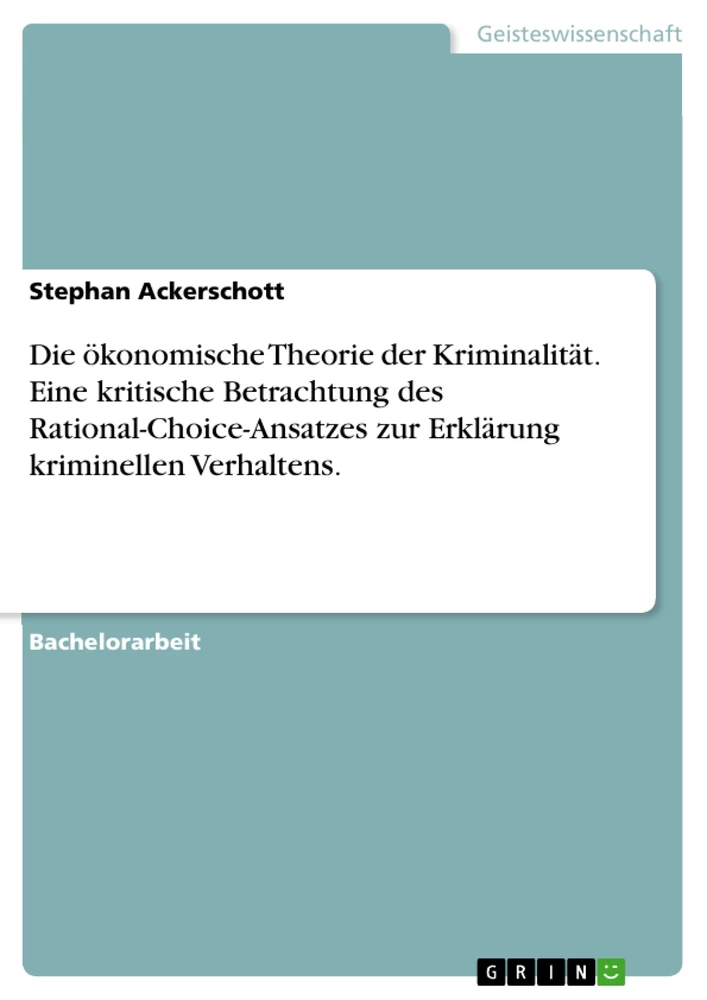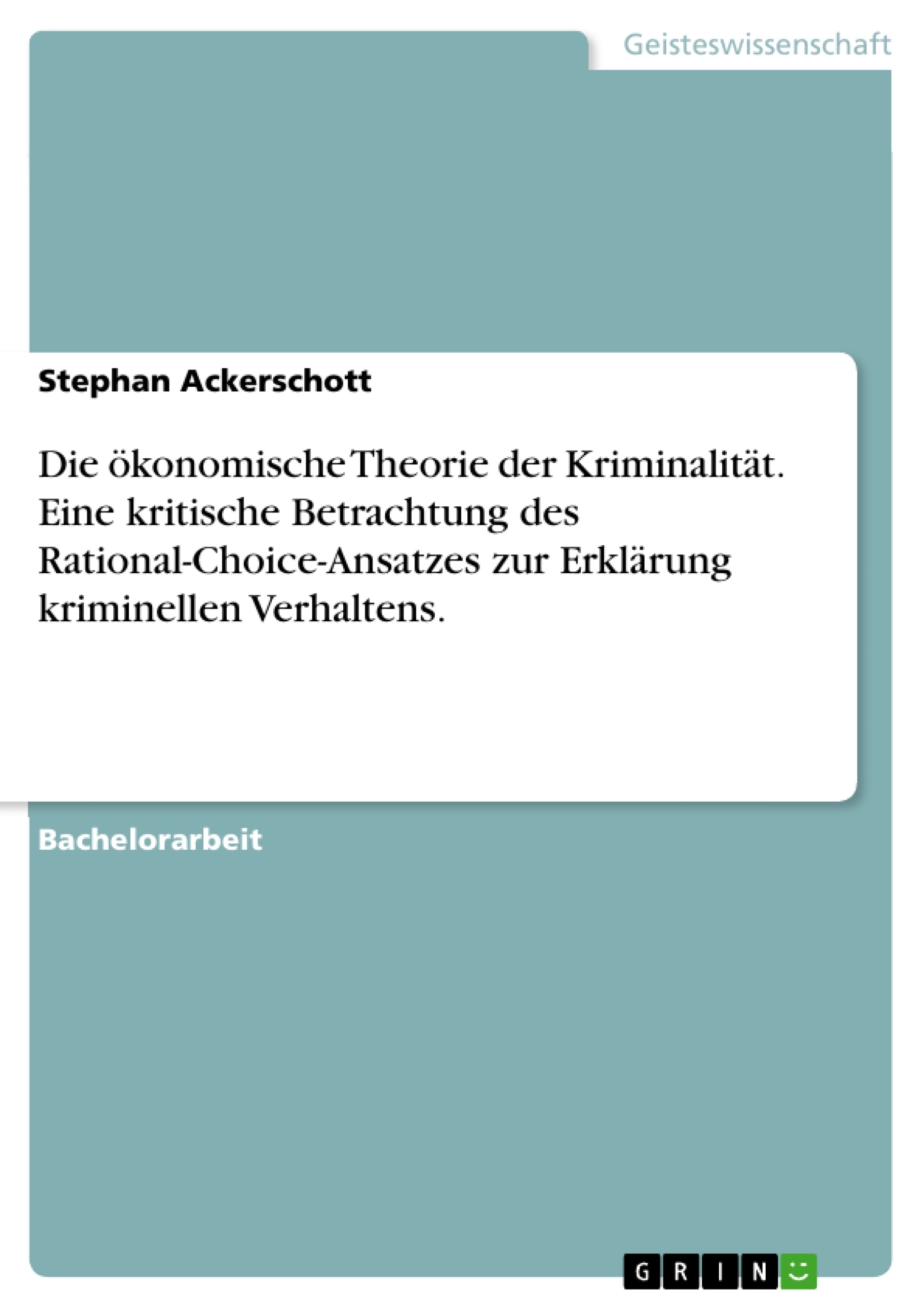Inhaltsverzeichnis II
Abbildungsverzeichnis III
Tabellenverzeichnis III
Abkürzungsverzeichnis IV
1 Einführung in das Thema 5
2 Definitionen, Zuordnung und Abgrenzung 7
2.1 Definitionen 7
2.2 Zuordnung und Abgrenzung der Rational-Choice-Theorie 8
3 Die theoretische Basis – Von Ursachen und Lösungsstrategien 10
3.1 Das Dilemma der kriminologischen Theorien… 10
3.1.1 … am Beispiel der Anomie-Theorie nach Merton 10
3.1.2 … am Beispiel der Kontrolltheorie nach Hirschi 12
3.2 Der Rational-Choice Ansatz als Lösung aus dem Dilemma 13
3.2.1 Das Rational-Choice-Model nach Becker 13
3.2.2 Berücksichtigung der „Individuellen Risikopräferenzen“ 16
4 Kritik an der ökonomischen Kriminalitätstheorie 18
4.1 Aus der Theorie ersichtliche Kritik 19
4.2 Zwischenfazit 21
5 Überprüfung der ökonomischen Theorie der Kriminalität anhand emp. Untersuchungen 22
5.1 Überprüfung anhand der Studie von Entorf und Spengler 23
5.2 Überprüfung anhand des Täter-Opfer-Ausgleichs als Beispiel für die Wirkung von Strafe im Rational-Choice-Ansatz 27
6 Fazit 31
Literaturverzeichnis 34
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung in das Thema
- 2 Definitionen, Zuordnung und Abgrenzung
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Zuordnung und Abgrenzung der Rational-Choice-Theorie
- 3 Die theoretische Basis – Von Ursachen und Lösungsstrategien
- 3.1 Das Dilemma der kriminologischen Theorien
- 3.1.1 … am Beispiel der Anomie-Theorie nach Merton
- 3.1.2 … am Beispiel der Kontrolltheorie nach Hirschi
- 3.2 Der Rational-Choice Ansatz als Lösung aus dem Dilemma
- 3.2.1 Das Rational-Choice-Model nach Becker
- 3.2.2 Berücksichtigung der „Individuellen Risikopräferenzen“
- 3.1 Das Dilemma der kriminologischen Theorien
- 4 Kritik an der ökonomischen Kriminalitätstheorie
- 4.1 Aus der Theorie ersichtliche Kritik
- 4.2 Zwischenfazit
- 5 Überprüfung der ökonomischen Theorie der Kriminalität anhand emp. Untersuchungen
- 5.1 Überprüfung anhand der Studie von Entorf und Spengler
- 5.2 Überprüfung anhand des Täter-Opfer-Ausgleichs als Beispiel für die Wirkung von Strafe im Rational-Choice-Ansatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die ökonomische Kriminalitätstheorie und ihren Rational-Choice-Ansatz. Das Hauptziel ist die Klärung, ob dieser Ansatz ein sinnvolles Handlungskonzept zur Erklärung kriminellen Verhaltens bietet und ob er das Erklärungsdilemma soziologischer Theorien löst. Die Arbeit prüft auch die These, dass eine Erhöhung/Verringerung des Strafmaßes den Nettonutzen einer Tat senkt/erhöht und somit Kriminalität verringert/steigert.
- Die ökonomische Kriminalitätstheorie und der Rational-Choice-Ansatz
- Das Erklärungsdilemma soziologischer Kriminalitätstheorien
- Der Einfluss von Strafe und Abschreckung auf Kriminalität
- Empirische Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Strafe und Kriminalität
- Kritische Auseinandersetzung mit den Annahmen des Rational-Choice-Modells
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung in das Thema: Die Arbeit beginnt mit der Feststellung, dass Kriminalität oft als Schichtenproblem betrachtet wird, wobei die Ursachenforschung sich häufig auf sozial schwächere Schichten konzentriert. Dies wird auf die Dominanz bestimmter Theorien und die begrenzte Aussagekraft einzelner kriminologischer Ansätze zurückgeführt. Die Arbeit stellt die Frage, ob die ökonomische Kriminalitätstheorie mit dem Rational-Choice-Ansatz einen Beitrag zur Lösung dieses Dilemmas leisten kann, und fokussiert sich auf den von Gary Becker entwickelten Ansatz.
2 Definitionen, Zuordnung und Abgrenzung: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie Kriminologie, Kriminalistik und Kriminalität. Es differenziert die Ökonomie des Rechts und die Ökonomie der Kriminalität und ordnet den Rational-Choice-Ansatz innerhalb des Gefüges verschiedener Kriminalitätstheorien ein, grenzt ihn von ätiologischen und konstruktivistischen Theorien ab.
3 Die theoretische Basis – Von Ursachen und Lösungsstrategien: Dieses Kapitel beleuchtet das Dilemma der kriminologischen Theorien anhand der Anomie-Theorie (Merton) und der Kontrolltheorie (Hirschi). Beide Theorien zeigen zwar Zusammenhänge zwischen sozialen Faktoren und Kriminalität auf, bieten aber kein umfassendes Handlungskonzept. Der Rational-Choice-Ansatz wird als Lösungsansatz präsentiert, der von einem nutzenmaximierenden Verhalten aller Individuen ausgeht, unabhängig von delinquenten Neigungen.
4 Kritik an der ökonomischen Kriminalitätstheorie: Dieses Kapitel kritisiert die ökonomische Kriminalitätstheorie. Es hinterfragt die Annahmen des Handelns unter Risiko (statt Unsicherheit), die Nutzenmaximierung (inkl. der Schwierigkeit, psychische Kosten zu quantifizieren), und den Neutralitätsaspekt. Die begrenzte Voraussagefähigkeit des Modells wird ebenfalls diskutiert.
5 Überprüfung der ökonomischen Theorie der Kriminalität anhand emp. Untersuchungen: Dieses Kapitel präsentiert zwei empirische Studien. Die Studie von Entorf und Spengler untersucht den Zusammenhang zwischen Strafhöhe, Strafverfolgung und Kriminalität und zeigt eine potenzielle Schadensreduktion durch Abschreckung. Die zweite Studie analysiert den Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) und dessen Wirkung auf die Kriminalitätsbekämpfung im Licht des Rational-Choice-Ansatzes.
Schlüsselwörter
Ökonomische Kriminalitätstheorie, Rational-Choice-Ansatz, Kriminalität, Strafe, Abschreckung, Nutzenmaximierung, Risikopräferenzen, Anomie-Theorie, Kontrolltheorie, Empirische Untersuchung, Täter-Opfer-Ausgleich.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Ökonomische Kriminalitätstheorie und Rational-Choice-Ansatz
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die ökonomische Kriminalitätstheorie und ihren Rational-Choice-Ansatz. Das Hauptziel ist die Klärung, ob dieser Ansatz ein sinnvolles Handlungskonzept zur Erklärung kriminellen Verhaltens bietet und ob er das Erklärungsdilemma soziologischer Theorien löst. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Einfluss der Höhe des Strafmaßes auf die Kriminalität.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die ökonomische Kriminalitätstheorie und den Rational-Choice-Ansatz; das Erklärungsdilemma soziologischer Kriminalitätstheorien (am Beispiel der Anomie- und Kontrolltheorie); den Einfluss von Strafe und Abschreckung auf Kriminalität; empirische Überprüfungen des Zusammenhangs zwischen Strafe und Kriminalität; und eine kritische Auseinandersetzung mit den Annahmen des Rational-Choice-Modells.
Welche Theorien werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht im Detail die Anomie-Theorie nach Merton und die Kontrolltheorie nach Hirschi als Beispiele für soziologische Kriminalitätstheorien, die ein Erklärungsdilemma aufweisen. Im Mittelpunkt steht jedoch der Rational-Choice-Ansatz nach Becker, der als Lösungsansatz präsentiert wird.
Wie wird der Rational-Choice-Ansatz in der Arbeit bewertet?
Die Arbeit bewertet den Rational-Choice-Ansatz kritisch, indem sie die Annahmen des Handelns unter Risiko (statt Unsicherheit), die Nutzenmaximierung (inkl. der Schwierigkeit, psychische Kosten zu quantifizieren), und den Neutralitätsaspekt hinterfragt. Die begrenzte Voraussagefähigkeit des Modells wird ebenfalls diskutiert.
Welche empirischen Untersuchungen werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf zwei empirische Studien: die Studie von Entorf und Spengler zum Zusammenhang zwischen Strafhöhe, Strafverfolgung und Kriminalität, und eine Studie zum Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) und dessen Wirkung auf die Kriminalitätsbekämpfung im Licht des Rational-Choice-Ansatzes.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Ökonomische Kriminalitätstheorie, Rational-Choice-Ansatz, Kriminalität, Strafe, Abschreckung, Nutzenmaximierung, Risikopräferenzen, Anomie-Theorie, Kontrolltheorie, Empirische Untersuchung, Täter-Opfer-Ausgleich.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 (Einführung): Stellt das Problem der Kriminalitätserklärung und den Fokus auf die ökonomische Kriminalitätstheorie vor. Kapitel 2 (Definitionen): Klärt grundlegende Begriffe und ordnet den Rational-Choice-Ansatz ein. Kapitel 3 (Theoretische Basis): Analysiert das Dilemma soziologischer Theorien und präsentiert den Rational-Choice-Ansatz als Lösung. Kapitel 4 (Kritik): Kritisiert die Annahmen und die Voraussagefähigkeit der ökonomischen Kriminalitätstheorie. Kapitel 5 (Empirische Überprüfung): Präsentiert und analysiert empirische Studien zur Überprüfung des Rational-Choice-Ansatzes.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht die Schlussfolgerung, ob der Rational-Choice-Ansatz ein sinnvolles Handlungskonzept zur Erklärung kriminellen Verhaltens darstellt und ob er das Erklärungsdilemma soziologischer Theorien löst. Die Ergebnisse der empirischen Studien werden zur Beurteilung herangezogen.
- Arbeit zitieren
- Stephan Ackerschott (Autor:in), 2013, Die ökonomische Theorie der Kriminalität. Eine kritische Betrachtung des Rational-Choice-Ansatzes zur Erklärung kriminellen Verhaltens., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211320