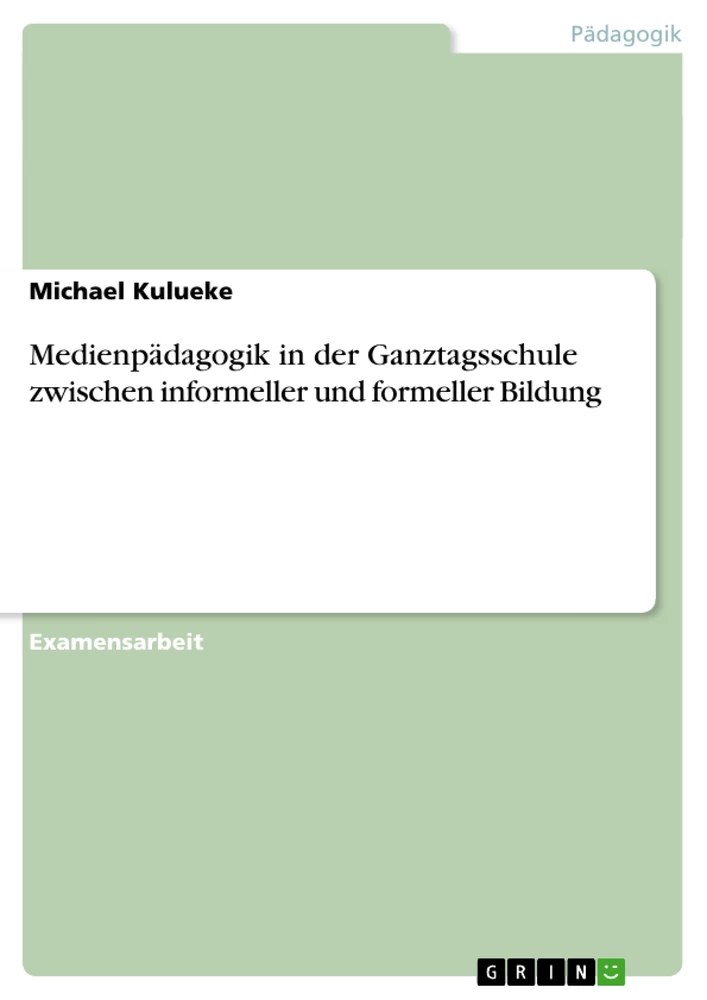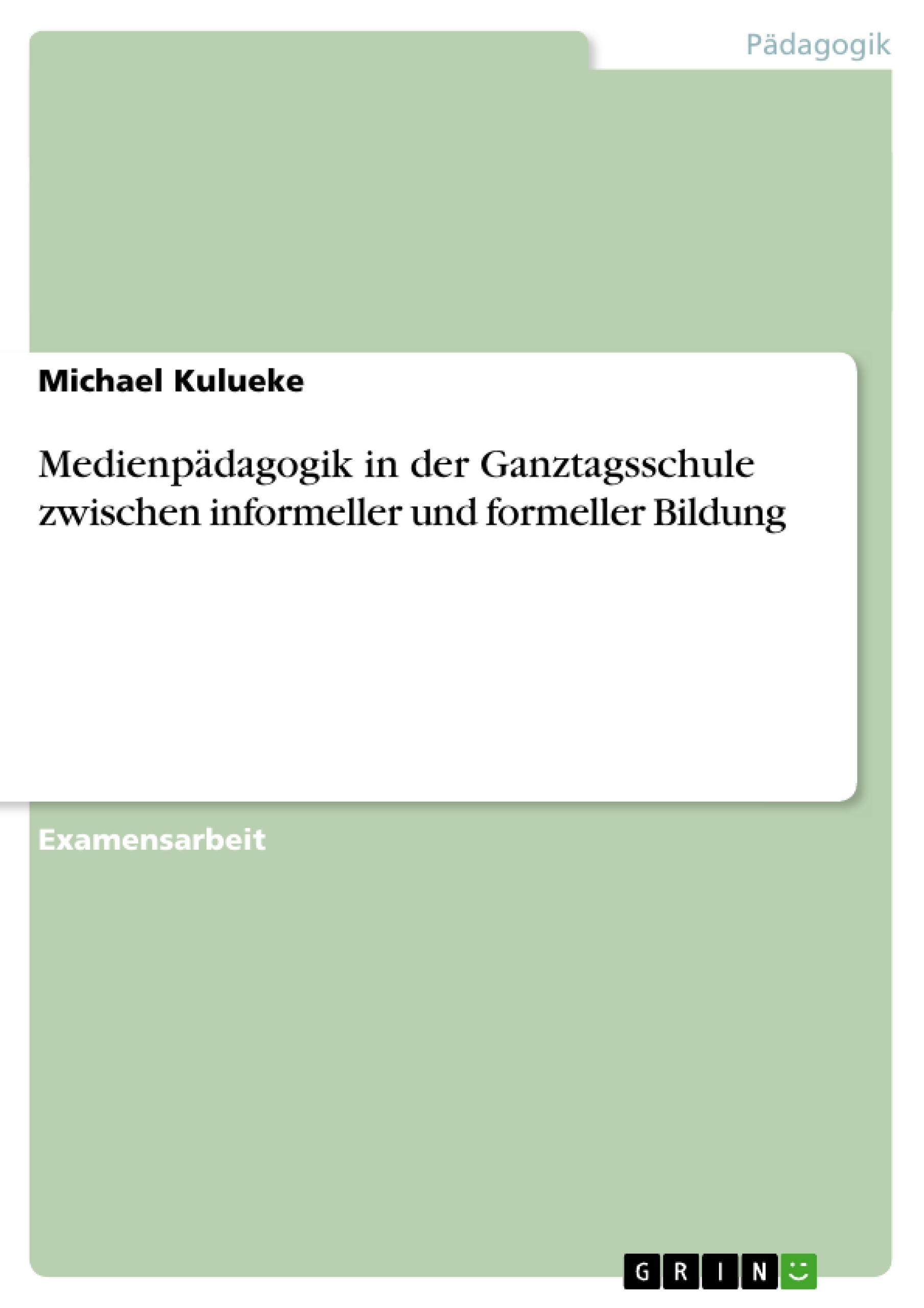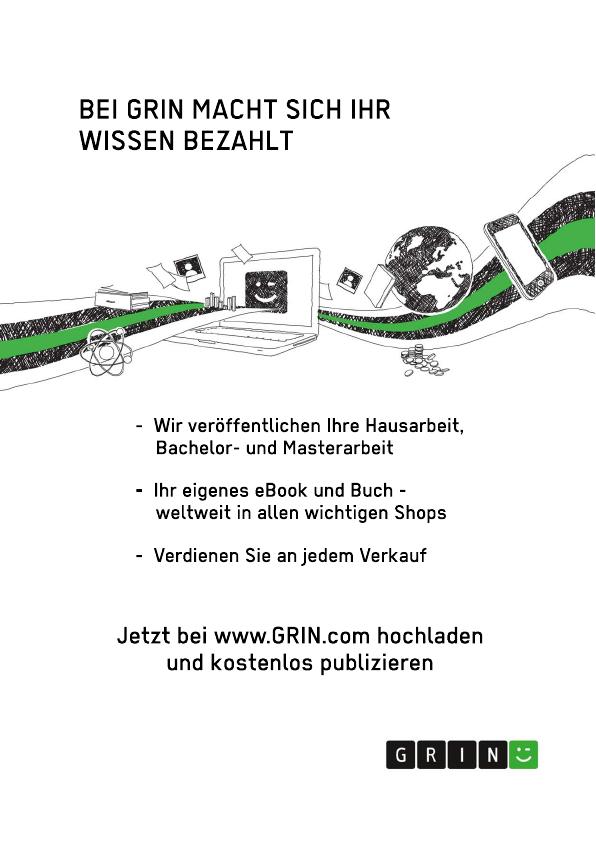Die PISA-Studie des Jahres 2000 gilt gemeinhin als Fixpunkt einer Reihe von bildungspolitischen und -theoretischen Initiativen sowie Debatten, in deren Verlauf praktisch umsetzbare Reaktionen auf das verhältnismäßig schlechte Abschneiden der deutschen Teilnehmer gefunden werden sollten. Hinzu kamen Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg und den sich daraus ergebenden geringeren Chancen für Menschen mit niedrigerem sozialen Status auf erfolgreiche Positionierung auf dem Arbeitsmarkt und adäquater Teilhabe an einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft.
Zudem wurden Veränderungen in der Gesellschaft sichtbar, die deutlich werden ließen, dass die traditionelle Konzeption von Schule, oft ätzend als 'Beschulung' tituliert, an den Lebensrealitäten und damit an den die Lernenden unmittelbar betreffenden Erfordernissen vollkommen vorbeilehrt. Damit einher geht ein Wirksamkeitsverlust, der nicht nur die Politik und potentielle Arbeitgeber aus der freien Wirtschaft aufschreckt. Die Bildungsdiskussion der letzten zehn Jahre hat eben den autarken und von der sich verändernden Gesellschaft losgelösten Charakter der klassischen Schule als einen der Gründe für diesen Missstand ausgemacht, und als Maßnahme der ersten Wahl gilt die Ganztagsschule. Mit dem Konzept der Ganztagsschule werden Möglichkeiten verbunden, näher an die Lernenden und deren Lebensrealität heran zu rücken, und unter weitestgehender Schonung der Ressourcen der traditionellen Lehrkräfte neue Lernanreize zu schaffen. Zudem soll damit auf Entwicklungen reagiert werden, die einen erhöhten Bildungsbedarf konstatieren und diesen eben nicht durch das traditionelle Bildungssystem gedeckt sehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Medienpädagogik im schulischen Kontext
2.1. Theoretische Medienpädagogik
2.2. Praktische Medienpädagogik
2.2.1. Praktische Medienpädagogik und Empirie
3. Ganztagsschulen
3.1. Ziele von Ganztagsschulen
3.1.1 Ganztagsschulen und Empirie
3.2. Ganztagsschulen und der Stellenwertvon Medienpädagogik
3.2.1. Medienpädagogik und soziale Ungleichheit
3.3. Ganztagsschulen und Kooperation
3.3.1. Sozialarbeit und Bildung
3.3.2. Sozialarbeit und soziale Unterschiede
3.3.3. Sozialarbeit und Empirie
3.3.4. Sozialarbeit und Medienpädagogik
4. Informelles Lernen
4.1. Definitionen und Theorien
4.1.1 Konsequenzen für das Verständnis von Bildung
4.1.2 Spannungen und Korrelationen zwischen formellem und informellem Lernen
4.2. Informelles Lernen und Medienpädagogik
4.3. Informelles Lernen und Sozialarbeit
5. Analyse
6. Schlussfolgerung
7. Literaturverzeichnis
1. Einführung
Die PISA-Studie des Jahres 2000 gilt gemeinhin als Fixpunkt einer Reihe von bildungspolitischen und -theoretischen Initiativen sowie Debatten, in deren Verlauf praktisch umsetzbare Reaktionen auf das verhältnismäßig schlechte Abschneiden der deutschen Teilnehmer gefunden werden sollten. Hinzu kamen Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg und den sich daraus ergebenden geringeren Chancen für Menschen mit niedrigerem sozialen Status auf erfolgreiche Positionierung auf dem Arbeitsmarkt und adäquater Teilhabe an einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft.
Zudem wurden Veränderungen in der Gesellschaft sichtbar, die deutlich werden ließen, dass die traditionelle Konzeption von Schule, oft ätzend als 'Beschulung' tituliert, an den Lebensrealitäten und damit an den die Lernenden unmittelbar betreffenden Erfordernissen vollkommen vorbeilehrt. Damit einher geht ein Wirksamkeitsverlust, der nicht nur die Politik und potentielle Arbeitgeber aus der freien Wirtschaft aufschreckt. Die Bildungsdiskussion der letzten zehn Jahre hat eben den autarken und von der sich verändernden Gesellschaft losgelösten Charakter der klassischen Schule als einen der Gründe für diesen Missstand ausgemacht, und als Maßnahme der ersten Wahl gilt die Ganztagsschule. Mit dem Konzept der Ganztagsschule werden Möglichkeiten verbunden, näher an die Lernenden und deren Lebensrealität heran zu rücken, und unter weitestgehender Schonung der Ressourcen der traditionellen Lehrkräfte neue Lernanreize zu schaffen. Zudem soll damit auf Entwicklungen reagiert werden, die einen erhöhten Bildungsbedarf konstatieren und diesen eben nicht durch das traditionelle Bildungssystem gedeckt sehen.
In Hinblick auf die potentiell defizitäre Berücksichtigung medienpädagogischer Fragestellungen und deren Rückwirkungen auf die Lernenden sowie deren Verortung in der Gesellschaft sind die offiziellen Vorschläge allerdings weitgehend unklar, genauso wie verschiedene Konzepte von Lernen neuerdings Erwähnung finden, aber in der pädagogischen Praxis kaum Relevanz haben.
Die Implikationen für den Bildungsbetrieb sind also mannigfaltig und auf den ersten Blick ziemlich ungenau definiert. Diese Arbeit setzt nun an genau diesem Punkt an, an dem es potentielle Zusammenhänge zwischen Medienpädagogik und deren Verortung in einem neuen Bildungsbegriff gibt, die bislang jedoch vor allem in der Praxis nicht oder kaum genutzt werden.
Denn in direktem Zusammenhang mit der deutschen Bildungsmisere steht der zunehmende Bedeutungsverlust der Institution Schule hinsichtlich medienpädagogischer Einflussnahme. Ein Großteil der deutschen Lernenden erwirbt Kompetenzen im Umgang mit Neuen Medien vor allem in der akuten Lebenswelt abseits der Institution Schule, dies obwohl medienpädagogische Überlegungen und Anregungen distinkter Bestandteil der Bildungstheorie sowie der bildungspolitisch festgelegten Richtlinien für die Praxis in Schulen sind. So selbstverständlich wie Heranwachsende heutzutage mit neuesten kommunikationstechnologischen Errungenschaften und deren marktgerechten Umsetzungen für den Nutzer umgehen, so tut die Institution Schule dies nicht bzw. kaum. Dies kann ein weiteres Indiz für die fatale Entfremdung der Institution Schule von der Lebensrealität seiner Schutz- und Bildungsbefohlenen sein.
Angesichts des zunehmenden Einflusses von Neuen Medien auf die heutige Lebenswelt vor allem der Heranwachsenden ist klar, dass auch die Bedeutung von Medienpädagogik stetig wächst. Dennoch wird diesem Bereich vor allem in den dem Bildungssystem zugrundeleigenden Institutionen sehr wenig Bedeutung beigemessen. Noch mehr scheint Medienpädagogik in der Praxis vernachlässigt zu werden; als Mittel zum einfachen Zweck sind die digitalen Medien zwar inzwischen größtenteils im Unterricht angekommen, jedoch mangelt es nach wie vor an einer tiefgreifenderen Beschäftigung mit diesen, insbesondere was deren Nutzen betrifft. Daher wird in der vorliegenden Arbeit auch auf die Defizite und den Handlungsbedarfeingegangen, die die Bildungseinrichtungen im Bereich der Medienpädagogik aufweisen. Auch hier, so die Theorie, hat das Konzept der Ganztagsschule, die in Kooperation mit Sozialarbeit weitergehende Bildungsformen zusätzlich zum curricularen Unterricht für alle Lernenden anbietet, die größten Chancen, Medienpädagogik wirksam und zielgerecht umzusetzen.
Der erste Teil beschäftigt sich mit für die Bildungspraxis relevanten medienpädagogischen Fragestellungen und deren Stellenwert im aktuellen Schulbetrieb. Auf dies wird im weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder zurückgegriffen, vor allem der Begriff der Medienkompetenz wird weiterhin von Bedeutung sein.
Im zweiten Teil folgt eine Darstellung der verschiedenen Konzepte von Ganztagsschulen und der damit theoretisch avisierten Ziele und verbundenen Bedingungen, vor allem hinsichtlich der Erweiterung des Schulbetriebs in Kooperation mit Partnern wie der Jugendhilfe (welche im Folgenden wegen der wechselnden Begriffe in der Fachliteratur unter dem Begriff der Sozialarbeit zusammengefasst wird). Die Konzepte von Ganztagsschulen sowie Sozialarbeit werden jeweils unter allgemein bildungstheoretischen wie medienpädagogischen Gesichtspunkten untersucht. Besonderes Augenmerk wird auf einen der großen Kritikpunkte der PISA-Studien gelegt: die soziale Ungleichheit. Diese setzt sich nicht nur im Bildungssystem fort, sondern auch in den Neuen Medien und steht damit in direktem Zusammenhang mit dem medienpädagogischen Auftrag des Bildungssystems.
Der dritte Teil befasst sich mit Theorien zu informeller Bildung, deren Korrelation zur formellen bzw. non-formellen Bildung sowie deren potentieller Bedeutsamkeit in der mit Medien angereicherten Welt der Lernenden. Eine Betrachtung der Implementierungsmöglichkeiten von informellen Lernprozessen in Angebote der Sozialarbeit schließt diesen Teil ab.
Zur Darstellung der drei Punkte wurden einschlägige und maßgebliche Werke sowie empirisch belegte Erkenntnisse der Fachwissenschaft eingebracht.
Die Arbeit wird mit einer Analyse der Bedeutung medienpädagogischer Prämissen unter Berücksichtigung informeller Lernprozesse im Kontext eines sich verändernden und öffnenden Bildungsbegriffs, deren aktuelle Form die Ganztagsschule ist, zusammengefasst und mit einer finalen Schlussfolgerung abgeschlossen.
2. Medienpädagogik im schulischen Kontext
Ausgehend von der Tatsache, dass im 21. Jahrhundert Medien nicht mehr aus modernen Gesellschaften wegzudenken sind und gerade von Heranwachsenden in großem und immer noch zunehmendem Umfang konsumiert und wahrgenommen werden, wird zu Beginn kurz herausgearbeitet inwieweit die aktuellen Zustände sich auch in der Bildungstheorie wiederfinden und in der -praxis umgesetzt worden sind.
2.1. Theoretische Medienpädagogik
Die für diese Arbeit maßgebliche Herangehensweise an Medienbildung ist die der strukturalen Medienbildung, die von Winfried Marotzki und Benjamin Jörissen in den Kontext der prozessualen Selbstentwicklung gestellt wird. Das Verständnis von strukturaler Bildung hebt sich damit von der schieren Vermittlung von Wissen als autarke Informationsaneignung ab und zielt vor allem auf Kontextualisierung, Flexibilisierung, Dezentrierung und Pluralisierung von Wissen- und Erfahrungsmustern (Marotzki 2008: 100), welche den Menschen damit in eine nicht abgeschlossene und stetig fortlaufende Entwicklung anhand sich anreichernder und immer wieder reflektierter und neu betrachteter Lebenserfahrungen und Informationen stellt. Dies erlaubt dem Menschen, sich immer wieder auf andere, nicht antizipierte und erfahrene Einflüsse einzulassen und sich in diesen kompetent, also selbstbestimmt und mündig, zu bewegen. Später wird in anderer Form mit dem Bezug zur Sachdimension (das Verhältnis des Menschen zur dinglichen Welt und seiner Möglichkeit selbst in dieser zu agieren), Sozialdimension (das Verhältnis des Menschen zu seinen Mitmenschen, zur Gesellschaft sowie die Möglichkeit mit diesen zu interagieren) und zur Zeitdimension (das Verhältnis des Menschen zu sich selbst und seinem Werden) rekapituliert werden. Hierbei wird die soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns aufgegriffen.
Die Rolle der Medien in dieser Hinsicht eröffnet sich, sobald man Medien als komplexen Raum neuer Erfahrungsmöglichkeiten betrachtet. In diesem gehen Heranwachsende nicht nur mit komplexen Arrangements und Formen von Informationen um. Sie nutzen ihn auch seit einiger Zeit und stetig zunehmend als maßgeblichen Raum sozialen Umgangs und damit als neue Welt, in der das Individuum vor neue Herausforderungen hinsichtlich seines Verhältnisses zu den drei Dimensionen gestellt wird. Dabei lässt sich bei zunehmender Vermischung der digitalen und nicht-digitalen Welt nicht nur hinsichtlich der Verortung der Medien unterscheiden. Wo vor der Jahrtausendwende noch eine strikte Trennung zwischen voneinander getrennten Medienformen stattgefunden hat (TV/Kino, CD/MC/Radio, Printmedien/Computer), verschwimmen die Grenzen immer mehr. Stetig neue Innovationen sorgen für eine sich ständig verändernde Welt, und mit dieser ändern sich auch ständig die Herausforderungen an das Individium. Die vollständige Auflistung der aktuellen medialen Partizipations- und Konsummöglichkeiten würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Marotzki schreibt, die Herausforderung an die Bildungspraxis liege darin, zu erkennen, inwieweit sich in diesem praktischen Umgang mit digitalen Inhalten und digitaler Kommunikation Lerninhalte realisieren lassen, beziehungsweise schon (non-)intentional realisiert sind:
"Aus Sicht der Medienbildung gilt es mithin, die reflexiven Potentiale von medialen Räumen einerseits und medialen Artikulationsformen andererseits im Hinblick auf die genannten Orientierungsleistungen und -dimensionen analytisch zu erkennen und ihren Bildungswert einzuschätzen." (Marotzki 2008: 103)
Dabei würden Medien stets als Einflüsse wahrgenommen, die durch Konsum oder Partizipation nicht nur die Wahrnehmung des Menschen ändern, sondern auch ihn selbst und damit die Orientierungsleistungen, die er im Diskurs mit den drei Dimensionen bewältigen muss. (ebd.: 108)1
Die Wahrnehmung der Medien als bedeutender Bestandteil der modernen Lebenswelt habe freilich Wirkung auf die pädagogische Praxis. So sei vor allem die Frage von Interesse, wie auf die Nutzung und Wahrnehmung von Medien eingewirkt werden kann, um den Heranwachsenden zu einer dem aktuellen pluralistischen und demokratischen Bildungsideal entsprechender kritischreflektierender Haltung verhelfen zu können. Gerhard Tulodzieki benennt dafür die folgenden fünf Aufgabenbereiche von Medienerziehung:
1. Auswählen und Nutzen von Medienangeboten (Handlung)
2. Eigenes Gestalten und Verbreiten von Medienbeiträgen (Handlung)
3. Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen (Reflexion)
4. Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen (Reflexion)
5. Durchschauen und Bewerten von Bedingungen (Reflexion)
(Tulodziecki 2008: 112; vgl. Hugger 2008: 94; vgl. Süss 2010: 110; vgl. Moser 2010: 242)
Dies stellt zusammengefasst Grundbegriffe der Theorie von Medienkompetenz dar, die als zentraler Zielbegriff von Medienpädagogik verstanden wird und sich aufden selbst- und nicht fremdbestimmten Umgang mit Medien richtet:
"Kinder, Jugendliche und Erwachsene müssen in ihren immer mehr durch Medialisierung gekennzeichneten Lebenswelten in der Lage sein, Medien selbst organisiert, reflektiert und kreativ zu nutzen, ihre symbolische Umwelt eigenständig zu strukturieren und mit Sinn zu versehen, (Hugger2008: 95)
Die Aufgabe der Medienpädagogik bestehe also letztlich darin, solchen Menschen, die zur Medienkompetenz als Ganzes oder in (dargelegten) Teilen nicht in der Lage seien Wege, Mittel und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um dieses zentrale Ziel doch noch zu erreichen. Dabei sei die letztliche Ausgestaltung derselben in einer pluralen Bildungslandschaft eben der jeweiligen Didaktik überlassen, die unter Zuhilfenahme medienpädagogischer Erkenntnisse zu eben dieser Leistung imstande sei. (vgl. Moser 2010: 290-299)
Hier ist zu bedenken, dass medienpädagogisches Handeln stets an die Unsicherheit der Verbindung von Medienhandeln, Medienkompetenz und die zeitliche Validität von bereits angeeigneter Medienkompetenz in einer sich stetig technologisch sowie symbolisch verändernden Medienlandschaft gebunden ist. Damit ist die Gewährleistung von Medienkompetenz per se nicht sicher gestellt. (vgl. Hugger 2008) In der pädagogischen Praxis ist vor allem von Bedeutung, dass Medienkompetenz kein verallgemeinbarer Begriff ist, der umfassend auf die pädagogische Begleitung von heranwachsenden Lernenden ist, sondern stets unter Berücksichtigung der individuellen Lebensrealität eines Menschen zu betrachten ist. (vgl. Niesyto 2007)
2.2. Praktische Medienpädagogik
Zwar haben Medien wiederkehrende Erwähnung in Diskussionen der Bildungstheorie gefunden, in der Bildungspolitik lassen die Umsetzungen dieser Erkenntnisse allerdings zu wünschen übrig. Für eine Erfassung wurden stichprobenartig und ohne genaue hinterlegte Methode die Schulgesetze der Bundesländer Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen geprüft, sowie die aktuellen Lehrpläne für sämtliche Fächer der Gymnasien und Gesamtschulen des Landes Nordrhein-Westfalen.
Im Schulgesetz des Landes Niedersachsen finden Medien ihre einzige Erwähnung in der Tatsache, dass die Kreise verpflichtet sind, ihre Schulen mit audiovisuellen Medien zu versorgen, also u.a. den klassischen Medien TV, Video und Audio. Digitale Medien werden mit keinem Wort erwähnt. (vgl. Bundesland Nordrhein-Westfalen 2011)
Das Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen erwähnt Medien explizit, aber undifferenziert im Lehrauftrag der Schulen:
"(5) Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen..[...] mit Medien verantwortungsbewusst und sicher umzugehen." (Bundesland Nordrhein-Westfalen 2011: 2)
Darüber hinaus werden Medien nicht weiter ausführend als Lernmittel erwähnt, wobei vollkommen offen bleibt, um welche Medien es sich handelt. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass die Eltern fürderhin über die Medienwahl in Sachen Sexualerziehung aufzuklären sind. Weitere Erwähnungen von Medien gibt es nicht.
Die Senatsabteilung für Bildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin verweist expliziter auf Medien:
"(2) Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen.. [...] 4. die eigenen Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeiten sowie musisch- künstlerischen Fähigkeiten zu entfalten und mit Medien sachgerecht, kritisch und produktiv umzugehen, [...]" (Bundesland Berlin 2010: 10)
Auch werden die Medien, die von den Lernenden hergestellt und bearbeitet werden können, benannt, worin sich eine größere Wahrnehmung der verschiedenen Medienformen zeigt. (ebd. 49)
Die Lehrpläne für Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen gehen detaillierter auf die Medienvielfalt und -verwendbarkeit ein. Exakte 821 Mal wird auf den Gebrauch von Medien in 45 Lehrplänen verwiesen. Dabei sind die Medien zumeist jedoch eher Mittel zum Zweck und werden nicht in ihrer eigenen Bedeutsamkeit erfasst. Medienkompetenz wird nur in 18 Lehrplänen zum Thema gemacht. Dabei wird von den insgesamt 12 Sprachen (einschließlich Deutsch) nur im Lehrplan des Fachs Englisch von Medienkompetenz als Ziel des Unterrichts gesprochen. Ernüchternd ist die Betrachtung der Kontexte, in denen von Medienkompetenz gesprochen wird. In den 18 erwähnten Lehrplänen wird kein einziges Mal detaillierter auf Medienkompetenz eingegangen als schlicht zu erwähnen, dass Medienkompetenz heutzutage wichtiges Ziel im Unterricht sei. Auch das Aufgabenspektrum des Fachs Informatik wird vor allem in der Vermittlung von technologischem Wissen gesehen und nicht in der Vermittlung von Medienkompetenz. Letzteres wäre vor allem durch fächerübergreifende Unternehmungen zu gewährleisten. Allein die Richtlinie zur fächerübergreifenden politischen Bildung geht explizit und detailliert auf Medienkompetenz ein, und schätzt Medienkompetenz klar als Voraussetzung von selbstbestimmter Partizipation in einer demokratischen Gesellschaft ein:
"Medienkompetenz meint in der Politischen Bildung jedoch nicht nur die Kompetenz, mit neuen Medien effektiv umzugehen. Sie zielt auch auf kritisches Verstehen von Inhalten und formalen Strukturen, auf reflektiertes Urteilen und eigenes Gestalten im Kommunikationsprozess." (Bundesland Nordrhein-Westfalen 2001:l12)
Damit ist die Funktion, die Medienkompetenz schon in der Theorie zugeschrieben worden ist, auch in der Schule angekommen. Ob sie dort allerdings umgesetzt wird, ist eine andere Frage, der im Folgenden kurz nachgegangen wird.
2.2.1. Praktische Medienpädagogik und Empirie
Die Verortung von auf eben dieses Ziel der Medienkompetenz hinarbeitenden Maßnahmen in formellen wie non-formellen Lernumgebungen stellt sich als schwierig heraus. Als non-formelle Lernumgebungen werden hier wie in der Fachliteratur Umgebungen außerhalb konstruierter Curricula und Zielsetzungen betrachtet, wie sie z.B. in Angeboten der Sozialarbeit Vorkommen. Gerhard Tulodziecki zitiert mehrere Studien aus dem Bereich der Primar- und Sekundarstufe, die vor allem auf eine sehr medienkritische wenn nicht gar medienvermeidende Einstellung von Lehr- und Erziehungskräften hindeuten. Die Folge dessen ist die Verlagerung von primären Medienkontakten und -erfahrungen in die von informeller Bildung geprägte Lebenswelt der Lernenden.
Eine u.a. von Andreas Breiter untenommene Studie aus dem Jahr 2010 konstatierte als Ergebnis, dass Lehrende auch Jahre nach der massenweisen Verbreitung von Internetzugängen und nutzerorientierter Hardware ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu Medien pflegten: Zwar benutzten Lehrende selbst zur Vorbereitung ihres Unterrichts oder zur Organisation ihrer Tätigkeit maßgeblich Computersysteme verschiedenster Art, und mehr als die Hälfte (53%) würde zumindest gelegentlich (öfter als zwei Mal im Monat) neue Medien in ihren Unterricht ein bauen. Dagegen stehen jedoch 23%, die neue Medien nur einmal im Monat in den Unterricht einbrächten, weitere 19%, die dies nur zweimal im Halbjahr machten und 5%, die komplett auf die Einbringung neuer Medien in ihren Unterricht verzichteten. Im Jahr 2007 gab eine Studie den Computergebrauch im Unterricht mit mehr als 75% an, was jedoch nicht ausdifferenziert wird, und daher nur bedingt aussagekräftig ist. (Revermann 2007: 60) Bei der Verwendung der Medien stünde der Lehrer selbst im Zentrum der Nutzung; nur 40% gaben an, die Lernenden mindestens gelegentlich selbst mit Mitteln der neuen Medien arbeiten zu lassen.
Gerade in den unteren Klassen würde vornehmlich auf den Einsatz von Medienformen verzichtet, da die Prioritäten der Lehrenden auf andere Kompetenzfelder gesetzt würden, die es aufzuarbeiten gelte. Besonders an Gesamtschulen würde der Gebrauch von Medien im Unterricht kritisch gesehen und eher ausgelassen als sinnvoll implementiert.
Wenn die Lernenden selbsttätig mit Medien arbeiteten, wäre es vornehmlich fremdgesteuert und eine Tätigkeit, die nur bedingt zur sinnvollen Implementierung in einen reflexiven Unterricht tauglich ist. Mit 20% dominiert die Internetrecherche nach Informationen im Internet, Tätigkeiten wie das
Strukturieren von gesammelten Informationen, das mediale Gestalten sowie Kooperationsformen sind mit jeweils 10% deutlich geringer angesiedelt. Diese Tätigkeiten lassen sich nur schwer mit einem kompetenzorientierten Unterricht in Einklang bringen:
"Somit erfüllen sich die Erwartungen an einen schülerzentrierten, selbstgesteuerten Lernprozess mit Unterstützung digitaler Medien bisher offensichtlich nur in ausgewählten Fällen, auch wenn sich viele Lehrkräfte über das Potenzial der digitalen Medien diesbezüglich im Klaren sind."(Breiter 2010:6)
Eklatant gering würden die Möglichkeiten des social web oder Web2.0 eingeschätzt, deren kommunikatives wie kreatives Potential nur von 20% der Lehrenden wahrgenommen und in den Unterricht eingebaut würde. Die vorrangig in den Unterricht eingebrachten Medien seien demnach die klassischen Zeitungen und TV. Allerdings gewännen Angebote des Web2.0 zunehmend an Bedeutung, etwa ein Drittel der Lehrenden habe demnach zumindest einmal Angebote wie Wikipedia oder Youtube in ihrem Unterricht zur Sprache gebracht, die Präferenz bei mehr als 50% läge allerdings immer noch bei den klassischen Medien. Die Begründung dafür liege vor allem in der eigenen Biografie der Lehrer und dem Widerstand gegenüber den sich schnell wandelnden neuen Medien:
"Dies hängt eng mit ihren berufsbiografischen Orientierungen zusammen, die vor dem Hintergrund schulischer Mediatisierungsprozesse einem erheblichen Veränderungsdruck ausgesetzt sind." (ebd.)
Dabei seien es vor allem ältere Lehrende, die sich derart gegen die Verwendung von neuen Medien sperren. Jüngere Lehrende geben selbst eher an, mit neuen Medien vertraut zu sein und diese auch bereitwillig in den eigenen Unterricht einzubauen. Dies entspricht der Auffassung Johannes Frommes, der jede Generation als in ihren eigenen Medien sozialisiert betrachtet, die darüber hinausgehend aber mit der Wahrnehmung neuer Medien oft überfordert sei. (Fromme 2002: 72-73)
Die Widerstände gegen die Aufnahme von neuen Medien, selbst wenn sie von institutioneller Seite angeboten würden, manifestierten sich vor allem in der Auffassung, dass viele dieser Angebote keinen sofort erfahrbaren Mehrwert gegenüber der Beschäftigung mit klassischen Medien hätten. Gründe der Effizienz und der Rationalisierbarkeit von Resultaten spielen als Auswahlkriterien eine bedeutende Rolle. Gegen erhöhten Vorbereitungsaufwand entscheidet man sich vor allem dann, wenn der bekannte Umgang mit Medien das subjektiv gleiche Resultat ergeben würde. Erst neuere elektronische Lernmethoden bewirken offenbar ein Umdenken, so zum Beispiel E-Learning-Bestandteile und naturwissenschaftliche Gestaltungsprogramme. Ein weiterer Vorteil der traditionellen Medien ist durch die Materialität gegeben, welche den Lernenden unmittelbaren kognitiven Zugang zu diesen erlauben, ohne dass durch das Medium selbst von dem eigentlichen Ziel abgelenkt würde:
"Daran schließt sich zweitens die von fast allen Lehrergruppen im Rahmen der Fallstudien vorgebrachte Kritik an, dass die Schülerinnen und Schüler beim Einsatz der digitalen Medien in unterschiedlichen Lernkontexten die Zusammenhänge, in denen die thematisierten Sachverhalte stehen, nicht mehr intellektuell erfassen bzw. verstehen."(Breiter2010.: 7)
Dies entspricht der klassischen Medienkritik, die das Medium vor allem als Mediator seiner selbst und erst nachrangig als Mediator bestimmter Inhalte betrachtet und demnach auch gegenüber klassischen Übermittlungsformen im Nachteil sieht. Diese Betrachtung übersieht jedoch, dass die klassischen Medien dieser Logik folgend ebenso problembehaftet sein müssten, allerdings wird die Konglomeration der klassischen Medien in den multimedialen neuen Angeboten als überforderndereingeschätzt. (ebd..: 7-9)
Einen interessanten Aspekt stellt die Auffassung vieler Lehrenden dar, dass die Medienkompetenz der Lernenden nicht ausgeprägt genug sei um erfolgreich in den Unterricht implementiert zu werden. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass viele Lernende das genaue Gegenteil wahrnehmen und den Lehrenden dafür die nötige Kompetenz absprechen. (vgl:http://netzwertig.com/2009/11/26/fehlende-medienkompetenz-wie-aus-lehrern- schueler-werden/; Breiter 2010.: 10) In der Studie wird noch explizit darauf hingewiesen, dass die Kompetenzen der Lernenden zwar oftmals weiter gingen als die der Lehrenden, sich allerdings selten in den von letzteren kreierten Unterrichtsstrukturen nutzen ließen. Letztlich ist es also die stark einseitig auf bestimmte Aspekte des traditionellen Unterrichts zugeschnittene Konzeption desselben, die eine sinnvolle Einbringung der bereits erworbenen oder noch zu erwerbenden Medienkompetenzen der Lernenden erschwerten. Ein Paradoxon, wenn man die eigentliche Bewusstheit der Lehrenden zur Notwendigkeit der Medienerziehung betrachtet. Die Bewusstheit sei allerdings ebenfalls sehr einseitig auf das Aufdecken und Diskutieren von Gefahren und Risiken der Medienwelt ausgerichtet, und seltener auf die Diskussion von Möglichkeiten.
Abschließend lässt sich noch konstatieren, dass die infrastrukturellen Vorraussetzungen an den Schulen ein weiteres Hindernis in der adäquaten Wahrnehmung von medienpädagogischen Möglichkeiten sind. Wo kaum leistungsfähige oder auch nur rudimentären Standards genügende Hardware zur Verfügung gestellt würde, könne ein sinnvoller Umgang mit den verschiedenen Medienarten auch nur bedingt Realität werden. Im Jahr 2007 lag die Versorgung der Schulen mit Computern zwar schon bei nahezu 100%, jedoch kam Deutschland im europaweiten Vergleich immer noch nur auf einen der hinteren Ränge bei einem Verhältnis von 15 Schülern auf einen Computer im Gegensatz zu 6 in Finnland. (Revermann 2007: 54)
Unzulänglichkeiten hinsichtlich praktischer Medienpädagogik gäbe es vor allem auf schulweiter Ebene. Wenn nur einzelne Lehrende in einem Kollegium das Thema der neuen Medien im Unterricht einbrächten, sei die Chance, dass dies auch in breiterem Maße umgesetzt wird, geringer, als wenn das Kollegium sich kollektiv mit dieser Herausforderung beschäftigte. (Breiter2010: 8)
Die Bedingungen für einen adäquaten Umgang mit Medien im schulischen Kontext könnten also besser sein. Wobei in der Studie vor allem die Mediensozialisationen der Lehrenden und das fehlende Bewusstsein von didaktischen Möglichkeiten für die im Verhältnis zu anderen Ländern (vgl. Revermann 2007) geringere Verbreitung von Medien in den Schulen verantwortlich gemacht werden. Dies stellt einen triftigen Grund dafür dar, dass die Schüler sich nach wie vor informell, sprich abseits des institutionellen Rahmens mit Medien vertraut machten und mit diesen umgingen. Die Einwirkungsmöglichkeiten der Schulen in diesem Prozess wären also von personellerwie auch materieller Seite begrenzt.
3. Ganztagsschulen
Kaum ein Diskussionsthema im Bildungsbereich wurde in den vergangenen Jahre so kontrovers und andauernd diskutiert wie das Konzept der Ganztagsschule. Gerade nach der PISA-Studie des Jahres 2000, deren Ergebnisse in Deutschland sehr selbstkritisch aufgenommen wurden, kamen in verschiedenen Teilen der Gesellschaft, des Wissenschaftsbetriebs und der Politik immer wieder Diskussionen auf, wie man die Ergebnisse der deutschen Schulen und ihrer Lernenden beeinflussen könne, so dass sie im internationalen Vergleich im Zuge der benannten Studie besser abschnitten. Der Ganztagsschule, vorher regelmäßig diskutiert, aber zur Randerscheinung degradiert, wurde durch die gefühlte Notwendigkeit der Veränderung der deutschen Bildungslandschaft vermehrt Aufmerksamkeit zuteil. Dabei wurden vor allem Fragen aufgeworfen, wie diese Ganztagsschulen überhaupt in ihrer inneren Struktur aussehen, welche neuen oder erweiterten Aufgaben sie wahrnehmen, ob und wie sie überhaupt durch Bund und Länder durchgesetzt würden.
Da die Bildung durch die föderalistische Struktur der Bundesrepublik Deutschland zu den eigenen Kompetenzen der Länder gehört, kann man nicht von einheitlichen Standards oder auch nur sich gleichenden Konzepten sprechen. Von der Kultusministerkonferenz werden Ganztagsschulen als Schulen definiert, an denen mindestens an drei Tagen in der Woche ein ganztätiges Angebot von mindestens sieben Zeitstunden bereitgestellt wird, an allen Ganztagen ein Mittagessen eingeschlossen ist und die Ganztagsangebote unter der Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung in konzeptionellem Zusammenhang mit dem Unterricht organisiert werden. (Kultusministerkonferenz 2009: 4) Diese Darstellung ist der Absicht zuzuschreiben, die verschiedenen Ansätze zur Ganztagsschule, die in den Bundesländern entstanden sind, unter einen Begriffzu vereinen.
Da es nicht nur ein Konzept von der Ganztagsschule gibt, sondern mehrere, ist es notwendig, diese in ihren Eigenheiten kurz zu beleuchten.
Heinz Günther Holtappels identifiziert drei verschiedene Grundmodelle der Ganztagsversorgung an oder in Zusammenarbeit mit Schulen:
1. Kooperation von Schule und Sozialarbeit als additiv-duales System mit Betreuung auf freiwilliger Basis außerhalb schulischer Unterrichtszeiten und Räume im Hort zu festen Zeiten oder unregelmäßig in Angeboten der Sozialarbeit - mit Schwerpunkt auf Spiel, Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen.
2. Schulen mit Ganztagsangebot in offener Form als additives Modell mit fester Schulzeit und freiwillig zu nutzenden Angebotselementen für eine Teilschülerschaft, zumeist schwerpunktmäßig konzentriert auf Mittagmahlzeit, Spiel, Sport und Freizeit sowie Hausaufgabenhilfe durch Lehr- und sozialpädagogisches Personal, teils in außerschulischer Trägerschaft.
3. Ganztagsschule in gebundener Form als integriertes Modell mit fester und obligatorischer Schulzeit für alle Schüler/-innen der Schule, teils in zeitlicher Rhythmisierung und mit gewisser Verzahnung von Unterricht und Arbeitsgemeinschaften, Projekten und Förderung, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangeboten durch Lehr- und sozialpädagogisches Personal, in der Regel in schulischer Trägerschaft. (Holtappels 2006: 6)
Hierbei differenziert er vor allem bei den Konzepten, die für den rein schulischen Ganztagsbetrieb von Belang sind: Integrative Ganztagsschulkonzepte verzahnen Inhalte des regulären vormittäglichen Unterrichts mit den Inhalten und Angeboten, die nachmittags im Schulprogramm stattfinden. Additive Ganztagsschulkonzepte lassen die Gestaltung der Inhalte des nachmittäglichen Betreuungsangebots für die Lernenden offen, ohne dabei auf eine notwendige Verbindung zum vormittäglichen Unterricht zu setzen. Gerade diese Differenzierung wird später noch von Bedeutung sein, wenn es darum geht, Verbindungsstellen zwischen formeller und informeller Bildung in der Ganztagsschule zu identifizieren.
Desweiteren wird von Holtappels zwischen Ganztagsschulen in gebundener, offener und teilweise gebundener Form unterschieden, um fest zu machen, ob und inwieweit die Teilnahme der Lernenden an den nachmittäglichen Betreuungsangeboten obligatorisch ist. Diese Unterscheidungen spielen für die weitere Betrachtung in dieser Arbeit allerdings keine Rolle und werden hier nur der Vollständigkeit halber angeführt.
Aus pädagogischer Sicht spielten bei den Konzepten von Ganztagsschulen vor allem folgende Ziele eine Rolle:
1. Optimierung des Lernerfolgs: ausgebaute Förderung und Entwicklung von Talenten bei allen, sowie dazugehörige Hilfsangebote für schwächere Lernende.
2. Variabilität der Lernkultur: Schaffung einer Vielzahl von effektiven Lehrmethoden und -formen unter Berücksichtigung der Kompetenzen der Lernenden sowie die Kreation von differenzierten Lernumgebungen in den größeren Gestaltungsräumen von Ganztagsschulen
3. Schaffung verschiedener Bildungsangebote: über den vormittäglichen Unterricht in den schultypischen Lerngruppen sollen verschiedene Angebote wie Arbeitsgruppen, Kurse sowie Projekte und andere Formen die Lernwelt der Schüler erweitern
4. Erholung und Neigung: in die Ganztagsschule sollen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für die Schüler mit einbezogen werden, die den Neigungen der Schüler entsprechen und das Bedürfnis nach Erholung und spielerischer Abwechslung befriedigen. Dabei sollen auch Möglichkeiten zur Selbstentwicklung, zum selbstständigen Gebrauch von freier Zeit und zur Mediennutzung implementiert werden.
5. Ort der Gemeinschaft: die Ganztagsschule soll Möglichkeiten zum Gemeinschaftserleben bieten und soziales sowie interkulturelles Lernen ermöglichen. Damit sollen unter anderem Sozialbeziehungen und -kompetenzen gefördert werden.
6. Die Rolle des Lernenden: in der Ganztagsschule kann der Lernende zu einer aktiveren Rolle im Schulleben gelangen. Die Mitwirkung von Lernenden und Eltern führe zur Übernahme sozialer Verantwortung und zur Entwicklung von moralisch-kognitiverUrteilsfähigkeit und demokrativer Gestaltungskompetenz.
Diese u.a. von Heinz Günther Holtappels zusammengetragenen Ziele der pädagogischen Konzeption (Holtappels 2006: 7) wurden beinahe wortgleich von Gertrud Oelerichs 2007 erschienener Beschreibung der aktuellen Situation von Ganztagsschulen (Oelerichs 2007: 20) aufgegriffen und in dem von Hans-Uwe Otto und Thomas Coelen herausgegebenen Handbuch über Ganztagsbildung unter anderen von Nadia Kutscher (Kutscher 2008: 63-66), Uwe H. Bittlingmayer (Bittlingmayer 2008: 170-171) und von Franz Bettmer (Bettmer 2008: 217-220) rezipiert.
Die Pluralität an Umsetzungen des Oberbegriffs 'Ganztagsschule' zeigt sich vor allem in der Einbindung von schulexternen Trägern und Vermittlung von Projekten im Zuge der nachmittäglichen Betreuung, aber auch in der Ansprache der Schüler oder der Beteiligung der Kollegien sind Holtappels zufolge deutliche Unterschiede identifizierbar. Beispiele dafür sind die unterschiedlichen (oder gar fehlenden) Öffnungen der Schulen gegenüber nichtschulischen Vermittlern von Bildungsinhalten aus dem kommunalen Gemeinwesen oder privater Anbieter. Die Öffnung einer Schule gegenüber externen Anbietern von Bildungsinhalten kann unter der bleibenden Trägerschaft geschehen, oder bei vollkommener Trennung von der Trägerschaft der Schule. Gleichwohl ist es von Bundesland zu Bundesland und von Schule zu Schule anders, ob und inwieweit gebundene (d.h. verpflichtende) Aktivitäten nach dem regulären Schulbetrieb mit offenen kombiniert werden, und ob die gesamte Schülerschaft mit diesen Maßnahmen angesprochen wird oder nur ein von den Trägern/der Schule genau festgelegter Teil der Schülerschaft.
Die rein organisatorischen Möglichkeiten zur Entwicklung des Konzepts einer Ganztagsschule sind hier, auch von Holtappels selber, nur skizzenhaft umschrieben, was an der Variablität des von der Kultusministerkonferenz im Jahr 2003 festgelegten Begriffs der ganztägigen Schulen liegt. Die einzige Gemeinsamkeit all dieser Ganztagsschulkonzepte sei, wie Gertrud Oehlerich 2007 feststellte, dass ein umfangreicherer Zeitrahmen, als in Halbtagsschulen zur Verfügung stehe. Die offene Ausnutzung dieses Rahmens bringt sie wie folgt auf den Punkt:
"Wie dieser Zeitrahmen ausgefüllt wird, was über den (Vormittags-)Unterricht hinaus angeboten und von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden kann bzw. muss, differiert ebenso wie die Fragen, welche Institutionen - die Schule oder andere Träger z.B. die Sozialarbeit, Volkshochschulen oder Sportvereine - das Angebot verantworten und durchführen, welche wie ausgebildeten Mitarbeiterinnen oder ehrenamtliche Helferinnen aktiv beteiligt sind, wie oft und wo welche Ganztagsangebote stattfinden und mit welcher Verbindlichkeit das Angebot von welcher Gruppe von Schülerinnen und Schülern einer Schule genutzt wird." (Bettmer et al. 2007: 15)
Diese Problematik der nicht genau festzulegenden Strukturen einer Ganztagsschule erschwert einerseits die theoretische Aufarbeitung und Erforschung derselben, ermöglicht andererseits jedoch die praktische Anpassung der Ganztagsschule an die organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten des jeweiligen kommunalen Umfelds. Dies wird von Ulrike Baumheier und Günter Warsewa als begünstigender Faktor in der zunehmenden Vernetzung zwischen Schule und Kommune gesehen. (Bleckmann, Durdel 2009: 20-21)
Es lässt sich feststellen, dass die Konzeption von Ganztagsschulen nicht ohne differenzierten Blick auf mehrere Variablen geschehen kann. Eine Variable wird durch die internationalen Unterschiede im Komplex der schulischen Bildung dargestellt. Eine weitere ist die nationale Divergenz, in Deutschland durch den förderalistischen Staat bedingt. Durch die Einflüsse der jeweiligen kommunalen Eigenheiten ist zudem jede Ganztagsschule für sich einzigartig. Dies wird bei der Betrachtung von Möglichkeiten im Rahmen der Ganztagsschule stets zu beachten sein.
3.1. Ziele von Ganztagsschulen
Wo Ganztagsschulen bewusst sehr unpräzise und offen von den Kultusministerien definiert wurden, so wurden die mit der Ganztagsschule verbundenen Ziele und Effekte genau festgelegt. Als Ganztagsschulen Anfang des vergangenen Jahrzehnts wieder vermehrt in den Fokus der öffentlichen Diskussion zurückkehrten, ging es vorrangig um die erwünschte Verbesserung des Ergebnisses der deutschen Schülerschaft in der PISA-Studie. Doch schon in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als Ganztagsschulen zumindest in der Bildungstheorie ihren Einzug hielten, wurden die angepeilten Ziele über die rein prüfbare Leistung hinaus avisiert. Dabei gingen die Ziele von Bildungstheoretikern, -Politikern und Eltern maßgeblich auseinander.
Ganztagsschulen fanden in der deutschen Bildungslandschaft nach den ersten Veröffentlichungen und Projektplanung internationaler (so z.B. Die UNESCO (Holtappels 2006: 1)) und nationaler (z.B. Deutscher Bildungsrat zur Herstellung von Chancengleichheit (Oelerichs 2008: 14)) Instanzen nur vergleichsweise geringe Verbreitung. Allein Gesamtschulen entsprachen schon vor der Jahrtausendwende flächendeckend dem Konzept der Ganztagsschule. Vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2007 stieg der Anteil von Schulen mit (der Definition der Kultusministerkonferenz entsprechenden und damit in der Statistik aufgeführten) Ganztagsangebot allerdings rapide an (z.B. bei Grundschulen von 12,4% auf 34,9%, bei Gymnasien von 15,9% auf 30,6% und bei integrierten Gesamtschulen von 64,7% auf81,2%) (Kultusministerkonferenz 2008: 8)
Diese Verbreitung wird, neben den erwähnten pädagogischen Zielen, auch Gesichtspunkten infrastruktureller und sozialer Probleme zugeschrieben. Diese Probleme werden zwar nicht explizit durch die pädagogische Konzeption von Ganztagsschulen abgedeckt, jedoch implizit in den Wirkungskreis dieser einbezogen:
1. Ganztagsschulen als "Teil sozialer Infrastruktur": Die veränderte Arbeitswelt stellt Familien vor neue Herausforderung. Klassische Rollenverteilungen im Elternhaus haben an Bindungskraft verloren und beide Elternteile müssen nun oft zur finanziellen Versorgung der Familie beitragen. Die Verpflichtungen im Rahmen der Familie erschweren dies jedoch beträchtlich. Eine pädagogisch aufgearbeitete Betreuung in Form der Ganztagsschule soll dafür sorgen, die nötigen Freiräume zu schaffen, um Familien die Anforderungen der modernen Arbeitswelt bewältigen zu lassen und dabei gleichzeitig eine Vernachlässigung der Kinder und Jugendlichen in Bezug auf Erziehung und Bildung zu vermeiden. (Holtappels 2007: 9-10; Böllert 2008: 187-193)
2. Als Folge von sich wandelnden Sozialisationsbedingungen sei eine zunehmende 'soziale Desintegration' der Schülerschaft in sich verdichtenden Wohnumfeldern bei abnehmenden Erfahrungsräumen zu beobachten. Fehlende nachbarschaftliche Begegnung, anderweitige Verringerung sozialer Kontaktmöglichkeiten würden beobachtet. In Verbindung mit elektronischen Medien und anderen kommerziellen Angebotsformen habe dies für die Lebensgestaltung und die Lernentwicklung der Schüler ambivalente Folgen: zunehmendes Angebot vielfältiger Lernressourcen außerhalb der Schule mit Freiräumen für Eigentinitiative und Selbstgestaltung bei gleichzeitigen Problemen der Identitätsfindung, Rückgang an Eigentätigkeit und Bewegung, sowie die schon erwähnte soziale Desintegration. Auf diese Herausforderungen mit entwicklungsbezogenem und sozialem Integrationsbedarf sollen gerade Ganztagsschulen als Institutionen ganzheitlicher Ganztagsbildung adäquat reagieren können.
[...]
1 Allerdings lassen Marotzki und Jörnissen dabei die zweite, soziale Dimension aus. Aus dem Text geht allerdings weder hervor, dass sie die Partizipations- und Kontaktmöglichkeiten des Mediums außer acht ließen, noch dass sie die Orientierung in dieser außer Acht ließen. Ich gehe daher davon aus, dass sie die zweite Dimension implizit in einer der beiden anderen implementieren.
- Citar trabajo
- Michael Kulueke (Autor), 2011, Medienpädagogik in der Ganztagsschule zwischen informeller und formeller Bildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211133