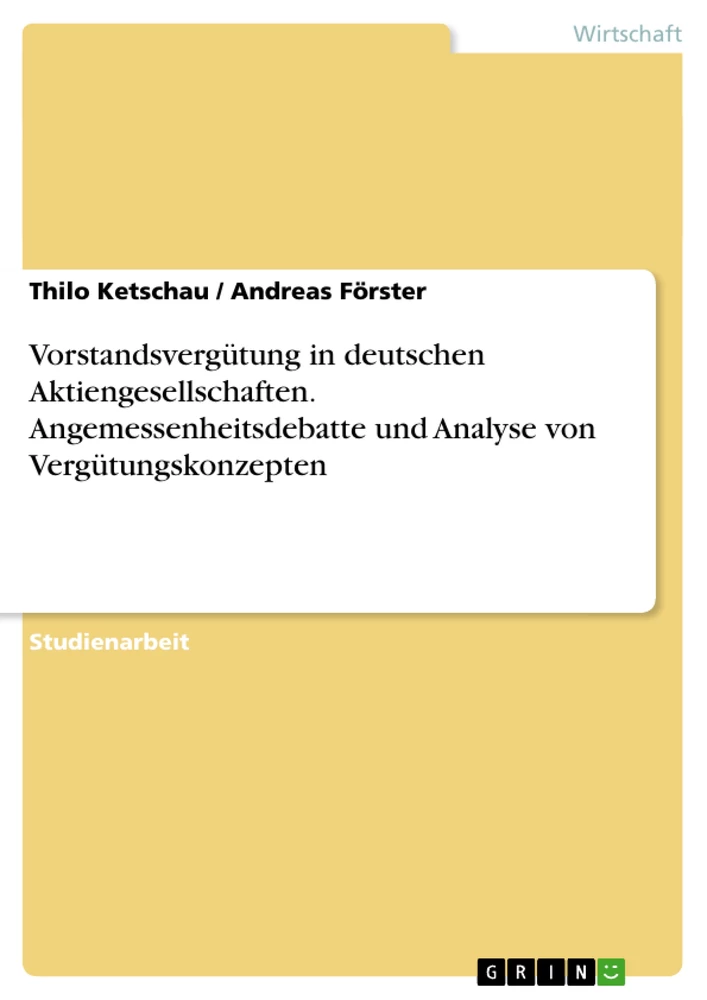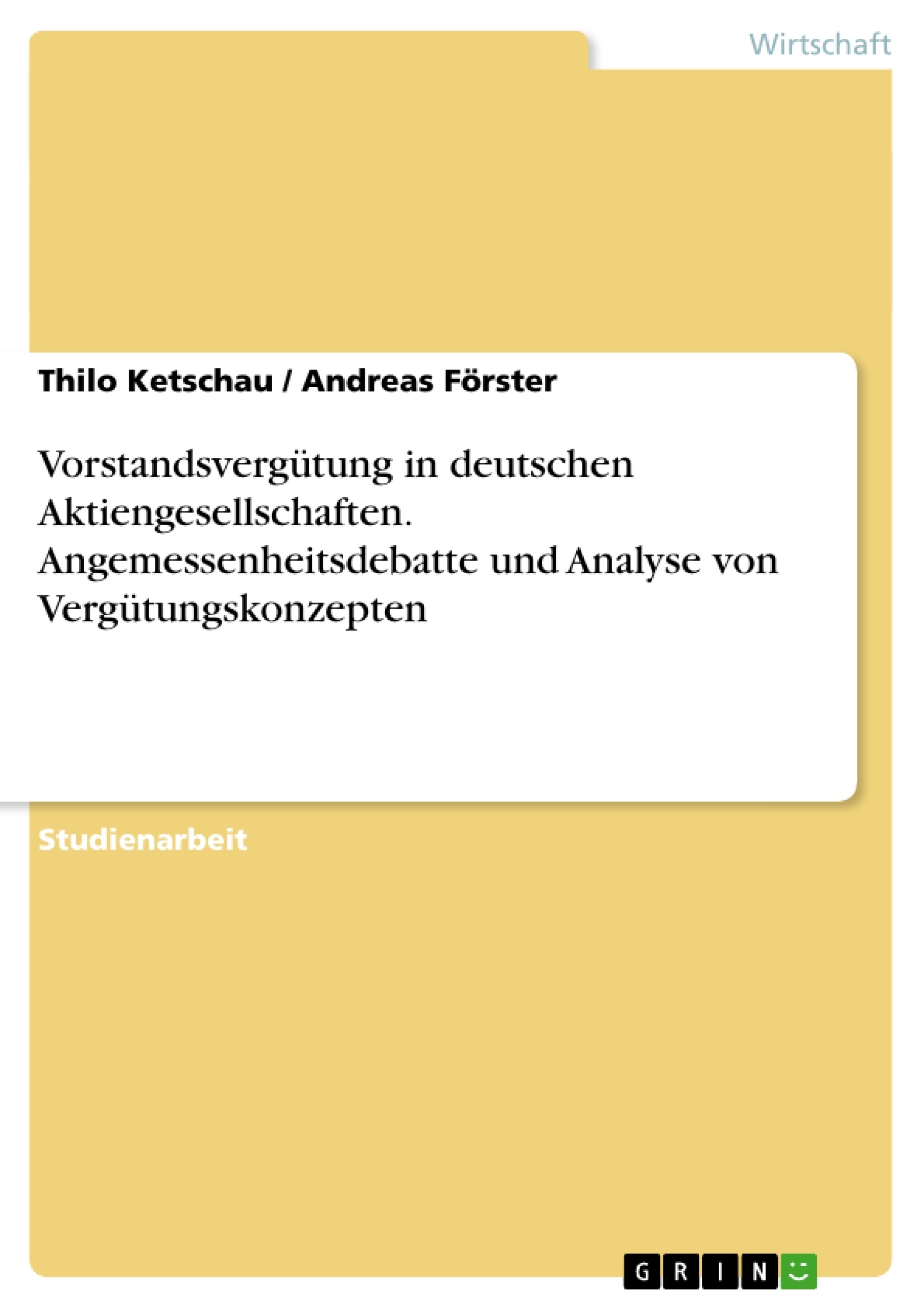Vorstandsvergütungen sind scharfer Kritik ausgesetzt. In der Öffentlichkeit dominiert ein allgemeines Unverständnis über die hohen und auch in Krisenzeiten scheinbar weiter wachsenden Gehälter der deutschen Top Manager. Dabei haben nicht nur die Vorstände selber, sondern mehrere Interessengruppen unterschiedlichste Ansprüche an die Ausgestaltung dieser Entlohnung. Die Hauptfunktion der Vorstandsvergütungen ergibt sich aus ihrer Notwendigkeit als Anreiz, wie sie sich aus personalwissenschaftlicher Sicht im Wesentlichen aus der Prinzipal Agenten Theorie ableiten lässt. Für eine konkrete Ausgestaltung in Form eines Vergütungssystems stehen unterschiedliche Komponenten zur Verfügung, wobei im Rahmen dieser Betrachtungen der Schwerpunkt auf variablen Instrumenten und Komponenten liegt. Die komplexen Determinanten, Bedenken und Interdependenzen, die bei der Entwicklung eines solchen Vergütungssystems eine Rolle spielen, werden ebenfalls erläutert.
Unter dem Eindruck der öffentlichen Debatte können bei einer Betrachtung dieser Thematik ethische Aspekte nicht ignoriert werden. Auch wenn eine konkrete Lösung der Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit und Entlohnungsgerechtigkeit nicht angeboten werden können, so werden doch einige interessante Ansätze präsentiert und diskutiert, die sich dieser Thematik angenommen haben.
Um die Umsetzung der theoretischen Modelle und Ansätze in der Praxis bewerten zu können wurden anhand der Geschäftsberichte der vier DAX-30-Aktiengesellschaften Allianz, Deutsche Bank, Fresenius und Siemens die unterschiedlichen Vergütungsmodelle analysiert und bewertet. Schwerpunkt wurde hierbei auf die variable Vergütung gelegt, da diese zum einen ca. 70% der gesamten Vergütung ausmacht und sich zum anderen von der festen Vergütung bei allen Unternehmen unterscheidet. Die Übergewichtung der variablen Vergütung schafft Anreize für die Vorstände und ermöglich den Aufsichtsräten entsprechende Zielvorgaben gezielt als Steuerungselement einzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Executive Summary
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemdefinition
- 1.2 Ziel
- 1.3 Methodik
- 2 Theoretische Betrachtung und Diskussion von Vorstandsvergütungskonzepten
- 2.1 Grundlegende Definitionen
- 2.2 Grundlagen der Vorstandsvergütung
- 2.2.1 Anreizfunktion
- 2.2.2 Zusammensetzung und Ausgestaltung der Vergütungssysteme
- 2.3 Ethische Diskussion der Vorstandsvergütung
- 2.3.1 Diskussion der Gerechtigkeits- und Angemessenheitsaspekte und deren Wirkung
- 2.3.2 Soziale Bemessungsgrößen als Lösungsansatz
- 3 Analyse
- 3.1 Allianz
- 3.1.1 Grundgehalt
- 3.1.2 Variable Vergütung
- 3.1.3 Analyse
- 3.2 Deutsche Bank
- 3.2.1 Grundgehalt
- 3.2.2 Variable Vergütung
- 3.2.3 Analyse
- 3.3 Fresenius SE
- 3.3.1 Feste Vergütung
- 3.3.2 Variable Vergütung
- 3.3.3 Aktienoptionen
- 3.3.4 Performance Shares
- 3.3.5 Analyse
- 3.4 Siemens
- 3.4.1 Feste Vergütung
- 3.4.2 Variable Vergütung
- 3.4.3 Analyse
- 3.1 Allianz
- 4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Vorstandsvergütungen in deutschen Aktiengesellschaften, insbesondere im Hinblick auf die öffentliche Kritik an deren Höhe und die damit verbundenen ethischen Fragen. Ziel ist es, verschiedene Vergütungskonzepte zu betrachten und anhand von Fallstudien (Allianz, Deutsche Bank, Fresenius und Siemens) deren Umsetzung und Wirkung zu bewerten.
- Analyse verschiedener Modelle der Vorstandsvergütung
- Diskussion der Anreizfunktion von Vergütungssystemen
- Bewertung ethischer Aspekte und Gerechtigkeitsfragen
- Untersuchung der Transparenz von Vergütungsinformationen
- Beurteilung der Wirksamkeit variabler Vergütungskomponenten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses einleitende Kapitel beschreibt die Problematik hoher Vorstandsgehälter in der öffentlichen Wahrnehmung und formuliert die Ziele und die Methodik der Arbeit. Es etabliert den Kontext der Untersuchung und skizziert die Forschungsfrage.
2 Theoretische Betrachtung und Diskussion von Vorstandsvergütungskonzepten: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Vorstandsvergütungen. Es definiert zentrale Begriffe, erläutert die Anreizfunktion von Vergütungssystemen im Kontext der Prinzipal-Agenten-Theorie und diskutiert die ethischen Aspekte und die Frage der Angemessenheit und Gerechtigkeit. Es werden verschiedene Ansätze und Modelle zur Gestaltung von Vergütungssystemen vorgestellt und kritisch hinterfragt.
3 Analyse: In diesem Kapitel werden die Vergütungssysteme von vier DAX-30-Unternehmen (Allianz, Deutsche Bank, Fresenius und Siemens) detailliert analysiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der variablen Vergütung, deren Zusammensetzung und Ausgestaltung untersucht werden. Die Analyse berücksichtigt die jeweiligen Besonderheiten der Unternehmen und bewertet die Transparenz und die Wirksamkeit der eingesetzten Instrumente.
Schlüsselwörter
Vorstandsvergütung, Aktiengesellschaften, Anreizsysteme, Prinzipal-Agenten-Theorie, Variable Vergütung, Transparenz, Ethische Aspekte, Gerechtigkeit, Angemessenheit, DAX-30, Fallstudien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Vorstandsvergütungen in deutschen Aktiengesellschaften
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Vorstandsvergütungen in deutschen Aktiengesellschaften, insbesondere im Hinblick auf die öffentliche Kritik an deren Höhe und die damit verbundenen ethischen Fragen. Es werden verschiedene Vergütungskonzepte betrachtet und anhand von Fallstudien (Allianz, Deutsche Bank, Fresenius und Siemens) deren Umsetzung und Wirkung bewertet.
Welche Ziele werden verfolgt?
Das Ziel ist es, verschiedene Modelle der Vorstandsvergütung zu analysieren, die Anreizfunktion von Vergütungssystemen zu diskutieren, ethische Aspekte und Gerechtigkeitsfragen zu bewerten, die Transparenz von Vergütungsinformationen zu untersuchen und die Wirksamkeit variabler Vergütungskomponenten zu beurteilen.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative und quantitative Analysemethode. Es werden theoretische Grundlagen gelegt (Prinzipal-Agenten-Theorie, ethische Aspekte), gefolgt von Fallstudien an vier DAX-30-Unternehmen (Allianz, Deutsche Bank, Fresenius und Siemens). Die Analyse konzentriert sich auf die Zusammensetzung und Ausgestaltung der variablen Vergütung.
Welche Unternehmen werden im Detail analysiert?
Die Fallstudien konzentrieren sich auf vier DAX-30-Unternehmen: Allianz, Deutsche Bank, Fresenius SE und Siemens. Für jedes Unternehmen werden die Vergütungssysteme detailliert untersucht, einschließlich fester und variabler Vergütungskomponenten (z.B. Aktienoptionen, Performance Shares).
Welche Aspekte der Vorstandsvergütung werden betrachtet?
Die Analyse umfasst die Grundgehälter, die variable Vergütung (Bonis, Aktienoptionen etc.), die ethischen Aspekte (Gerechtigkeit, Angemessenheit), die Transparenz der Vergütungsinformationen und die Wirksamkeit der eingesetzten Instrumente zur Anreizgestaltung.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Prinzipal-Agenten-Theorie, um die Anreizfunktion von Vergütungssystemen zu erklären. Darüber hinaus werden ethische Theorien und Konzepte der Gerechtigkeits- und Angemessenheitsdiskussion herangezogen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur theoretischen Betrachtung von Vorstandsvergütungskonzepten, ein Kapitel mit der Analyse der Fallstudien und eine Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vorstandsvergütung, Aktiengesellschaften, Anreizsysteme, Prinzipal-Agenten-Theorie, Variable Vergütung, Transparenz, Ethische Aspekte, Gerechtigkeit, Angemessenheit, DAX-30, Fallstudien.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das vollständige Dokument enthält ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen und eine detaillierte Analyse der untersuchten Unternehmen.
- Quote paper
- Dipl. Päd. Thilo Ketschau (Author), Andreas Förster (Author), 2013, Vorstandsvergütung in deutschen Aktiengesellschaften. Angemessenheitsdebatte und Analyse von Vergütungskonzepten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211107