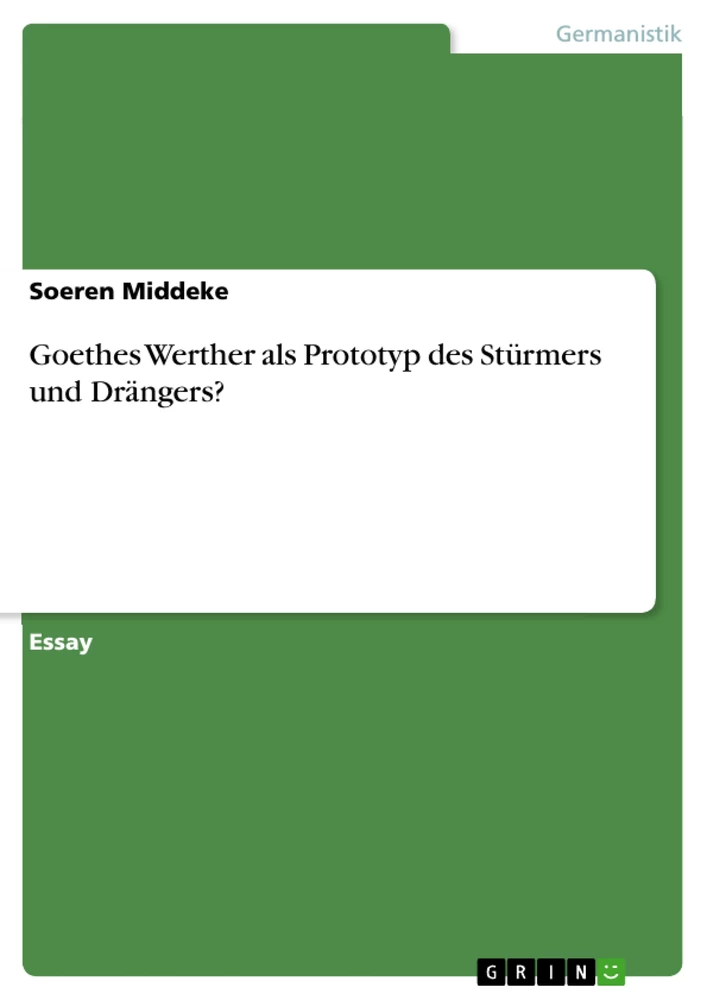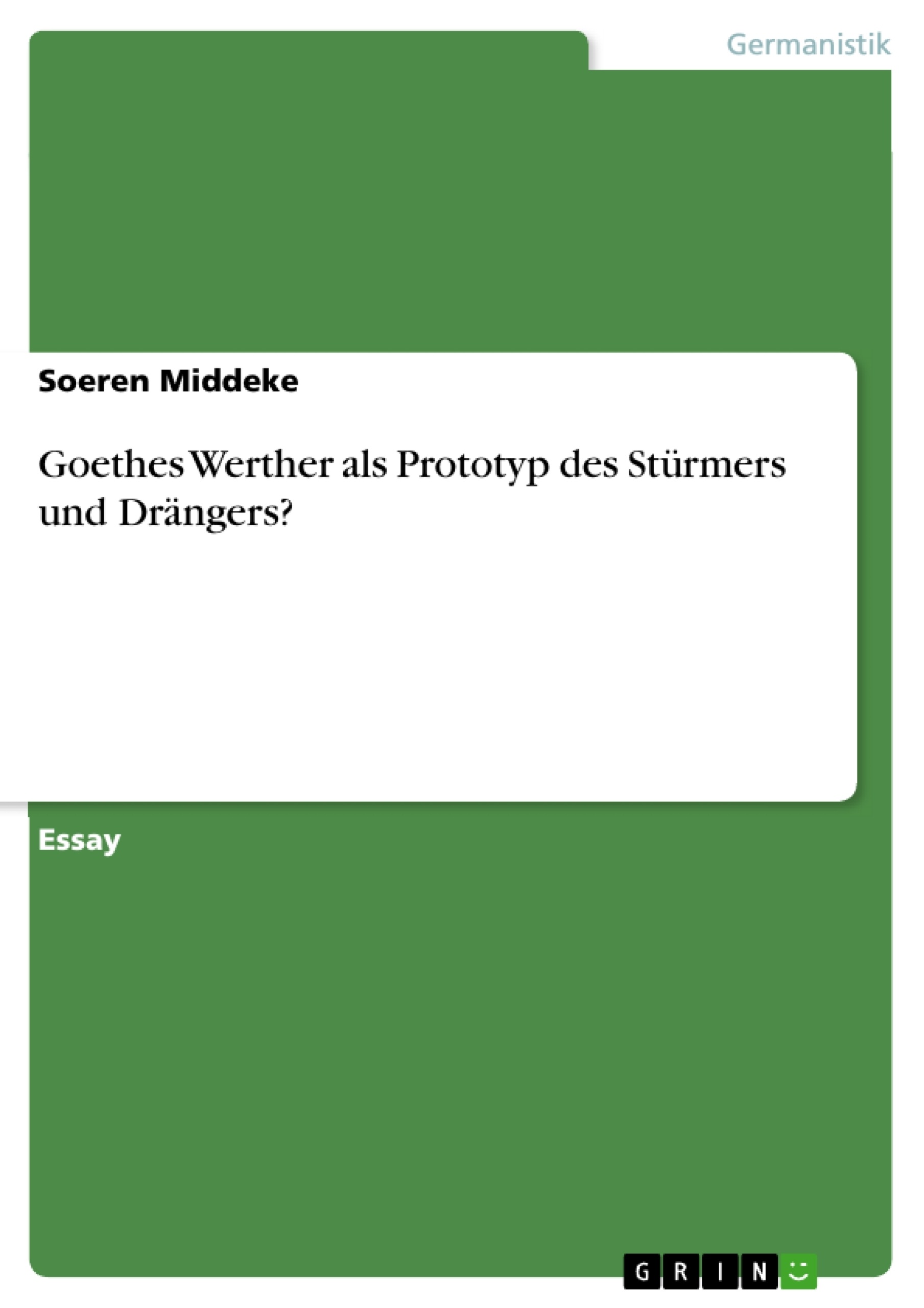Johann Wolfgang Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werther gilt im Allgemeinen als literarischer Höhepunkt derjenigen Epoche, die man nach Fried-rich Maximilian Klingers gleichnamigem Drama als „Sturm & Drang“ bezeichnet.
Der junge Goethe behandelt darin die für eine ganze Generation junger Dichter und Autoren zentralen Themen und Aspekte und kann damit wie wohl kaum ein anderer einen besonders geeigneten Zugang zum Verständnis der Literaturproduktion des Jahrzehnts zwischen 1770 und 1780 bieten.
Die nachfolgende kurze Abhandlung soll untersuchen, ob Werther, der Protagonist aus Goethes Roman, sich als Prototyp eines Stürmers und Drängers bezeichnen lässt und ob dessen Eigenschaften stellvertretend für diese Generation junger Dichter stehen können.
Um diese Frage beantworten zu können, werde ich zunächst einmal einen kurzen Abriss der Charakteristika des Sturm & Drang geben und diese Bewegung von der Epoche der Aufklärung abgrenzen, innerhalb derer sich der Sturm und Drang vollzieht. Daran anschließend folgt eine Charakterisierung der Figur des Werthers aus Goethes Roman, bevor anhand der herausgestellten Ergebnisse ein kurzes Fazit gezogen wird.
Johann Wolfgang Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werther gilt im Allgemeinen als literarischer Höhepunkt derjenigen Epoche, die man nach Friedrich Maximilian Klingers gleichnamigem Drama als „Sturm & Drang“ bezeichnet. Der junge Goethe behandelt darin die für eine ganze Generation junger Dichter und Autoren zentralen Themen und Aspekte und kann damit wie wohl kaum ein anderer einen besonders geeigneten Zugang zum Verständnis der Literaturproduktion des Jahrzehnts zwischen 1770 und 1780 bieten.
Die nachfolgende kurze Abhandlung soll untersuchen, ob Werther, der Protagonist aus Goethes Roman, sich als Prototyp eines Stürmers und Drängers bezeichnen lässt und ob dessen Eigenschaften stellvertretend für diese Generation junger Dichter stehen können.
Um diese Frage beantworten zu können, werde ich zunächst einmal einen kurzen Abriss der Charakteristika des Sturm & Drang geben und diese Bewegung von der Epoche der Aufklärung abgrenzen, innerhalb derer sich der Sturm und Drang vollzieht. Daran anschließend folgt eine Charakterisierung der Figur des Werthers aus Goethes Roman, bevor anhand der herausgestellten Ergebnisse ein kurzes Fazit gezogen wird.
Der Name für die Bewegung des Sturm & Drang, die sich zeitlich in etwa zwi- schen 1770 und 1780 datieren lässt, wird bereits von den Zeitgenossen verwendet und geht auf das gleichnamige Drama von Friedrich Maximilian Klinger zurück. Die Literatur ist zwar das wichtigste Ausdrucksmedium dieser Bewegung, aber sie bleibt nicht allein darauf beschränkt. Seine Vertreter sind in erster Linie junge Autoren, als namhafteste seien hier Goethe, Schiller, Herder, Klinger und Hamann genannt, die sich stellvertretend für eine ganze Generation gegen die Überbeto- nung der Vernunft in der Aufklärung auflehnen und sich formal und inhaltlich von dieser abgrenzen.
Der Sturm & Drang lässt sich zudem durch drei zentrale Oberbegriffe kennzeich- nen, die im Mittelpunkt dieser Strömung stehen und bereits von zeitgenössischen Gegnern der Bewegung zur spöttischen Charakterisierung benutzt werden: Genie, Natur und Herz.
Der Geniebegriff bzw. die Genievorstellung spielt eine entscheidende Rolle im Sturm & Drang, weshalb man oftmals auch von der sog. „Geniezeit“ spricht. Die- se Vorstellung geht zurück auf das Konzept einer Genieästhetik. Hierbei liegt der Ursprung einer schöpferischen Leistung allein in der natürlichen Begabung des Individuums. Diese schöpferische Kraft lässt das Genie zum „Original“ werden, das unvergleichlich und unverwechselbar ist und sich über geltende Maßstäbe und Regeln, die seiner Entfaltung Einhalt gebieten könnten, hinwegsetzt und gänzlich ignoriert.
Die Quelle der schöpferischen Kraft ist die Natur, wobei man an dieser Stelle eine Unterscheidung zum Naturbegriff der Aufklärung treffen muss. Die Aufklärung versteht die Natur als etwas mechanisches, das sich allein durch naturwissen- schaftliche Gesetzte erklären lässt und diesen ausnahmslos folgt. Im Sturm & Drang hingegen orientiert sich der Naturbegriff an einer Art organischem Prinzip, das alles durchwaltet. Diese Vorstellung deckt sich z. T. mit der im Pantheismus vertretenen Auffassung, dass das „Göttliche“ in allen Erscheinungsformen der Welt zu finden ist, wobei „göttlich“ hier nicht unbedingt auf ein höheres Wesen bezogen ist. Vergleichbare Gedanken lassen sich auch an vielen Stellen in Goe- thes Werther finden. „Wenn man aber von der Bedeutung der Natur für den Sturm & Drang spricht, so kommt man nicht umher den Namen Jean-Jacques Rousseau zu nennen.“1 Rousseaus geflügelter Ausspruch „Zurück zur Natur“ artikuliert eine neue Form der Zivilisationskritik, die den Stürmern & Drängern aus der Seele spricht. Die Natur steht hierbei für einen idealisierten und harmonisierten Urzu- stand, der das Gegenteil zu der durch zunehmende Vergesellschaftung entstande- nen Ungleichheit unter den Menschen darstellt.2 Rousseaus Schriften dienen den jungen Dichtern dazu, den unbedingten Fortschrittsglauben der Aufklärung zu entmythologisieren und die Natur zum Ort der unverstellten Identifikationsstif- tung aufzuwerten.3
Als dritter zentraler Begriff des Sturm & Drang sei an dieser Stelle das Herz genannt. Das Herz ist sowohl das organische als auch das sittlich ästhetische Zentrum des Genies und bildet den Gegenpol zum Verstand. Das Empathievermögen und das tugendhafte Handeln werden höher angesehen als das Denken und Räsonnieren der Aufklärer und bilden einen wichtigen Teil der anti-rationalen Selbstbestimmung der Stürmer und Dränger.
[...]
1 Luserke: Sturm und Drang, S.88.
2 Vgl. Fetscher: Rousseaus politische Philosophie, S. 41.
3 Vgl. Luserke: Sturm und Drang, S.89.
- Quote paper
- Soeren Middeke (Author), 2009, Goethes Werther als Prototyp des Stürmers und Drängers?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210865