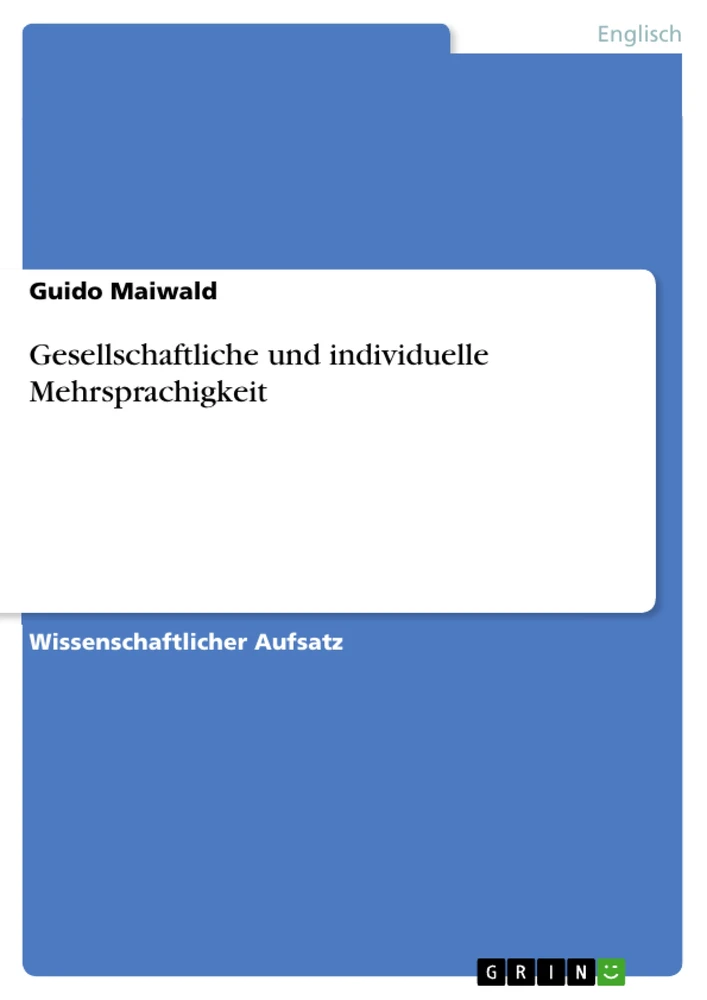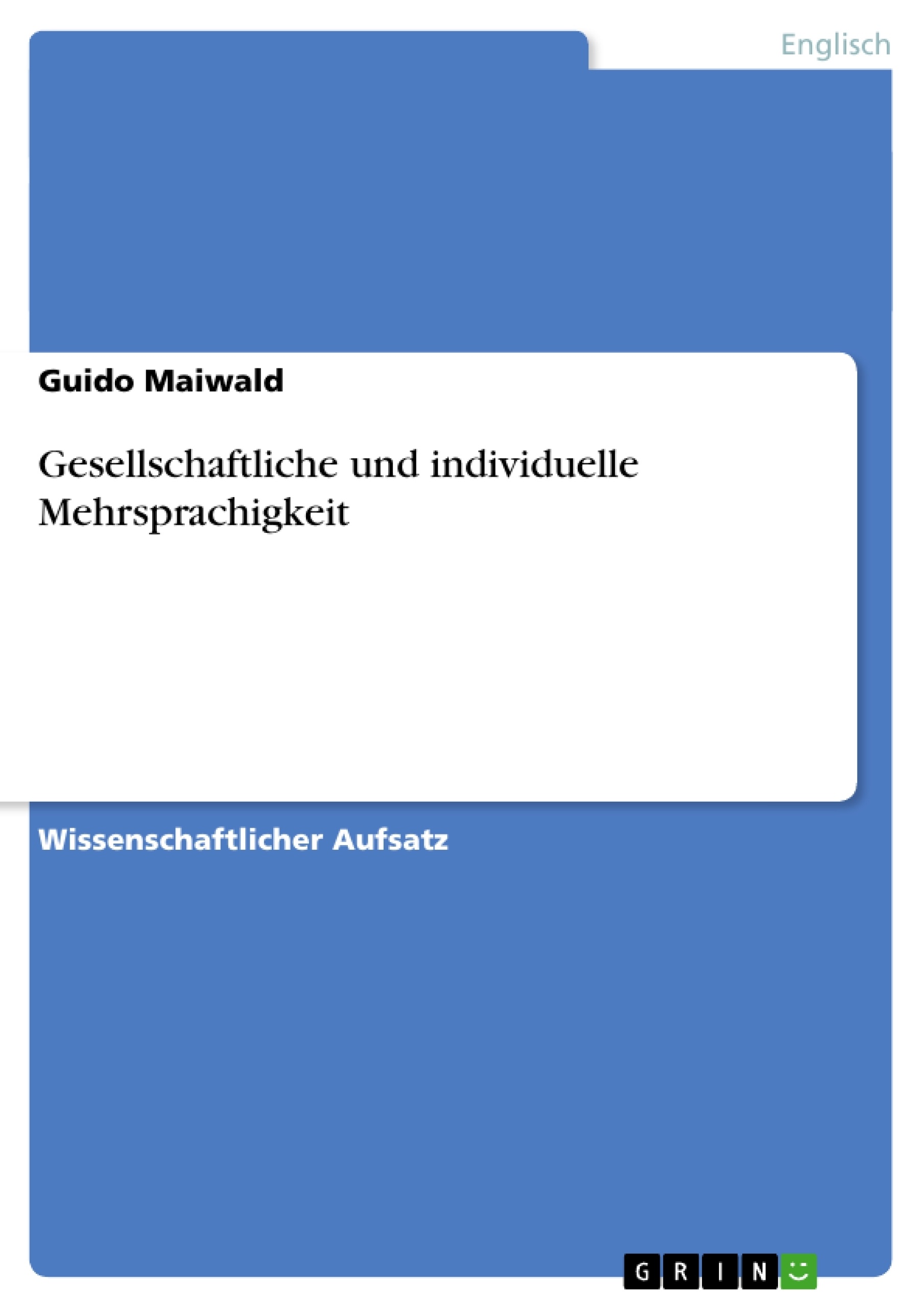In unserer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit die Regel und nicht mehr die Ausnahme. Mehrsprachigkeit wird zum Entscheidungsträger über soziale Integration und berufliche und ökonomische Chancen. Diese Arbeit fokussiert im ersten Kapitel die unterschiedlichen Formen von Mehrsprachigkeit und im zweiten und dritten Kapitel die Relevanz und Funktion von Mehrsprachigkeit in der Übersetzungspraxis. Im ersten Kapitel soll zunächst ein Überblick über die Erforschung der Mehrsprachigkeit und die dafür benötigten Teildisziplinen vermittelt werden. Schließlich werden die unterschiedlichen Formen hinsichtlich ihrer Terminologie und Position in der Mehrsprachigkeitsforschung erklärt und voneinander abgegrenzt. Im zweiten und dritten Kapitel werden vornehmlich Aspekte der Sprachanwendung untersucht. Relevant sind an dieser Stelle die Funktionsweisen des Wechsels zwischen den Sprachen (z.B. Code-Switching), der Transferkompetenz von Mehrsprachigen und sprachlicher Fehlleistungen wie z. B. der Interferenz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formen von Mehrsprachigkeit
- Gesellschaftliche Formen der Mehrsprachigkeit
- Formen individueller Mehrsprachigkeit
- Sprachanwendung bei Mehrsprachigen
- Code Switching
- Grammatikalische Aspekte des Code Switchings
- Pragmatische Aspekte des Code Switchings
- Problematik des pragmatischen Ansatzes
- Interferenz
- Code Switching
- Mehrsprachigkeit in der Übersetzungspraxis
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verschiedenen Formen und Aspekte von Mehrsprachigkeit, sowohl gesellschaftlich als auch individuell. Sie beleuchtet die Bedeutung von Mehrsprachigkeit in der Übersetzungspraxis und analysiert relevante Sprachanwendungsphänomene.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Formen der Mehrsprachigkeit (gesellschaftlich und individuell)
- Analyse von Code-Switching als Sprachanwendungsphänomen bei Mehrsprachigen
- Untersuchung von Interferenz als sprachlicher Fehlleistung bei Mehrsprachigen
- Bedeutung von Mehrsprachigkeit im Kontext der Übersetzung
- Kognitive und soziale Aspekte des Mehrsprachigkeits-Erwerbs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Mehrsprachigkeit im Kontext der Globalisierung als Regel dar und hebt ihre Bedeutung für soziale Integration und berufliche Chancen hervor. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die verschiedenen Formen von Mehrsprachigkeit und ihre Relevanz in der Übersetzungspraxis konzentriert. Die Einleitung betont den Anspruch, einen Überblick über die Erforschung von Mehrsprachigkeit zu geben und verschiedene Formen terminologisch zu klären und voneinander abzugrenzen. Die folgenden Kapitel befassen sich detaillierter mit der Sprachanwendung und relevanten Aspekten wie Code-Switching und Interferenz.
Formen von Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel beginnt mit der Klärung terminologischer Unschärfen zwischen „Zweisprachigkeit“ und „Mehrsprachigkeit“, insbesondere im Hinblick auf die englischsprachige Literatur. Es unterscheidet zwischen gesellschaftlicher und individueller Mehrsprachigkeit als oberste Kategorien. Der Abschnitt zu gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit analysiert verschiedene Szenarien, in denen zwei oder mehr Sprachen in einer Gesellschaft koexistieren, basierend auf den Arbeiten von Appel und Muysken sowie Hamers und Blanc. Es werden Kategorien wie innerstaatliche Mehrsprachigkeit, der Gebrauch von Kontaktsprachen und Diglossie erörtert, wobei der Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch, territorialen und sozialen Netzwerken hervorgehoben wird. Zusätzlich werden Termini wie „institutionelle Mehrsprachigkeit“ und „Dialekt“ definiert und ihre sozialen Auswirkungen diskutiert. Der Abschnitt über individuelle Mehrsprachigkeit stützt sich auf Hamers' Definition und analysiert verschiedene Aspekte wie kognitive Organisation, Alter des Spracherwerbs, Sprachfähigkeit, Reihenfolge und soziale Faktoren im Kontext der individuellen Mehrsprachigkeit.
Sprachanwendung bei Mehrsprachigen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Sprachanwendung bei Mehrsprachigen, wobei Code-Switching und Interferenz im Fokus stehen. Der Abschnitt zu Code-Switching behandelt sowohl grammatikalische als auch pragmatische Aspekte, inklusive der Problematik des pragmatischen Ansatzes. Der Abschnitt über Interferenz beschreibt die sprachlichen Fehlleistungen, die bei Mehrsprachigen auftreten können. Die Kapitelteile beleuchten die komplexen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Sprachen im alltäglichen Gebrauch und die Herausforderungen, die sich für die Kommunikation ergeben.
Mehrsprachigkeit in der Übersetzungspraxis: Dieses Kapitel behandelt die Relevanz von Mehrsprachigkeit im Kontext der Übersetzungspraxis. Es wird angenommen, dass dieser Abschnitt die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten beleuchtet, die sich aus der Mehrsprachigkeit der Übersetzer ergeben. Es könnte Aspekte wie die Transferkompetenz von Mehrsprachigen und die Bewältigung von Interferenz in Übersetzungsprozessen untersuchen. Die Zusammenfassung der Themen dieses Kapitels erfordert eine detaillierte Betrachtung des Originaltextes um ein zutreffendes Bild zu liefern.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Zweisprachigkeit, Code-Switching, Interferenz, gesellschaftliche Mehrsprachigkeit, individuelle Mehrsprachigkeit, Übersetzungspraxis, Sprachkompetenz, Spracherwerb, Soziolinguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: "Eine umfassende Übersicht über Mehrsprachigkeit"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Übersicht über Mehrsprachigkeit. Sie untersucht verschiedene Formen und Aspekte der Mehrsprachigkeit, sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf individueller Ebene. Ein besonderer Fokus liegt auf der Relevanz von Mehrsprachigkeit in der Übersetzungspraxis und der Analyse relevanter Sprachanwendungsphänomene wie Code-Switching und Interferenz.
Welche Formen der Mehrsprachigkeit werden behandelt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen gesellschaftlicher und individueller Mehrsprachigkeit. Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit umfasst verschiedene Szenarien des Koexistierens von Sprachen in einer Gesellschaft (z.B. innerstaatliche Mehrsprachigkeit, Kontaktsprachen, Diglossie). Individuelle Mehrsprachigkeit betrachtet Aspekte wie kognitive Organisation, Spracherwerbsalter, Sprachfähigkeit und soziale Faktoren im Zusammenhang mit dem individuellen Umgang mit mehreren Sprachen.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Zentrale Themen sind die Definition und Abgrenzung verschiedener Formen der Mehrsprachigkeit, die Analyse von Code-Switching (inklusive grammatikalischer und pragmatischer Aspekte), die Untersuchung von Interferenz als sprachlicher Fehlleistung, die Bedeutung von Mehrsprachigkeit in der Übersetzung und kognitive sowie soziale Aspekte des Mehrsprachigkeits-Erwerbs.
Was wird unter Code-Switching verstanden und wie wird es behandelt?
Code-Switching bezeichnet den Wechsel zwischen verschiedenen Sprachen innerhalb einer einzigen Konversation. Die Arbeit analysiert sowohl die grammatikalischen als auch die pragmatischen Aspekte von Code-Switching und beleuchtet dabei auch die Problematik des pragmatischen Ansatzes.
Was ist Interferenz und wie wird sie in der Arbeit betrachtet?
Interferenz beschreibt sprachliche Fehlleistungen, die bei Mehrsprachigen auftreten können. Die Arbeit untersucht, wie verschiedene Sprachen im alltäglichen Gebrauch wechselwirken und welche Herausforderungen dies für die Kommunikation mit sich bringt.
Welche Rolle spielt Mehrsprachigkeit in der Übersetzungspraxis?
Die Arbeit betont die Relevanz von Mehrsprachigkeit für die Übersetzungspraxis. Sie untersucht die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus der Mehrsprachigkeit von Übersetzern ergeben, insbesondere im Hinblick auf Transferkompetenz und den Umgang mit Interferenz in Übersetzungsprozessen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung (mit Überblick und Definitionen), Formen von Mehrsprachigkeit (gesellschaftlich und individuell), Sprachanwendung bei Mehrsprachigen (Code-Switching und Interferenz), Mehrsprachigkeit in der Übersetzungspraxis und einer Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt die spezifischen Aspekte der Mehrsprachigkeit detailliert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mehrsprachigkeit, Zweisprachigkeit, Code-Switching, Interferenz, gesellschaftliche Mehrsprachigkeit, individuelle Mehrsprachigkeit, Übersetzungspraxis, Sprachkompetenz, Spracherwerb, Soziolinguistik.
- Quote paper
- MA Guido Maiwald (Author), 2006, Gesellschaftliche und individuelle Mehrsprachigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210559