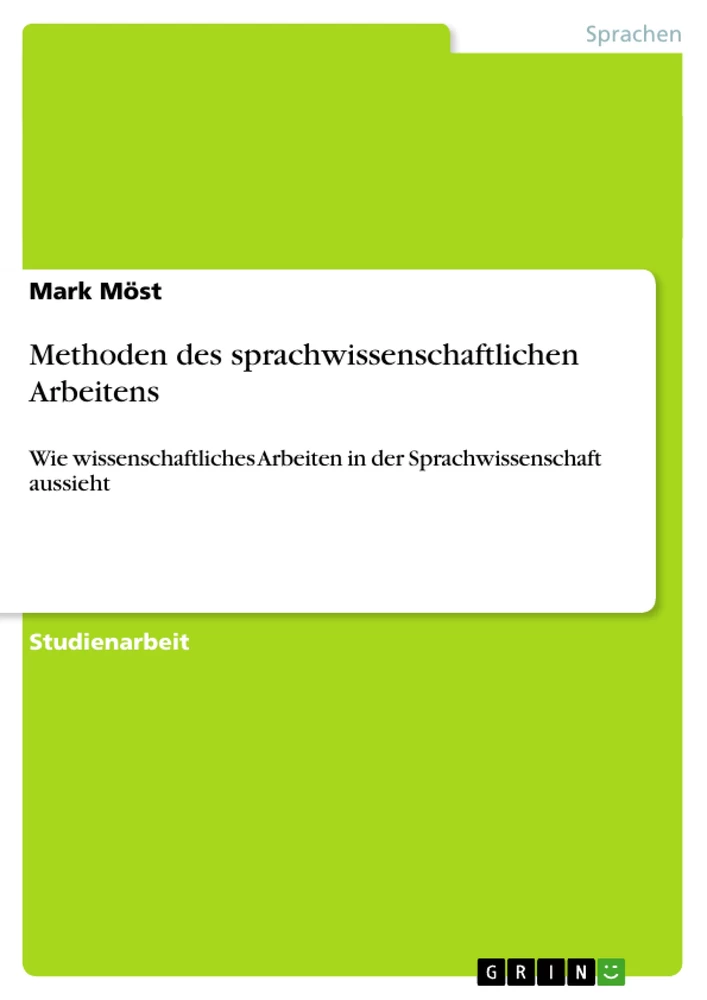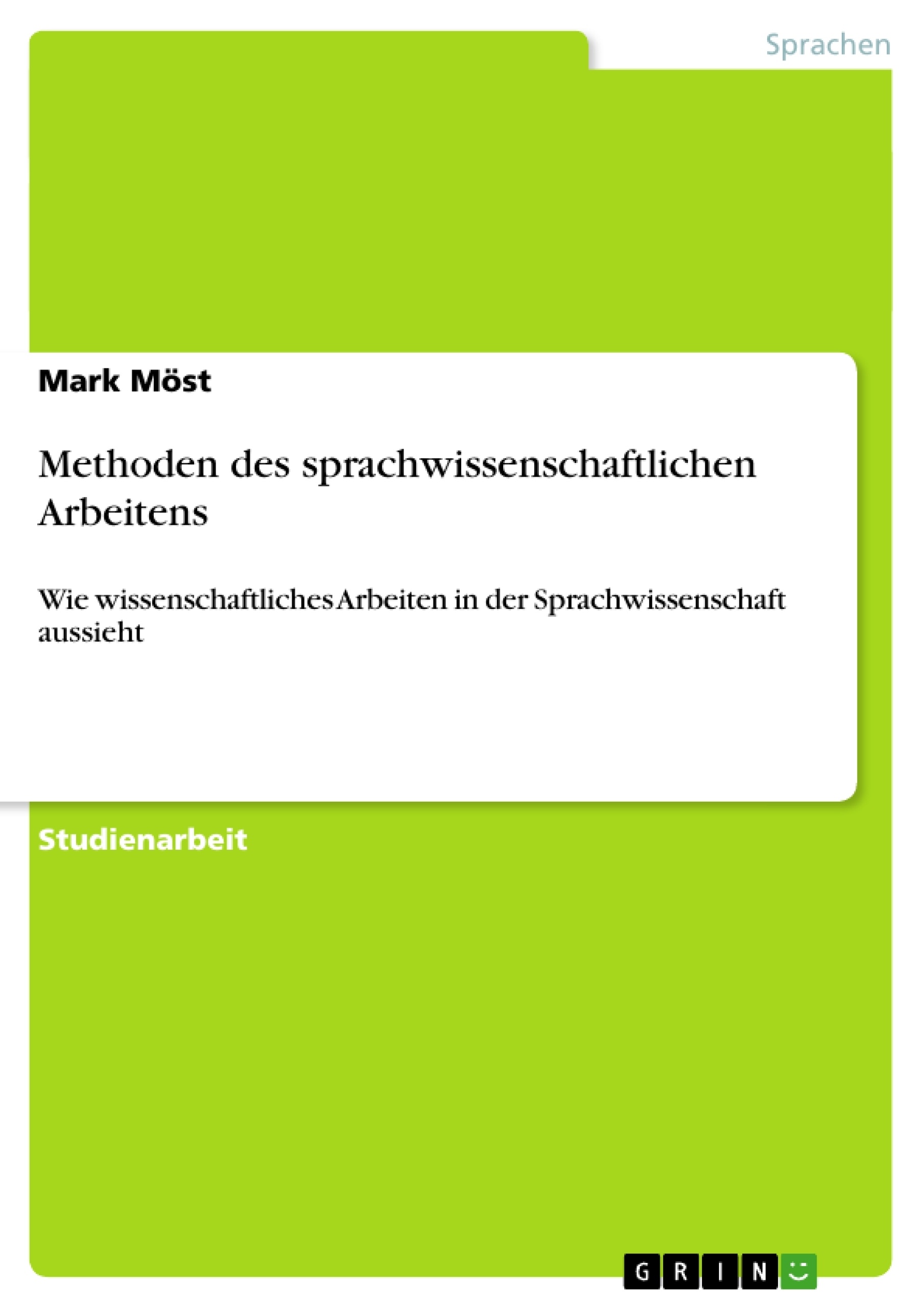Was ist eine Wissenschaft? Was bedeutet überhaupt wissenschaftliches Forschen und Arbeiten? Und wie sieht dieses Arbeiten speziell in der Sprachwissenschaft aus? Über diese Fragen gibt der vorliegende Vortrag einen ersten, allgemeinen Überblick.
Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeine Definition: Wissenschaft
2. Kennzeichen einer Wissenschaft
3. Kennzeichen wissenschaftlicher Forschung
4. Kriterien für Wissenschaftlichkeit
5. Wie denkt man wissenschaftlich?
6. Wissenschaftssprache
7. Definitionen: Hypothese – Theorie – Methode
8. Leistung von Theorien
9. Teiltätigkeiten und Arbeitsschritte des Sprachwissenschaftlers
10. Modellfall zur Illustration der sprachwissenschaftlichen Arbeitsweise
11. Erkenntnisgewinnung mittels Falsifikation
12. Exkurs in die historische Sprachwissenschaft: Das Unerklärliche erklären
13. Schlusswort
Literaturverzeichnis.
1. Allgemeine Definition: Wissenschaft
Ein geläufiges deutsches Wörterbuch definiert den Begriff „Wissenschaft“ als „geordnetes, folgerichtig aufgebautes, zusammenhängendes Gebiet von Erkenntnissen“[1]. Diese Definition enthält schon drei Merkmale, die verdeutlichen, dass Wissenschaft unter verschiedenen Aspekten etwas Systematisches an sich hat.
Wenden wir uns einer ausführlicheren Definition des Begriffs zu: Die Wissenschaftstheorie ist ein Teilgebiet der Philosophie; aus diesem Grund ist es ratsam, ein geeignetes philosophisches Nachschlagewerk heranzuziehen. Im „Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe“ erscheint Wissenschaft nicht als Ergebnis einer Tätigkeit, sondern als etwas Prozesshaftes mit verschiedenen Teilschritten und Zielen.
„Wissenschaft ist jede intersubjektiv überprüfbare Untersuchung von Tatbeständen und die auf ihr beruhende, systematische Beschreibung und – wenn möglich – Erklärung der untersuchten Tatbestände.“[2]
Speziell die „exakten“ Naturwissenschaften gelten als Vorbild wissenschaftlichen Arbeitens; daher abschließend eine Definition aus Sicht eines Naturwissenschaftlers. Man beachte, welch große Bedeutung hier den Methoden bei der Gewinnung von Erkenntnissen zugemessen wird:
„Science is not merely a collection of facts, concepts, and useful ideas about nature, or even the systematic investigation of nature, although both are common definitions of science. Science is a method of investigating nature--a way of knowing about nature--that discovers reliable knowledge about it. […] Reliable knowledge is knowledge that has a high probablility of being true because its veracity has been justified by a reliable method.“[3] (Hervorhebungen: S. D. S.)
2. Kennzeichen einer Wissenschaft
Jede wissenschaftliche Disziplin zeichnet sich durch (mindestens) drei Bestandteile aus[4]. Sie hat einen Gegenstand, den sie erforscht: Insekten, die Erdkruste, Sprache, die Gesellschaft von Indianern im Amazonas ... Die Erforschung dieser Gegenstände geschieht auf dem Wege bestimmter, charakteristischer Methoden, um den betreffenden Gegenstand „objektiv“ empirisch beobachten zu können. Und schließlich bedient man sich in einer Wissenschaft in der Regel einer besonderen Wissenschaftssprache, einer besonderen Terminologie, um über die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung effektiv kommunizieren zu können.
3. Kennzeichen wissenschaftlicher Forschung
Eine wissenschaftliche Forschung, die ihren Namen zu Recht trägt, genügt drei Kriterien[5]: Erstens: Sie ist exakt. Exakt zu arbeiten bedeutet, dass „ eine Aussage […] eindeutig und vollständig formuliert werden [muss] […]. Auch die Annahmen […] müssen klar dargelegt und so gestaltet sein, daß die Zwischenstufen einer Argumentation durchschaubar sind.“[6]
Auf die Sprachwissenschaft angewandt bedeutet dies z.B.: nicht einfach davon ausgehen, dass jeder weiß, was ein „Morphem“ ist, sondern den Begriff für sich selbst definieren und ihn selbst so verwenden. Ansonsten droht eine Verwirrung, die der wissenschaftlichen Arbeitsweise unangemessen ist: „Morphem“ lässt sich nämlich z.B. als Oberbegriff für „grammatisches Morphem“ und „lexikalisches Morphem“ (bzw. Grammem und Lexem) definieren; oder aber man bezeichnet damit eine grammatische Einheit im Unterschied zu einer lexikalischen Einheit (Semantem), wobei als Oberbegriff für beide Einheiten dann der Begriff „Monem“ verwendet wird[7]. Welcher Definition des schillernden Begriffs „Morphem“ man sich anschließt, sollte unbedingt deutlich gemacht werden, wenn man damit arbeitet.
Dass sich mit Hilfe der Fachsprache Sachverhalte differenzierter und damit präziser ausdrücken lassen als in der Alltagssprache, zeigt die Aufsplittung des alltagssprachlichen Begriffs „Zweisprachigkeit“. In der linguistischen Fachsprache hat er zum einen die Entsprechung „Bilinguismus“ (das Phänomen, dass jemand zwei Sprachen spricht oder versteht), zum anderen die Entsprechung „Diglossie“ (Anwendung von zwei Sprachen bzw. Sprachformen je nach situativem Kontext).
Zweites Kriterium: Systematisch. Systematisch ist die Arbeit des Wissenschaftlers deshalb, weil sie in einer bestimmten Abfolge einzelner Arbeitsschritte besteht und innerhalb dieser Arbeitsschritte nicht willkürlich vorgegangen wird, sondern nach einer bestimmten Methodik.
Schließlich hat wissenschaftliches Arbeiten dem Kriterium der Objektivität zu genügen: „Die Wahrheit einer Aussage muß […] objektiv sein, d.h. unabhängig von den Einstellungen und Wertungen des Erkenntnissubjekts bestehen […]“; damit einher geht die intersubjektive Nachprüfbarkeit, denn „wenn die Wahrheit einer Aussage überhaupt sich überzeugend begründen läßt, so muß jeder kompetente Wissenschaftler oder Mensch von der Wahrheit einer Aussage überzeugbar sein.“[8]
Dazu ein Beispiel aus der historischen Sprachwissenschaft: Wenn man objektiv und intersubjektiv nachvollziehbar arbeiten will, kann man nicht einfach sagen: „Das Rolandslied zeigt: In altfranzösischen Aussagesätzen mit Verb und Objekt wird das Subjekt meist nicht ausgedrückt.“ Statt einer solchen unbelegten, pauschalen und damit intersubjektiv nicht nachvollziehbaren Behauptung beruft sich Marchello-Nizia (1999) auf eine statistische Auswertung des Rolandsliedes und kommt, objektiv und intersubjektiv nachprüfbar, zu dem Schluss, dass das Subjekt in 1090 Aussagesätzen nur in 26 % der Fälle ausgedrückt wird.[9]
4. Kriterien für Wissenschaftlichkeit
„Wissenschaft ist mit einem Objektivitätsanspruch verbunden, ist mit dem Ideal objektiver Gültigkeit und intersubjektiver Nachprüfbarkeit verbunden (unterscheidet sich daher von bloßen subjektiven Meinungen, von Dogmen und Ideologien); [sie] ist mit einem Erklärungsanspruch verbunden, die vielfältigen Phänomene unserer Natur und Lebenswelt sollen verstehbar werden.“ (Hervorhebungen: E. B.)[10]
Zur Forderung von Brendel (2007) nach „(weitestgehende[r]) logische[r] Widerspruchsfreiheit und Zirkelfreiheit“[11] folgendes Beispiel: „C´est que Dieu est un estre qui possède toutes les perfections [Prämisse 1]; […] l´existence […] est du nombre des perfections [Prämisse 2]. Donc il existe [Konklusion]“[12]. Das Argument ist nicht schlüssig, denn die Prämisse „Gott besitzt X“ setzt voraus, dass Gott existiert (sonst könnte er nichts besitzen). Dies sollte ja aber eigentlich bewiesen werden, so dass das Argument eine Zirkelstruktur aufweist: Die Konklusion ist bereits in einer Prämisse enthalten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Beziehen wir beispielhaft das Kriterium der prognostischen Relevanz auf die Sprachwissenschaft. Prognostisch relevant ist etwa eine Erkenntnis wie z.B. „Stimmlose Okklusive werden im Laufe der Sprachgeschichte stimmhaft.“ Ein Blick auf die Sprachgeschichte zeigt, dass diese Regel im Rückblick etwa für das Spanische zutrifft, wie (lat.) vita(m) > (sp.) vida zeigt. Ist eine solche Regel aufgestellt und erweist sich auch in der Folgezeit als brauchbar so ergibt sich die Möglichkeit von Voraussagen der Form: „In einer Sprache X mit stimmlosen Okklusiven werden diese im Laufe der Sprachgeschichte irgendwann stimmhaft werden.“ (Ob das dann im Einzelfall auch tatsächlich stimmt, wird die Zukunft zeigen.)
[...]
[1] Wahrig-Burfeind (Hrsg.) (1994), Stichwort „Wissenschaft“.
[2] Körner (1980), S. 726.
[3] Schafersman (1997). Im Vortrag wurde statt des englischen Originalzitats eine selbst angefertigte deutsche Übersetzung geliefert: „[Natur-]Wissenschaft ist nicht nur eine Sammlung von Fakten, Konzepten und nützlichen Ideen über die Natur, oder gar die systematische Untersuchung der Natur. Wissenschaft ist eine Methode, die Natur zu untersuchen, die verlässliches Wissen über Natur erschließt. […] Verlässliches Wissen ist Wissen, das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wahr ist, weil seine Wahrhaftigkeit mit einer zuverlässigen Methode bestätigt worden ist.“
[4] Vgl. Nachtigall (1975), S. 40.
[5] Die drei Kriterien entstammen Wagner/Hackmack (1997), S. 18.
[6] Wagner/Hackmack (1997), S. 18.
[7] Vgl. Bußmann (1990), Stichwort „Morphem“ (für die erste Verwendungsweise) bzw. Stichwort „Monem“ (für die zweite Verwendungsweise).
[8] Vgl. Schurz (1996), S. 12.
[9] Vgl. Marchello-Nizia (1999), S. 42.
[10] Brendel (2007), S. 3.
[11] Brendel (2007), S. 3.
[12] Leibniz (2006), S. 663.
[13] Brendel (2007), S. 3.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird „Wissenschaft“ allgemein definiert?
Wissenschaft ist eine intersubjektiv überprüfbare Untersuchung von Tatbeständen und deren systematische Beschreibung oder Erklärung.
Was sind die Kennzeichen wissenschaftlicher Forschung?
Wissenschaftliche Forschung muss exakt, systematisch und objektiv sein.
Warum ist Fachsprache in der Linguistik wichtig?
Fachsprache ermöglicht präzisere Unterscheidungen, wie zum Beispiel zwischen „Bilinguismus“ und „Diglossie“ statt des vagen Begriffs „Zweisprachigkeit“.
Was bedeutet „intersubjektive Nachprüfbarkeit“?
Es bedeutet, dass jeder kompetente Wissenschaftler die Ergebnisse und Argumentationsschritte einer Untersuchung nachvollziehen und überprüfen kann.
Was ist der Unterschied zwischen einer Hypothese und einer Theorie?
Die Arbeit klärt diese Grundbegriffe und erläutert ihre Rolle im prozesshaften Ablauf der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung.
Wie funktioniert Erkenntnisgewinnung mittels Falsifikation?
Wissenschaftlicher Fortschritt geschieht oft dadurch, dass bestehende Theorien durch Gegenbeweise widerlegt (falsifiziert) und durch bessere ersetzt werden.
- Quote paper
- Mark Möst (Author), 2009, Methoden des sprachwissenschaftlichen Arbeitens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210168