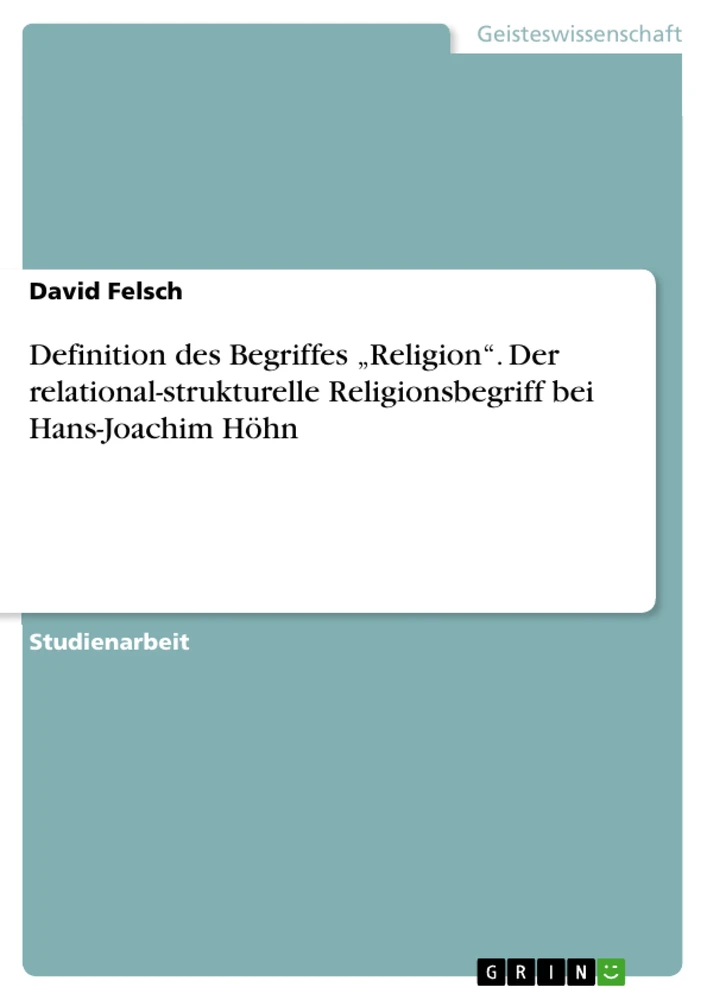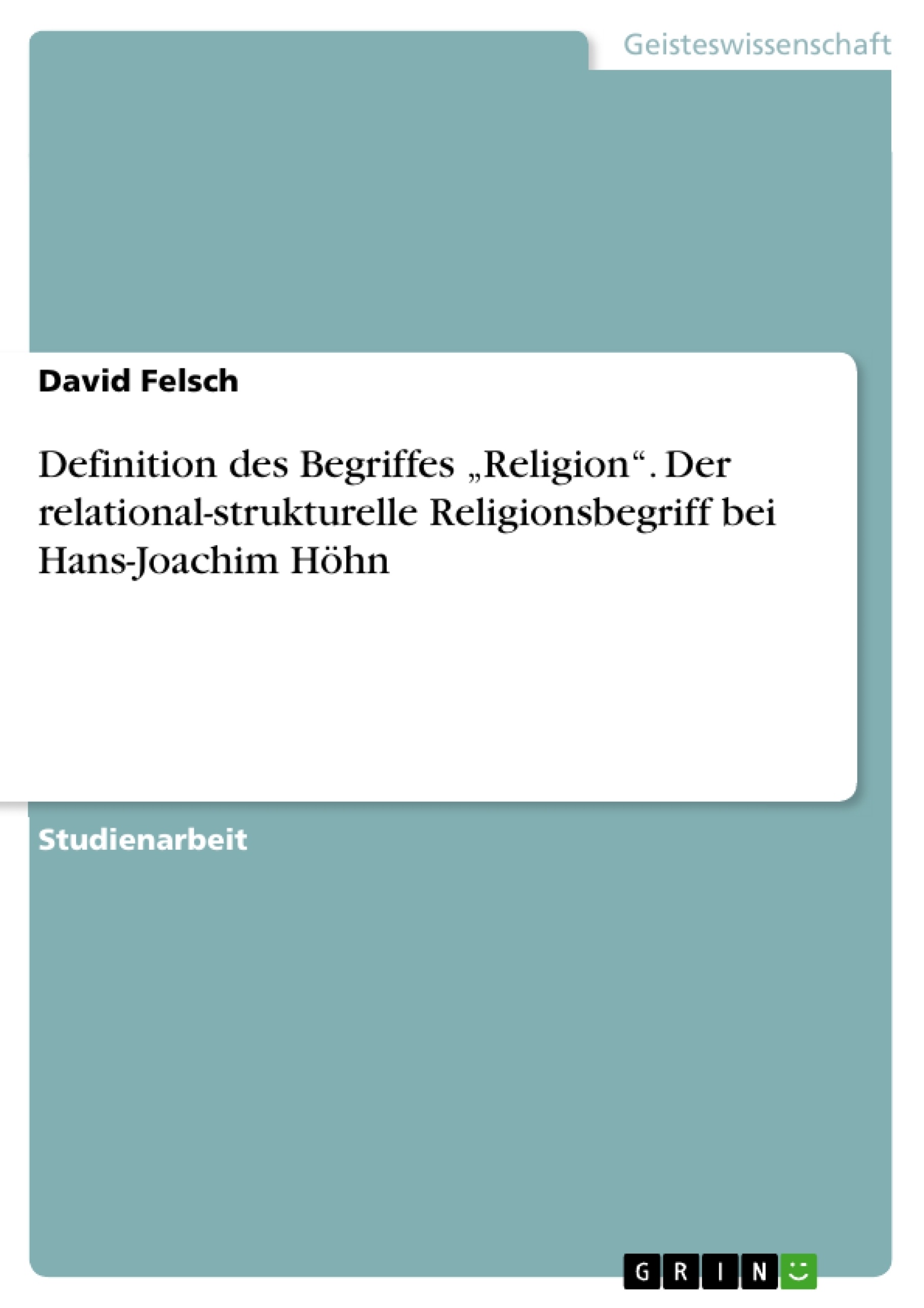Was ist Religion?
Auf eine gewisse Weise bildet diese Frage die Grundlage jeder Religionsphilosophie, da durch die Beantwortung dieser Frage das religionsphilosophische Forschungsgebiet erst umrissen werden kann. Seit der Antike unterliegt der Religionsbegriff einem ständigen Wandel und es hat vielfältige Versuche gegeben, ihn zu definieren beziehungsweise seinen Inhalt zu beschreiben.
Heute, in einer Zeit, die Jürgen Habermas als „postsäkular“ diagnostiziert, gibt es eine breite soziologische Diskussion über eine Wiederkehr der Religion, nachdem in der Phase der Säkularisierung in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts allerorten ihr Verschwinden vorausgesagt wurde. Auch um in dieser Diskussion fundiert Stellung nehmen zu können, bedarf es einer Klärung der Frage, was Religion eigentlich ist.
Im Folgenden werde ich kurz die geschichtliche Entwicklung des Religionsbegriffs bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts skizzieren, um dann die aktuelle Diskussion um den Religionsbegriff aufzugreifen und konkret drei strukturelle Definitionsversuche zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Definition und Bedeutungswandel des Begriffs „Religion“ von der Antike bis ins 20. Jahrhundert
- 2. Der Religionsbegriff in der Moderne
- 2.1. Der funktionale und der substanzielle Definitionsansatz
- 2.2. Verzicht auf eine Definition als Ausweg?
- 2.3. Der relational-strukturelle Religionsbegriff bei Hans-Joachim Höhn auf der Basis einer existentialpragmatischen Rekonstruktion menschlichen Daseins
- 2.4. Definition von Religion und religiöser Vernunft bei Thomas Rentsch
- 2.5. Das Strukturmodell von Religiosität bei Ulrich Oevermann
- 2.6. Vergleichende Kommentierung der drei Definitionsansätze
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel des Begriffs „Religion“ von der Antike bis in die Moderne. Sie beleuchtet verschiedene Definitionsansätze und analysiert den Einfluss gesellschaftlicher und philosophischer Entwicklungen auf das Verständnis von Religion. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auseinandersetzung mit dem relational-strukturellen Religionsbegriff von Hans-Joachim Höhn im Kontext der postsäkularen Gesellschaft.
- Bedeutungswandel des Begriffs „Religion“ im historischen Kontext
- Funktionaler und substanzieller Definitionsansatz von Religion
- Der relational-strukturelle Religionsbegriff bei Hans-Joachim Höhn
- Diskussion um den Religionsbegriff in der postsäkularen Gesellschaft
- Vergleichende Analyse verschiedener Definitionsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Fragestellung der Arbeit ein: Was ist Religion? Sie betont die Bedeutung der Klärung dieses Begriffs für die Religionsphilosophie und die aktuelle soziologische Diskussion um die „Wiederkehr der Religion“ in der postsäkularen Gesellschaft. Die Arbeit skizziert den historischen Wandel des Religionsbegriffs und kündigt die Analyse dreier struktureller Definitionsversuche an.
1. Definition und Bedeutungswandel des Begriffs „Religion“ von der Antike bis ins 20. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet die etymologische Herleitung des Begriffs „Religion“ aus dem Lateinischen und die verschiedenen Interpretationen von „religio“. Es beschreibt den Wandel des Begriffs von einer profanen und sakralen Bedeutung hin zu einem Verständnis von Religion als Gefühl für Transzendenz (Schleiermacher) und als Erkenntnis aller Pflichten als göttliche Gebote (Kant). Die Entwicklung vom „Sammelbegriff“ zu einem „Oberbegriff“ für verschiedene religiöse Ausprägungen wird ebenfalls erörtert. Die Diskussion der unterschiedlichen etymologischen Interpretationen – von „relegere“ bis „res und ligare“ – unterstreicht die Vielschichtigkeit des Begriffs und seine Entwicklung über die Jahrhunderte.
2. Der Religionsbegriff in der Moderne: Dieses Kapitel analysiert das Verständnis von Religion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, geprägt von Säkularisierung und Rationalisierung. Es diskutiert die Frage nach dem Ende oder der Wiederkehr der Religion im Kontext des technischen Fortschritts und der Grenzen der Vernunft. Der Beitrag von Hans-Joachim Höhn, der die „Dispersion“ des Religiösen in der postsäkularen Gesellschaft thematisiert, wird vorgestellt. Das Kapitel beleuchtet die kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff "Religion" selbst und die Überlegungen, im Kontext des Christentums, ganz auf den Begriff zu verzichten und stattdessen den "Glauben" zu betrachten. Der Fokus liegt auf den sich verändernden Bedingungen der menschlichen Existenz und der damit verbundenen Bedeutung religiöser Weltdeutungen.
Schlüsselwörter
Religion, Religionsbegriff, Säkularisierung, Postsäkularität, Definitionsansätze, Relational-struktureller Religionsbegriff, Hans-Joachim Höhn, Existentialpragmatik, Moderne, Bedeutungswandel, Gotteserkenntnis, Gottesverehrung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wandel des Religionsbegriffs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wandel des Begriffs „Religion“ von der Antike bis in die Moderne. Sie beleuchtet verschiedene Definitionsansätze und analysiert den Einfluss gesellschaftlicher und philosophischer Entwicklungen auf das Verständnis von Religion. Ein Schwerpunkt liegt auf dem relational-strukturellen Religionsbegriff von Hans-Joachim Höhn im Kontext der postsäkularen Gesellschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Bedeutungswandel des Begriffs „Religion“ im historischen Kontext, den funktionalen und substanziellen Definitionsansatz, den relational-strukturellen Religionsbegriff bei Hans-Joachim Höhn, die Diskussion um den Religionsbegriff in der postsäkularen Gesellschaft und eine vergleichende Analyse verschiedener Definitionsansätze. Die etymologische Herleitung des Begriffs wird ebenso beleuchtet wie die Entwicklung von einer profanen und sakralen Bedeutung hin zu einem Verständnis von Religion als Gefühl für Transzendenz oder als Erkenntnis göttlicher Gebote.
Welche Definitionsansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Definitionsansätze von Religion, darunter den funktionalen und substanziellen Ansatz. Ein besonderer Fokus liegt auf dem relational-strukturellen Religionsbegriff von Hans-Joachim Höhn, der im Kontext einer existentialpragmatischen Rekonstruktion menschlichen Daseins entwickelt wurde. Der Ansatz von Thomas Rentsch und das Strukturmodell von Ulrich Oevermann werden ebenfalls berücksichtigt und vergleichend kommentiert.
Wie wird der Religionsbegriff in der Moderne betrachtet?
Das Verständnis von Religion in der Moderne wird im Kontext von Säkularisierung und Rationalisierung analysiert. Die Arbeit diskutiert die Frage nach dem Ende oder der Wiederkehr der Religion im Kontext des technischen Fortschritts und der Grenzen der Vernunft. Die "Dispersion" des Religiösen in der postsäkularen Gesellschaft nach Hans-Joachim Höhn wird ein zentrales Thema sein. Die Überlegungen, im Kontext des Christentums ganz auf den Begriff „Religion“ zu verzichten und stattdessen „Glauben“ zu betrachten, werden ebenfalls kritisch beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Bedeutungswandel des Religionsbegriffs von der Antike bis ins 20. Jahrhundert, ein Kapitel zum Religionsbegriff in der Moderne (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Definitionsansätzen) und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Fragestellung ein und skizziert den historischen Wandel des Religionsbegriffs. Das zweite Kapitel beleuchtet die etymologische Herleitung und unterschiedliche Interpretationen von "religio". Das dritte Kapitel analysiert die moderne Perspektive auf Religion, fokussiert auf die genannten Autoren und die postsäkulare Gesellschaft. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Religion, Religionsbegriff, Säkularisierung, Postsäkularität, Definitionsansätze, relational-struktureller Religionsbegriff, Hans-Joachim Höhn, Existentialpragmatik, Moderne, Bedeutungswandel, Gotteserkenntnis, Gottesverehrung.
- Quote paper
- David Felsch (Author), 2007, Definition des Begriffes „Religion“. Der relational-strukturelle Religionsbegriff bei Hans-Joachim Höhn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210089