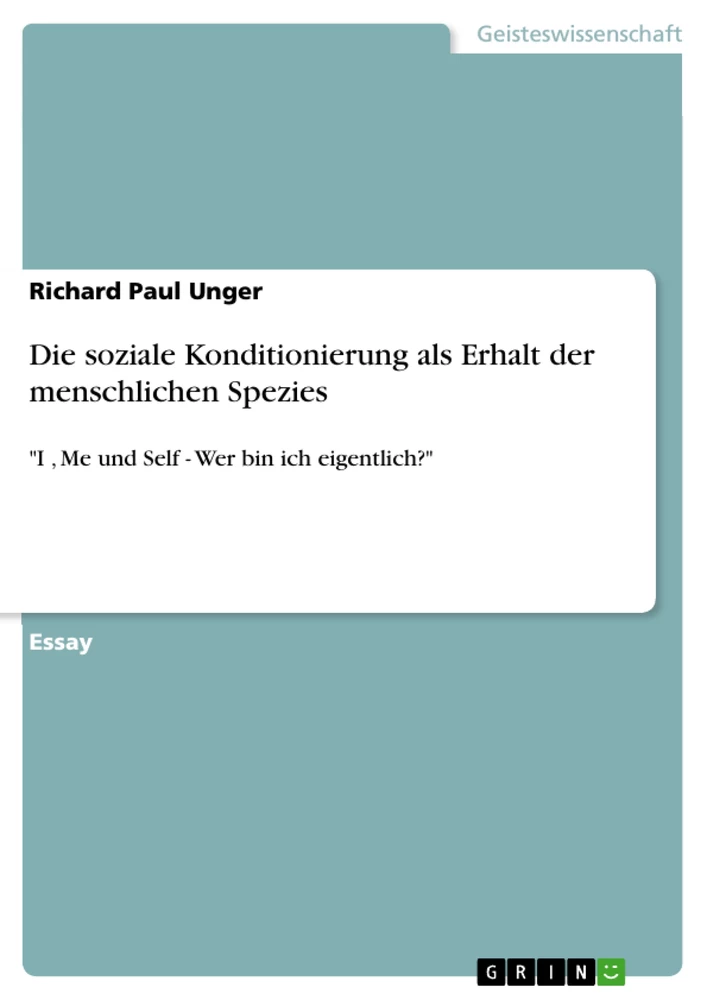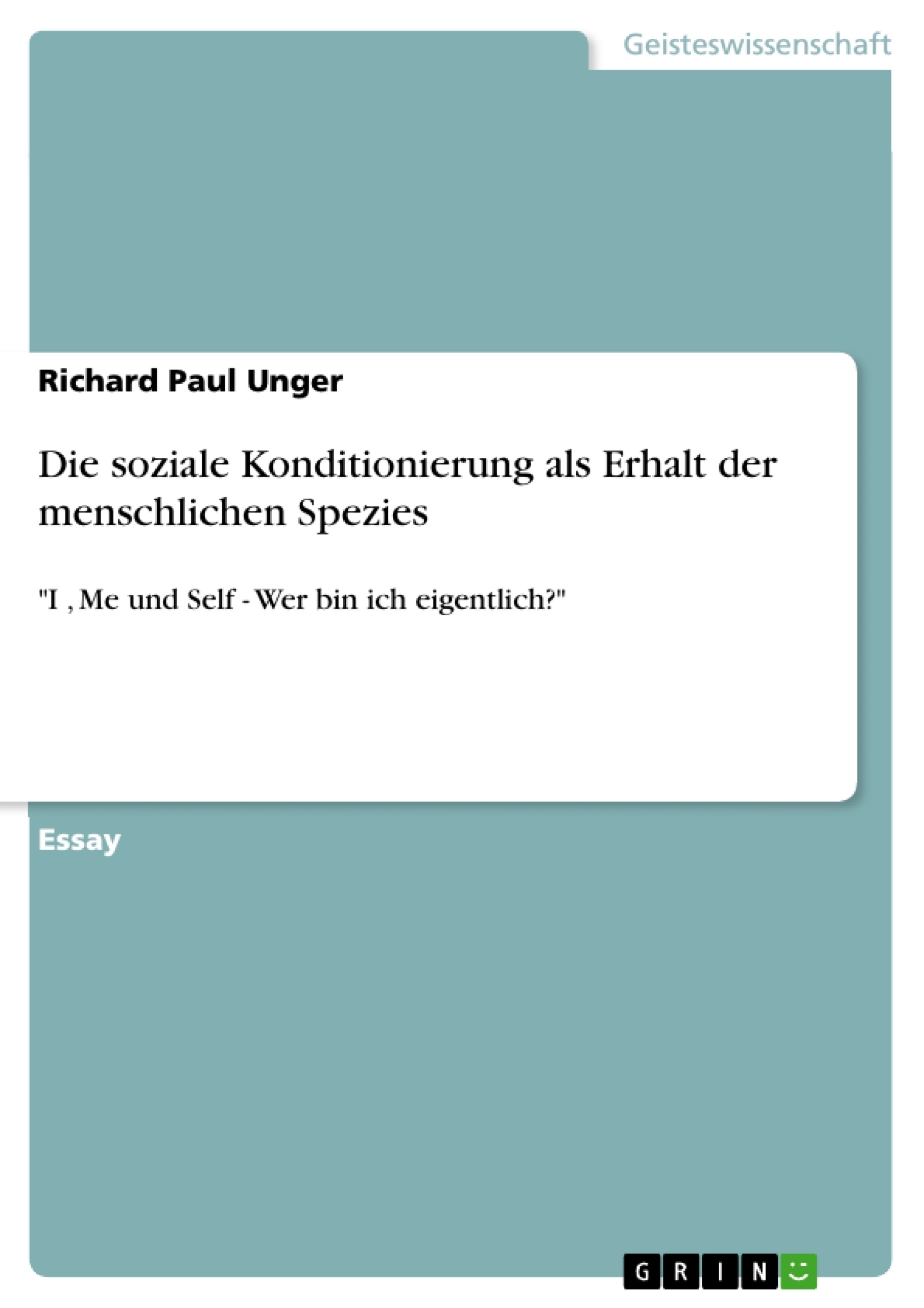Eine kritische Reflektion der verschiedenen Ebenen des Ichs (I, Me und Self) im Bezug auf die soziale Konditionierung.
Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen. [...]'
In diesem Zitat sind einige interessante und vor allem vielschichtige Elemente der Sozalisationstheorie enthalten, die auf den ersten Blick nicht eindeutig sind. Deshalb werde ich diese nachfolgend erörtern.
Vernunft
Was ist vernünftig und was nicht? Als eine vernünftige Entscheidung wird weitestgehend die beste zu treffende Entscheidung in einer bestimmten Situation angesehen. In der Tierwelt ersetzt der Instinkt den Prozess der Entscheidungsfindung, welcher für Menschen unerlässlich ist. Jedoch sind im Menschen nicht alle Instinkte vollkommen verschwunden. Der Nobelpreisträger Nikolaas Tinbergen bezeichnete den Menschen als ein „instinktreduziertes Wesen“: Wir besitzen zwar „Instinktreste“, jedoch sind diese so schwach ausgeprägt, dass sie unser Überleben nicht mehr sicherstellen können. Diese Überreste werden heute als Intuition bezeichnet. Während Tiere nach dem Empfang eines Schlüsselreizes in ein instinktbasiertes Verhaltensmuster fallen, hat der Mensch die Freiheit zwischen mehreren Verhaltensweisen zu wählen.[1] Die Wahl dieser Verhaltensweisen werden allerdings durch die auftretenden intuitiven Gefühle beeinflusst. Ein gutes Beispiel hierfür ist Angst - der menschliche Körper bereitet sich intuitiv auf die Flucht vor, was jedoch nicht bedeutet, dass wir immer fliehen.
Durch die angesprochenen Möglichkeit zwischen Verhaltensweisen zu wählen, ist ebenso der mutige Schritt nach vorne möglich. Wir halten also hier fest, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt Gefühle zu unterdrücken und entgegen seiner Intuition zu handeln.
Diese Fähigkeit ermöglichte der Menschheit sich aus dem Zwang der Natur zu befreien, eine Entwicklung vom Naturmenschen zum Kulturmenschen konnte erfolgen.
Die Intuition befasst sich mit einem Teil der Theorie von George Herbert Mead über die Identitätsbildung.[2] Hier kann man die Intuition mit dem impulsiven Ich (dem „I“) vergleichen, welches spontan und unbestimmt auftritt, welches uns mit seinen Reaktionen überraschen kann. Dem gegenüber steht das „Me“, welches das reflektierte Ich darstellt. Das „Me“ enthält die Erwartungen meiner Umwelt an mich und mein Verhalten. Genau dieser Aspekt ist der zweite Teil der Vernunft:
Ich richte also mein Handeln nicht nur an meinen Gefühlen aus, sondern versuche es in die Gesellschaft einzufügen, um die größtmögliche Freiheit für mich und die anderen zu erreichen.
Bezüglich der Tinbergen‘schen Theorie vom Mensch als „instinktreduziertes Wesen“ habe ich jedoch meine Zweifel. Ich stimme ihm zwar zu, dass wir in der Lage sind Gefühle zu unterdrücken, doch es gibt einen nicht zu vernachlässigenden Aspekt, welchen ich als den großen Urinstinkt des Menschen ansehe:
Das Leben im Rudel erleichtert das Überleben für viele Tierarten, aber auch für Menschen. Um dies zu gewährleisten muss es eine soziale Konditionierung geben. Wenn das Zusammenleben mit anderen Artgenossen das Überleben sichert, dann muss man sich dieses Zusammenleben auf eine Art und Weise arrangieren. Darauf kann das Modell von Mead übertragen werden. Die impulsiven Handlungen des „I“ müssen manchmal zugunsten des Gelingens des Zusammenlebens zurückgestellt werden, dies sind die Erwartungen der Gruppe an das „Me“. Beide zusammen ergeben die Identität des „Rudelmitglieds“, also das „Self“. Dies ist ebenfalls als die zweite Stufe der präkonventionellen Ebene der Moralentwicklung nach Lawrence Kohlberg zu betrachten. Worte wie Gerechtigkeit und Loyalität, sowie deren tiefere Bedeutung spielen hier noch keine Rolle, es handelt sich also eher um eine Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil. Es steht im Vordergrund, dass die eigenen Bedürfnisse und die der anderen erfüllt werden.[3] Das alles ist ein Balanceakt, denn wenn ein Rudelmitglied sich nicht „regelkonform“ verhält, wird es bestraft - es entsteht für ihn ein Nachteil der so gravierend ist, dass er sich durch erneute Anpassung an die Regeln wieder in das Rudel integriert.
Als kleines Gedankenspiel kann man sich einmal vorstellen wie der Mensch ohne das Rudel, oder nennen wir es ab jetzt Gemeinschaft, existieren würde. Kann der Mensch überhaupt ohne Artgenossen aufwachsen? Menschliche Kinder werden als Nesthocker geboren, sie sind bis zu einem relativ hohen Alter allein lebensunfähig. Sie benötigen den Schutz der Eltern, das ist schon eine kleine Gemeinschaft. Würde man ein Baby einem Kaspar-Hauser-Versuch unterziehen, dann würde es vermutlich sterben. Selbst wenn man diesen Versuch erst ab dem Kleinkindalter beginnen würde, wäre die soziale Konditionierung, die im Kontakt mit Artgenossen zwangsläufig bereits aufgetreten ist wohl schon zu stark, als dass sie für das Experiment genullt werden könnte.
[...]
[1] vgl. Tinbergen, Nikolaas: „The study of Instict“, Oxford, Clarendon Press, 1951
[2] vgl. Joas, Hans: „Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist“, EA Chicago, 1934, S. 299
[3] vgl. Baumgart, Hansjörg: „Theorien der Sozialisation“, Bad Heilbrunn, 2008, S. 183
- Quote paper
- Richard Paul Unger (Author), 2013, Die soziale Konditionierung als Erhalt der menschlichen Spezies, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210076