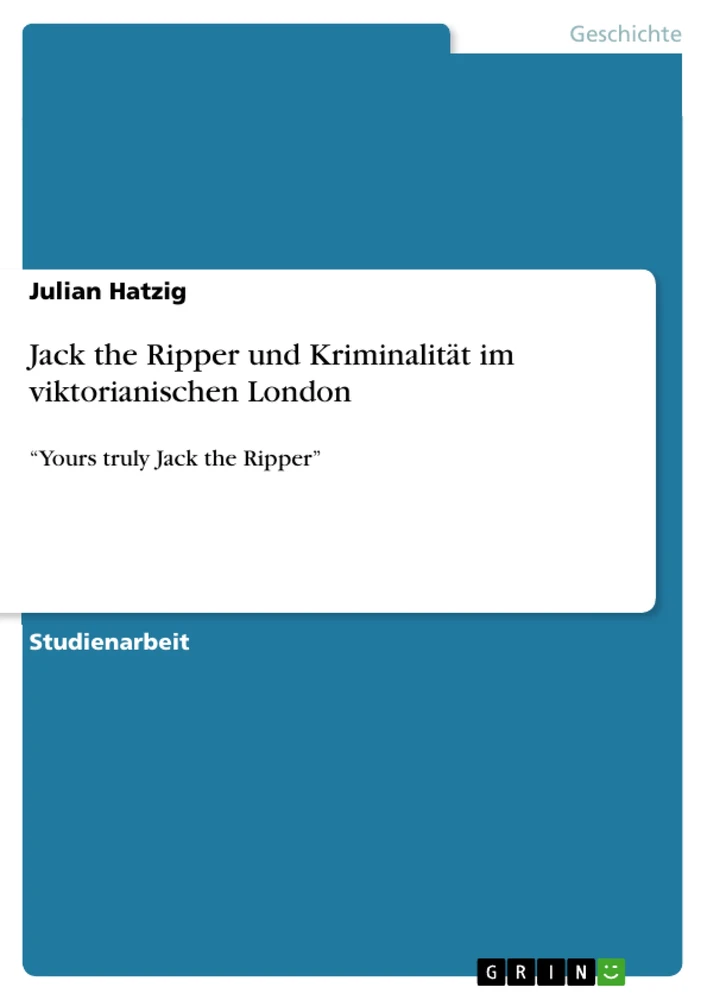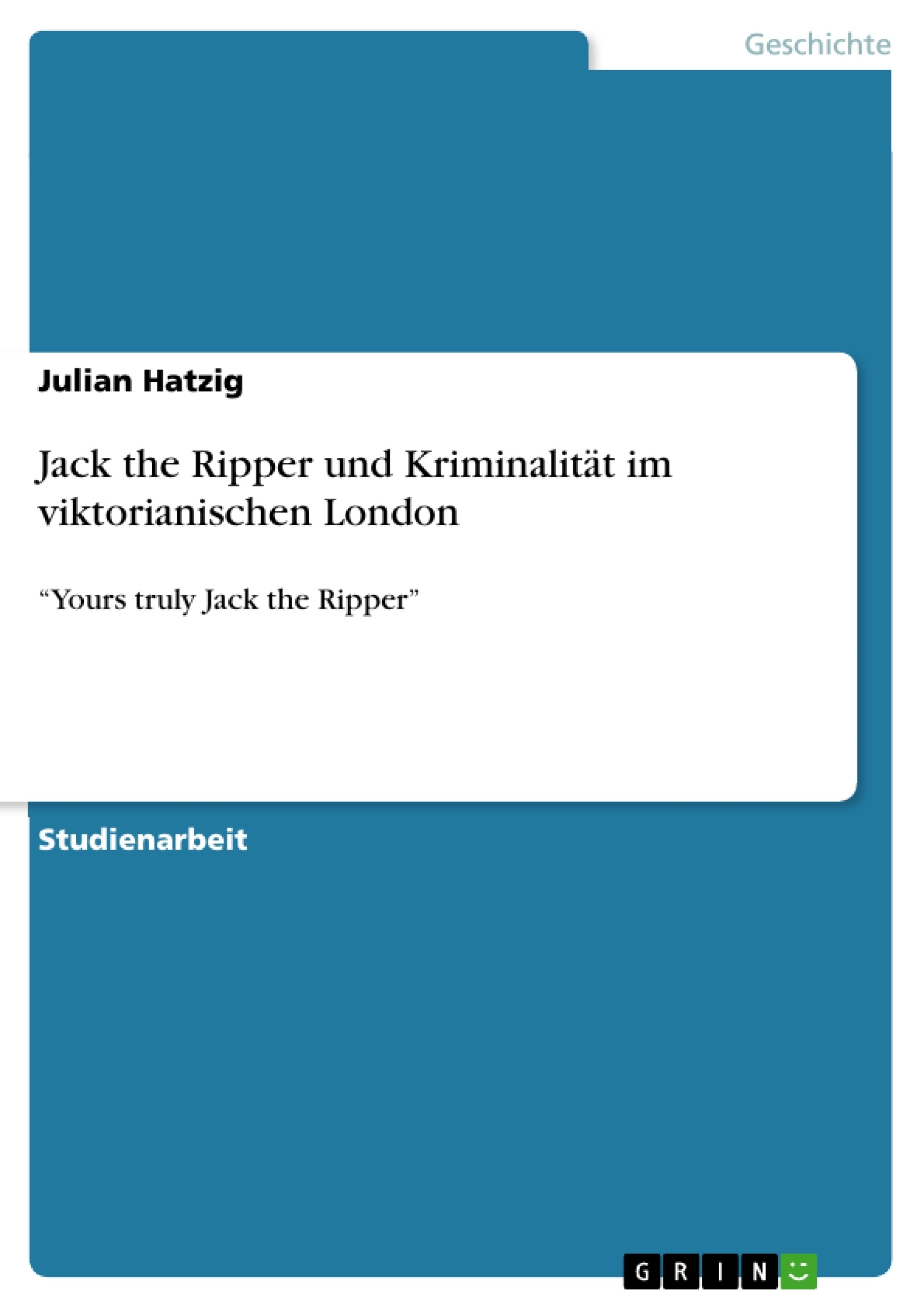Die Morde Jack the Rippers, die im ausgehenden 19. Jahrhundert im Londoner Armenviertel Whitechapel stattfanden, gelten bis heute auf der ganzen Welt als ein Mysterium. Die Theorien die im Laufe der Jahre um die niemals aufgeklärten Morde entstanden sind füllen heute ganze Bücherregale. Selbst in Film und Fernsehen greift man gerne auf die Geschichte des Rippers zurück. Die meisten Arbeiten beschäftigen sich mit der Frage wer dieser Mensch war, der fünf Frauen auf so grausame Weise umbrachte. In dieser Arbeit soll es jedoch nicht darum gehen, sich an etwaigen Täterdiskussionen zu beteiligen. Vielmehr soll die Einordnung Jack the Rippers in die viktorianische Sichtweise gegenüber der Kriminalität im Fokus stehen. Die Frage wird sein, inwieweit Jack the Ripper dem Bild der Londoner criminal class entspricht. Die Arbeit ist zu diesem Zweck in zwei Teile aufgeteilt.
Im ersten Teil werden sowohl die Londoner Unterschicht als auch die gesellschaftliche Sicht auf Kriminalität thematisiert, um eine Grundlage zu schaffen. Dabei wird darüber hinaus das Konzept der criminal class angesprochen.
Im zweiten Teil der Arbeit werden zunächst die Whitechapel Morde behandelt, um anschließend verschiedene Theorien näher zu betrachten. Mit letzteren wurde der Versuch unternommen, Jack the Ripper gesellschaftlich näher zu bestimmen. Ausgehend davon wird in einem Fazit versucht, eine Einschätzung zu seiner Zugehörigkeit zur criminal class vorzunehmen.
Gelöst von den beiden beschriebenen Hauptteilen wird sich die Arbeit der Frage widmen, inwieweit es sich für einen Historiker lohnt sich mit Kriminalitätsgeschichte zu beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Kriminalität im viktorianischen London
- II.1 Die Londoner Unterschicht
- II.2 Die viktorianische Sichtweise und Formen von Kriminalität
- III. Jack the Ripper
- III.1 Die Whitechapel Morde
- III.2 Jack the Ripper und die Londoner criminal class
- IV. Fazit
- V. Kriminalitätsgeschichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einordnung Jack the Rippers in die viktorianische Wahrnehmung von Kriminalität und der sogenannten „criminal class“. Sie analysiert die gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen im viktorianischen London, die zu der Entstehung und Wahrnehmung von Kriminalität beitrugen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Verbindung zwischen den Whitechapel-Morden und dem vorherrschenden Bild der Londoner Unterschicht.
- Soziale und ökonomische Bedingungen im viktorianischen London
- Die viktorianische Sichtweise auf Kriminalität und die "criminal class"
- Die Whitechapel-Morde und ihre gesellschaftliche Relevanz
- Die verschiedenen Theorien zur Identität von Jack the Ripper
- Der historische Wert der Kriminalitätsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt die anhaltende Faszination um die Whitechapel-Morde und die Forschungslücke, die diese Arbeit zu schließen versucht. Anstelle der Täteridentität steht die Einordnung Jack the Rippers in das viktorianische Verständnis von Kriminalität und der „criminal class“ im Fokus. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: einen Teil zur Darstellung der sozialen und kriminologischen Verhältnisse im viktorianischen London und einen weiteren Teil zur Analyse der Morde selbst und ihrer Einordnung in den Kontext der „criminal class“.
II. Kriminalität im viktorianischen London: Dieses Kapitel beschreibt die soziale und räumliche Segregation im viktorianischen London, mit dem West End als Zentrum der Oberschicht und dem East End als Armenviertel. Die starke Zuwanderung und die daraus resultierende Überbevölkerung, verschiedene Kulturen und Sprachen führten zu prekären Lebensbedingungen. Dieses Kapitel analysiert die viktorianische Sichtweise auf Kriminalität, geprägt von Vorurteilen gegen die Unterschicht und der Vorstellung einer „criminal class“, einer kriminellen Unterschicht mit angeborener moralischen Defizienz. Verschiedene Formen der Kriminalität werden beleuchtet, darunter Jugendkriminalität, Gewaltverbrechen (mit dem Fokus auf häuslicher Gewalt) und die Prostitution, die erst aufgrund von Geschlechtskrankheiten in der Royal Navy kriminalisiert wurde. Die Darstellung betont die Rolle der Presse und die einseitige Berichterstattung, die das negative Bild des East Ends verstärkte.
III. Jack the Ripper: Dieses Kapitel detailliert die fünf Morde an Prostituierten in Whitechapel im Herbst 1888. Es wird die Besonderheit der Morde herausgestellt, nicht allein aufgrund der Brutalität, sondern auch aufgrund des Schocks, den sie in der Gesellschaft auslösten – ein Schock, der über die gewöhnliche Kriminalität im East End hinausging. Die Kapitel analysieren die "double event", und die Bedeutung des "Dear Boss"- und "From Hell"-Briefes. Die Analyse umfasst auch das letzte Opfer, Marie Jeanette Kelly, deren Mord durch besondere Grausamkeit auffiel. Es wird gezeigt, wie die Morde die öffentliche Wahrnehmung des East Ends und die Theorie der "criminal class" in Frage stellten.
V. Kriminalitätsgeschichte: Dieses Kapitel untersucht den Wert der Kriminalitätsgeschichte als historische Quelle. Es wird argumentiert, dass sich durch die Beschäftigung mit Kriminalität in der Vergangenheit wertvolle Einblicke in die jeweilige Gesellschaft, Kultur, Medienlandschaft und Rechtsprechung gewinnen lassen. Der Fall Jack the Ripper wird als Beispiel genutzt, um zu zeigen, wie die Analyse von Kriminalität das Verständnis einer vergangenen Epoche vertiefen kann. Kritische Betrachtungen des einseitigen Umgangs mit Kriminalität im viktorianischen Zeitalter werden ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Jack the Ripper, Whitechapel-Morde, viktorianisches London, Kriminalität, „criminal class“, Unterschicht, soziale Ungleichheit, Presse, Antisemitismus, Gewaltverbrechen, Prostitution, Kriminalitätsgeschichte, historische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Whitechapel-Morde und ihrer Einordnung in das viktorianische Verständnis von Kriminalität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Einordnung Jack the Rippers in die viktorianische Wahrnehmung von Kriminalität und der sogenannten „criminal class“. Sie analysiert die gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen im viktorianischen London, die zur Entstehung und Wahrnehmung von Kriminalität beitrugen, und konzentriert sich auf die Verbindung zwischen den Whitechapel-Morden und dem vorherrschenden Bild der Londoner Unterschicht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die sozialen und ökonomischen Bedingungen im viktorianischen London, die viktorianische Sichtweise auf Kriminalität und die "criminal class", die Whitechapel-Morde und ihre gesellschaftliche Relevanz, verschiedene Theorien zur Identität von Jack the Ripper und den historischen Wert der Kriminalitätsforschung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: I. Einleitung: Einführung in das Thema und die Forschungslücke. II. Kriminalität im viktorianischen London: Beschreibung der sozialen und räumlichen Segregation, der Lebensbedingungen im East End und der viktorianischen Sichtweise auf Kriminalität. III. Jack the Ripper: Detaillierte Darstellung der fünf Whitechapel-Morde, ihrer Besonderheiten und ihres gesellschaftlichen Schockeffekts. IV. Fazit: (Nicht explizit im Summary beschrieben, aber implizit durch die anderen Kapitel erfassbar) V. Kriminalitätsgeschichte: Der Wert der Kriminalitätsgeschichte als historische Quelle und die Analyse von Kriminalität als Methode zum Verständnis vergangener Epochen.
Wie wird die Kriminalität im viktorianischen London dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die soziale und räumliche Segregation Londons, die prekären Lebensbedingungen im East End, die viktorianische Sichtweise auf Kriminalität mit Vorurteilen gegen die Unterschicht und die Vorstellung einer „criminal class“. Verschiedene Kriminalitätsformen wie Jugendkriminalität, Gewaltverbrechen und Prostitution werden beleuchtet, ebenso die Rolle der einseitigen Berichterstattung der Presse.
Welche Rolle spielen die Whitechapel-Morde in der Arbeit?
Die Whitechapel-Morde bilden den zentralen Fallstudien-Aspekt der Arbeit. Die Analyse konzentriert sich auf die Besonderheiten der Morde, den gesellschaftlichen Schock, den sie auslösten, und ihre Einordnung in den Kontext der „criminal class“ und des vorherrschenden Bildes des East Ends. Die "double event", sowie der "Dear Boss"- und "From Hell"-Brief werden diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Nicht explizit in den Kapitelzusammenfassungen aufgeführt. Die Schlussfolgerungen lassen sich jedoch aus der Analyse der sozialen Bedingungen, der viktorianischen Kriminalitätswahrnehmung und der Einordnung der Whitechapel-Morde in diesen Kontext ableiten.) Die Arbeit dürfte zeigen, wie die Morde das Verständnis der damaligen Gesellschaft, ihrer sozialen Ungleichheiten und ihrer Medienlandschaft widerspiegeln.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Jack the Ripper, Whitechapel-Morde, viktorianisches London, Kriminalität, „criminal class“, Unterschicht, soziale Ungleichheit, Presse, Antisemitismus, Gewaltverbrechen, Prostitution, Kriminalitätsgeschichte, historische Forschung.
- Quote paper
- Julian Hatzig (Author), 2011, Jack the Ripper und Kriminalität im viktorianischen London, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210061