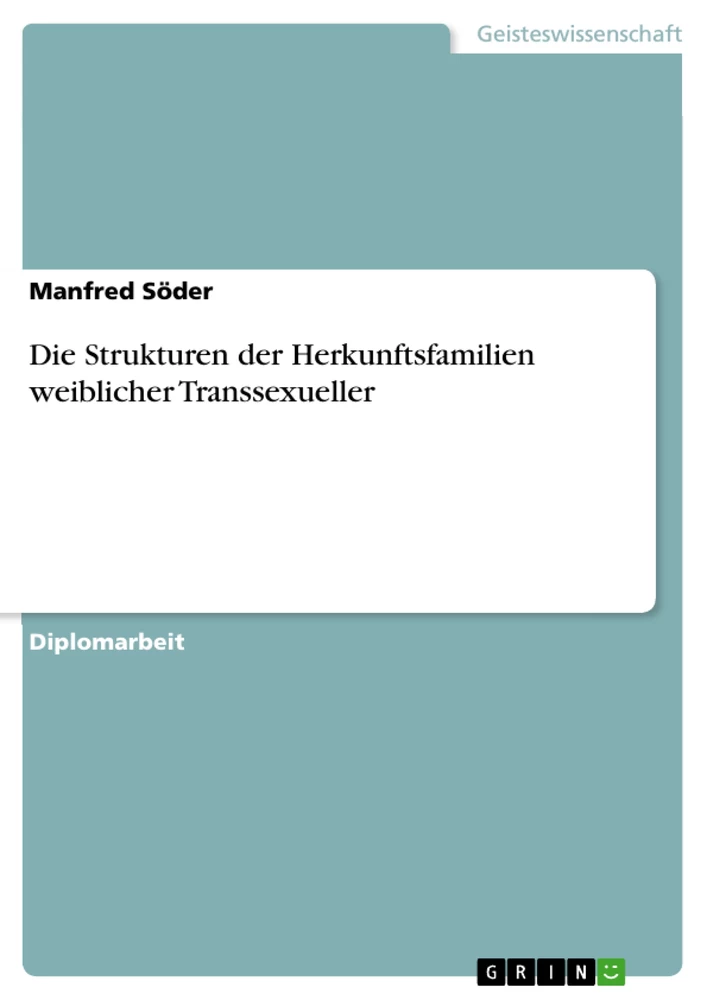Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wird über eine empirische Untersuchung berichtet, in der die Strukturen der Herkunftsfamilien von transsexuellen Frauen mit denen einer weiblichen Vergleichsgruppe anhand von zwei in der systemischen Familiendiagnostik entwickelten
Methoden, dem Familienskulptur-Test (FST) und dem Fragebogen zur Herkunftsfamilie (HER-FAM), verglichen werden. Mit einer deutschen Fassung des Bem Sex-Role-Inventory wird außerdem versucht, Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen bei der Selbstzuschreibung von männlichen und weiblichen sozial erwünschten Eigenschaften aufzuzeigen und aus diesen Skalen Aussagen zum Konzept der Androgynie zu generieren.
Zusätzlich wird versucht, mit einem eigenen Fragebogen (Düsseldorfer Fragebogen zur Transidentität - DFTI) ein Instrument zu erproben, welches Erstinterview und diagnostische Anamnese strukturieren soll und auch im Bereich empirischer Forschung standardisiert einsetzbar ist. Eine Stichprobe aus zwanzig weiblichen Transsexuellen, die im
Untersuchungszeitraum im Düsseldorfer Gesundheitsamt zwecks Beratung, psychosozialer Betreuung oder Begutachtung vorsprachen, wurden auf freiwilliger Basis in die Untersuchung einbezogen. Eine gleich große weibliche Vergleichsgruppe wurde aus dem
Bekanntenkreis des Untersuchers rekrutiert.
Transsexelle Frauen verfügen über ein geschlechtsstereotypes Selbstkonzept, das sich von dem nicht-transsexueller Frauen dadurch unterscheidet, daß sie sich in einem größeren Umfang stereotype männliche Eigenschaften und in einem geringeren Umfang stereotype
weibliche Eigenschaften zuschreiben. Es entspricht damit eher dem für das männliche Geschlecht typischem Selbstkonzept. Trotzdem sind transsexuelle Frauen genau so in der Lage, auch stereotype weibliche Eigenschaften in ihr Selbstkonzept zu integrieren, so wie
nicht-transsexuelle Frauen auch Stereotype Eigenschaften beider Geschlechter nebeneinander vereinbaren können. Transsexuelle Frauen sind somit ähnlich androgyn im Sinne Bems (1974) wie nicht transsexuelle Frauen.
Bezüglich der Familienstrukturen weiblicher Transsexueller zeigten sich die folgenden signifikanten Unterschiede: Die elterliche Paarbeziehung in den Herkunftsfamilien wurde im Mittel von den transsexuellen Frauen gespaltener erlebt als von der weiblichen
Vergleichsgruppe.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Begriffsbestimmungen
- 1.1.1 Transsexualität und Transsexualismus
- 1.1.2 Mit Transsexualität verwandte Begriffe
- 1.2 Prävalenz und Geschlechterverhältnis
- 1.3 Diagnostik und Begutachtung
- 1.3.1 ICD-10
- 1.3.2 DSM-IV
- 1.3.3 Standards der Behandlung und Begutachtung
- 1.3.4 Status- und Verlaufsdiagnostik
- 1.3.5 Die Behandlung von Transsexualität
- 1.3.6 Besondere Rahmenbedingungen der Studie
- 1.4 Die Ätiologie weiblicher Transsexualität
- 1.4.1 Das biosomatische Geschlecht
- 1.4.2 Das psychosoziale Geschlecht
- 1.5 Familiensystemische Konzepte
- 1.5.1 Das strukturelle Familienmodell
- 1.6 Fragestellung und Hypothesen
- 1.6.1 Fragestellungen
- 1.6.2 Hypothesen
- 1.1 Begriffsbestimmungen
- 2. Methoden
- 2.1 Erhebungsinstrumente
- 2.2 Planung der Untersuchung
- 2.2.1 Untersuchungsdesign
- 2.2.2 Stichprobenkriterien
- 2.3 Durchführung der Untersuchung
- 2.3.1 Stichprobengewinnung
- 2.3.2 Datenerhebung
- 2.4 Statistische Auswertung
- 3. Beschreibung der Stichproben
- 3.1 Soziodemographische Beschreibung
- 3.2 Beschreibung der Untersuchungsgruppe
- 3.3 Beschreibung der Vergleichsgruppe
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Darstellung der Ergebnisse
- 4.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5. Diskussion
- 5.1 Interpretation der Ergebnisse
- 5.2 Diskussion der Methode
- 5.3 Schlußfolgerungen
- 5.4 Ausblick und zukünftige Fragestellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Strukturen der Herkunftsfamilien weiblicher Transsexueller im Vergleich zu einer Kontrollgruppe von Frauen mit kongruenter Geschlechtsidentität. Ziel ist es, Unterschiede in den Familienstrukturen und im Selbstkonzept beider Gruppen aufzuzeigen und diese im Kontext bestehender ätiologischer Modelle zu diskutieren.
- Vergleich der Familienstrukturen von transsexuellen und nicht-transsexuellen Frauen
- Untersuchung des Selbstkonzepts hinsichtlich geschlechtsspezifischer Eigenschaften
- Analyse der Vater-Tochter-Beziehung in den Herkunftsfamilien
- Auswertung der Geschwisterreihenfolge
- Anwendung und Evaluation verschiedener Erhebungsinstrumente
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel legt die Grundlage der Studie, indem es die Begriffe Transsexualität und Transsexualismus definiert und verwandte Konzepte abgrenzt. Es behandelt die Prävalenz und das Geschlechterverhältnis, die diagnostischen Kriterien (ICD-10 und DSM-IV) und die Standards der Behandlung und Begutachtung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Ätiologie weiblicher Transsexualität, wobei sowohl biosomatische als auch psychosoziale Faktoren berücksichtigt werden. Familiensystemische Konzepte, insbesondere das strukturelle Familienmodell, werden eingeführt, um den theoretischen Rahmen der Untersuchung zu bilden. Schließlich werden die Forschungsfragen und Hypothesen der Studie formuliert.
2. Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Es werden die verwendeten Erhebungsinstrumente vorgestellt, darunter der Bem Sex-Role-Inventory (BSRI), der Fragebogen zur Herkunftsfamilie (HER-FAM), der Familienskulptur-Test (FST) und der eigens entwickelte Düsseldorfer Fragebogen zur Transidentität (DFTI). Das Untersuchungsdesign, die Stichprobenkriterien und die Vorgehensweise bei der Datenerhebung und -auswertung werden präzise erläutert.
3. Beschreibung der Stichproben: In diesem Kapitel werden die soziodemografischen Merkmale der Untersuchungsgruppe (weibliche Transsexuelle) und der Vergleichsgruppe (Frauen mit kongruenter Geschlechtsidentität) detailliert dargestellt. Dies liefert wichtige Kontextinformationen für die Interpretation der Ergebnisse.
4. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Die Ergebnisse der verschiedenen Erhebungsinstrumente (BSRI, HER-FAM, FST, DFTI) werden systematisch dargestellt und statistisch ausgewertet. Die Ergebnisse liefern quantitative Daten zur Familienstruktur, zum Selbstkonzept und weiteren relevanten Aspekten.
Schlüsselwörter
Transsexualität, Herkunftsfamilie, Familienstruktur, Geschlechtsidentität, Selbstkonzept, Androgynie, Familienskulptur-Test, Fragebogen zur Herkunftsfamilie, Bem Sex-Role-Inventory, Düsseldorfer Fragebogen zur Transidentität, empirische Forschung, systemische Familientherapie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Familienstrukturen weiblicher Transsexueller
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht die Familienstrukturen von weiblichen Transsexuellen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe von Frauen mit kongruenter Geschlechtsidentität. Das Ziel ist es, Unterschiede in den Familienstrukturen und im Selbstkonzept beider Gruppen aufzuzeigen und diese im Kontext bestehender ätiologischer Modelle zu diskutieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Studie behandelt den Vergleich der Familienstrukturen, die Untersuchung des Selbstkonzepts hinsichtlich geschlechtsspezifischer Eigenschaften, die Analyse der Vater-Tochter-Beziehung, die Auswertung der Geschwisterreihenfolge und die Anwendung und Evaluation verschiedener Erhebungsinstrumente.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet verschiedene Erhebungsinstrumente wie den Bem Sex-Role-Inventory (BSRI), den Fragebogen zur Herkunftsfamilie (HER-FAM), den Familienskulptur-Test (FST) und den eigens entwickelten Düsseldorfer Fragebogen zur Transidentität (DFTI). Das Untersuchungsdesign, die Stichprobenkriterien und die Vorgehensweise bei der Datenerhebung und -auswertung werden detailliert beschrieben.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung (Definitionen, Prävalenz, Diagnostik, Ätiologie, Fragestellung), Methoden (Erhebungsinstrumente, Untersuchungsdesign, Stichprobe, Auswertung), Beschreibung der Stichproben (soziodemografische Merkmale), Ergebnisse (Darstellung und Zusammenfassung der Ergebnisse) und Diskussion (Interpretation der Ergebnisse, methodische Diskussion, Schlussfolgerungen, Ausblick).
Welche Begriffe werden definiert?
Die Einleitung definiert zentrale Begriffe wie Transsexualität und Transsexualismus und grenzt verwandte Konzepte ab. Es werden auch die diagnostischen Kriterien nach ICD-10 und DSM-IV erläutert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die systematisch dargestellten und statistisch ausgewerteten Ergebnisse der verschiedenen Erhebungsinstrumente (BSRI, HER-FAM, FST, DFTI). Diese liefern quantitative Daten zur Familienstruktur, zum Selbstkonzept und weiteren relevanten Aspekten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse, diskutiert die angewandte Methode, zieht Schlussfolgerungen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Studie?
Schlüsselwörter sind: Transsexualität, Herkunftsfamilie, Familienstruktur, Geschlechtsidentität, Selbstkonzept, Androgynie, Familienskulptur-Test, Fragebogen zur Herkunftsfamilie, Bem Sex-Role-Inventory, Düsseldorfer Fragebogen zur Transidentität, empirische Forschung, systemische Familientherapie.
- Quote paper
- Manfred Söder (Author), 1998, Die Strukturen der Herkunftsfamilien weiblicher Transsexueller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209