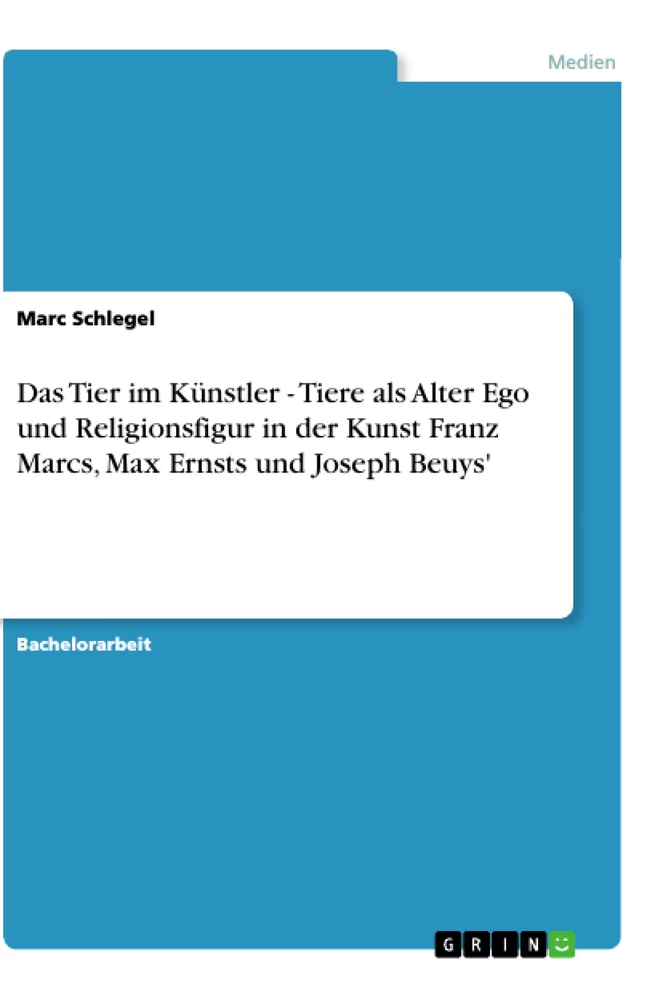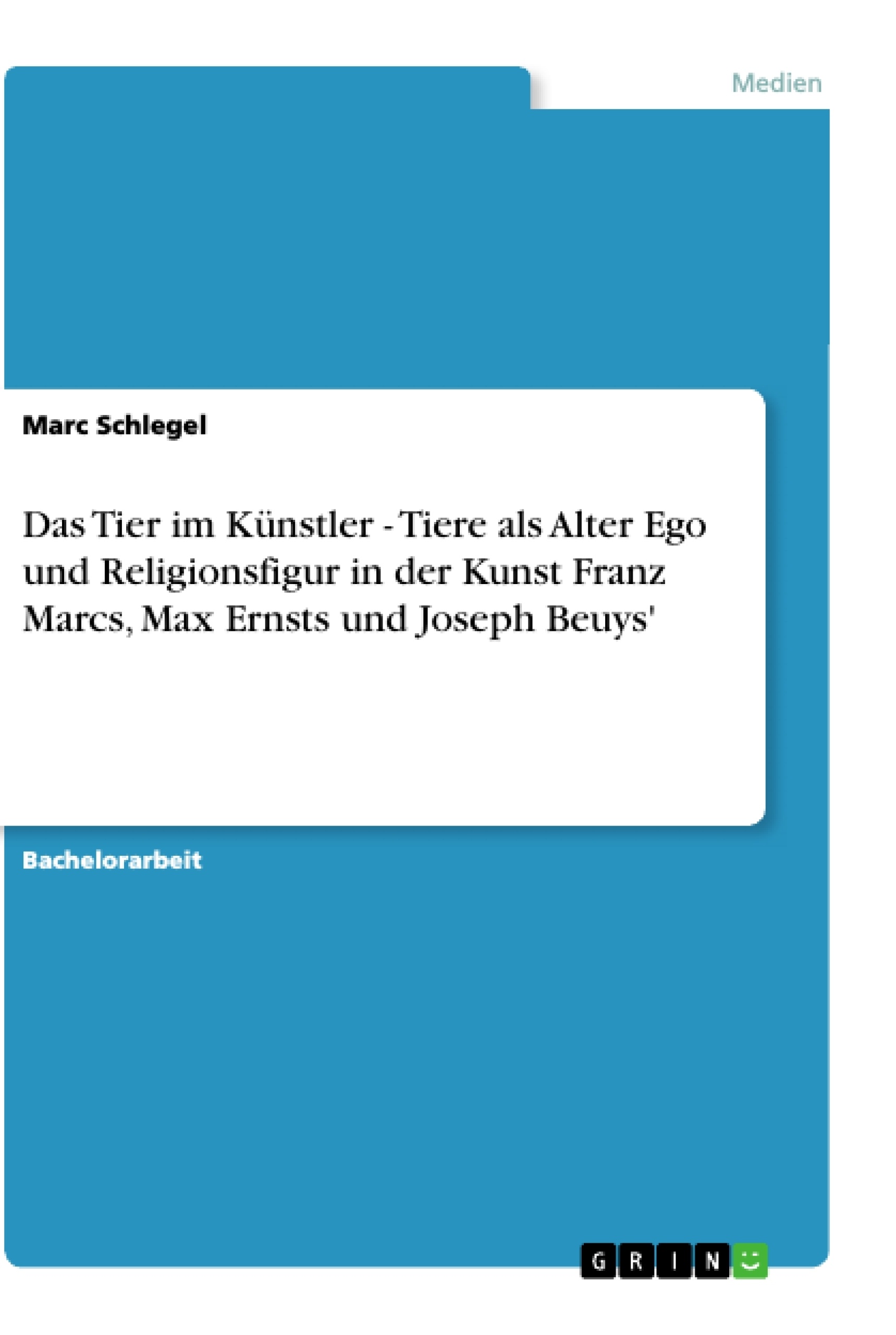[...]
Die ältesten abbildenden Kunstwerke der Menschheitsgeschichte finden sich in
der berühmten südfranzösischen Höhle von Lascaux, deren früheste Malereien
um 15.000 v. Chr. entstanden sind. Zwischen erlegten Bisons, den berühmten
schwarzen Stieren und sonstiger Fauna der Altsteinzeit findet sich eine weitaus
eigenartigere Zeichnung: ein liegender Mann mit Vogelkopf. Zwischen den
ältesten Zeugnissen menschlicher Kunst stoßen wir auf ein Mischwesen aus
Mensch und Tier.
Der Vogelmann von Lascaux steht am Anfang einer langen Tradition von
Metamorphosen zwischen Mensch- und Tierwelt in der bildenden Kunst. Von den
Sphingen der alten Ägypter, über die geflügelten Darstellungen weiblicher
Dämonen wie der sumerischen Lilith oder griechischer Sirenen, Minotauren und
indischen Gottheiten bis zu den Engeln des mittelalterlichen Christentums.
Beispiele für diese Chimären sind endlos. Nicht immer sind es jedoch solche
mutierten Mischwesen, die körperlich humane und animale Merkmale vereinen.
Auch in Illustrationen zu Aesops Fabeln oder Goethes „Reineke Fuchs“ lassen
Künstler die Grenzen zwischen Mensch und Kreatur verschwimmen, indem sie
anthropomorphe Tiere ihrer natürlichen Sphäre entheben und mit menschlichen
Protagonisten gleichsetzen.[...]
Die künstlerisch fruchtbare Vermengung von Tier- und Menschenwelt beschäftigt Maler und Aktionskünstler bis heute. Diese Arbeit diskutiert vor allem die animistischen und identitätsstiftenden Qualitäten, die die Tierdarstellung für die Arbeit von Franz Marc, Max Ernst und Joseph Beuys geboten hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Zwischen Mensch und Tier
- 2. Franz Marc
- 2.1. Leben und erste Pferde
- 2.1.1. Zwei Pferde, Bronze, 1908/09
- 2.2. Animismus in der Kunst Franz Marcs
- 2.2.1. Die großen blauen Pferde, 1911
- 2.2.2. Entwicklung nach 1912
- 2.3. Das Tier als Identifikationsmittel
- 2.3.1. Pferd in Landschaft, 1910
- 2.3.2. Das Tier in Marc?
- 2.1. Leben und erste Pferde
- 3. Max Ernst
- 3.1. Annäherung an das Tierische als Rebellion gegen menschliche Normen?
- 3.2. Loplop als Über-Ich
- 3.3. Alter Ego und Künstlerego
- 4. Joseph Beuys
- 4.1. Der Künstler als Schamane
- 4.1.1. Grundzüge des Schamanismus
- 4.1.2. Beuys autobiographische Initiationslegenden
- 4.2. Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, 1965
- 4.3. Coyote: I like America and America likes Me, 1974
- 4.4. Friedenshase mit Zubehör (Umschmelzaktion) im Rahmen der 7000 Eichen – „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“, 1982
- 4.1. Der Künstler als Schamane
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Tierdarstellung in der Kunst des 20. Jahrhunderts bei Franz Marc, Max Ernst und Joseph Beuys. Sie analysiert, wie diese Künstler das Tier als Symbol und Identifikationsfigur verwendeten, insbesondere im Kontext animistischer und pantheistischer Weltanschauungen. Der Fokus liegt auf der individuellen Herangehensweise der Künstler, trotz gemeinsamer philosophischer Wurzeln.
- Animismus und Pantheismus in der Kunst
- Das Tier als Symbol und Metapher
- Identifikation des Künstlers mit dem Tier
- Gesellschaftliche und politische Implikationen der Tierdarstellung
- Vergleichende Analyse der künstlerischen Strategien von Marc, Ernst und Beuys
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zwischen Mensch und Tier: Dieses einleitende Kapitel beleuchtet die lange Tradition der Vermischung von Mensch und Tier in der Kunstgeschichte, beginnend mit den Höhlenmalereien von Lascaux bis hin zu modernen Künstlern. Es wird der animistische Glaube an die Beseelung der Natur und die damit verbundene pantheistische Weltanschauung diskutiert. Die Arbeit konzentriert sich auf die Auseinandersetzung dreier Künstler des 20. Jahrhunderts mit dieser Thematik: Franz Marc, Max Ernst und Joseph Beuys, deren Werk exemplarisch für die Erforschung der Verbindung von Mensch und Tier in der Kunst steht.
2. Franz Marc: Dieses Kapitel analysiert Franz Marcs künstlerisches Werk, wobei der Schwerpunkt auf seiner intensiven Auseinandersetzung mit dem Pferd als zentralem Motiv liegt. Es werden die animistischen und identitätsstiftenden Aspekte in Marcs Bildern beleuchtet, beginnend mit seinen naturalistischen frühen Arbeiten bis hin zu seinen abstrakten Spätwerken. Die Entwicklung seiner Farb- und Formensprache wird im Kontext seiner pantheistischen Weltanschauung diskutiert.
3. Max Ernst: Im Zentrum dieses Kapitels steht Max Ernsts Verwendung des Vogels als Alter Ego und dessen Bedeutung im Rahmen seiner surrealistischen Kunst. Die Arbeit untersucht Ernsts Mythenbildung um seine eigene Person und die Rolle des Vogels als Ausdruck seiner Rebellion gegen menschliche Normen und Konventionen. Die Analyse fokussiert auf die Collagenromane und deren Dekonstruktion künstlerischer und literarischer Normen.
4. Joseph Beuys: Dieses Kapitel befasst sich mit Joseph Beuys' Werk im Kontext des Schamanismus. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Initiationsriten in Beuys' Leben und Kunst. Drei seiner wichtigsten Aktionen – „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“, „I like America and America likes Me“ und die Umschmelzung der Zarenkrone – werden im Detail erläutert und ihre schamanistischen Aspekte herausgearbeitet. Der Fokus liegt dabei auf der symbolischen Bedeutung der verwendeten Materialien und der rituellen Handlungsabläufe.
Schlüsselwörter
Tierdarstellung, Animismus, Pantheismus, Identitätsfigur, Franz Marc, Max Ernst, Joseph Beuys, Schamanismus, Surrealismus, Expressionismus, Moderne Kunst, Symbol, Metapher, Kunst und Gesellschaft, Künstler-Ich, Totem.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Tierdarstellung in der Kunst des 20. Jahrhunderts bei Franz Marc, Max Ernst und Joseph Beuys
Welche Künstler werden in dieser Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert die Tierdarstellung in der Kunst des 20. Jahrhunderts anhand der Werke von Franz Marc, Max Ernst und Joseph Beuys. Diese drei Künstler werden im Hinblick auf ihre individuellen Herangehensweisen an das Thema und die Verwendung des Tieres als Symbol und Identifikationsfigur untersucht.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Animismus und Pantheismus in der Kunst, die Verwendung des Tieres als Symbol und Metapher, die Identifikation des Künstlers mit dem Tier, gesellschaftliche und politische Implikationen der Tierdarstellung und einen vergleichenden Ansatz der künstlerischen Strategien der drei behandelten Künstler.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Kapitel 1 bietet eine Einführung in das Thema der Mensch-Tier-Beziehung in der Kunstgeschichte. Kapitel 2 analysiert Franz Marcs Werk mit Fokus auf seine Pferde-Darstellungen. Kapitel 3 untersucht Max Ernsts Verwendung des Vogels als Alter Ego und Symbol der Rebellion. Kapitel 4 befasst sich mit Joseph Beuys' Werk im Kontext des Schamanismus und seiner Aktionen.
Welche Werke einzelner Künstler werden im Detail analysiert?
Bei Franz Marc werden unter anderem "Zwei Pferde, Bronze, 1908/09", "Die großen blauen Pferde, 1911" und "Pferd in Landschaft, 1910" betrachtet. Bei Max Ernst liegt der Fokus auf seinen Collagenromanen und der Rolle von Loplop. Bei Joseph Beuys werden die Aktionen "Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, 1965", "Coyote: I like America and America likes Me, 1974" und "Friedenshase mit Zubehör (Umschmelzaktion) im Rahmen der 7000 Eichen – „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“, 1982" analysiert.
Welche philosophischen Strömungen spielen eine Rolle?
Die Arbeit behandelt Animismus und Pantheismus als wichtige philosophische Hintergründe für die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Tier. Der Schamanismus wird im Kontext von Joseph Beuys' Werk diskutiert. Der Surrealismus wird bei der Analyse von Max Ernsts Werk berücksichtigt, während der Expressionismus im Zusammenhang mit Franz Marc relevant ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Tierdarstellung, Animismus, Pantheismus, Identitätsfigur, Franz Marc, Max Ernst, Joseph Beuys, Schamanismus, Surrealismus, Expressionismus, Moderne Kunst, Symbol, Metapher, Kunst und Gesellschaft, Künstler-Ich, Totem.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie die drei Künstler das Tier auf unterschiedliche Weise als Symbol und Identifikationsfigur verwendeten, wobei animistische und pantheistische Weltanschauungen eine wichtige Rolle spielen. Der Fokus liegt auf der individuellen Herangehensweise der Künstler trotz gemeinsamer philosophischer Wurzeln. Die Arbeit analysiert die gesellschaftlichen und politischen Implikationen der jeweiligen Tierdarstellungen.
- Quote paper
- Marc Schlegel (Author), 2012, Das Tier im Künstler - Tiere als Alter Ego und Religionsfigur in der Kunst Franz Marcs, Max Ernsts und Joseph Beuys', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209847