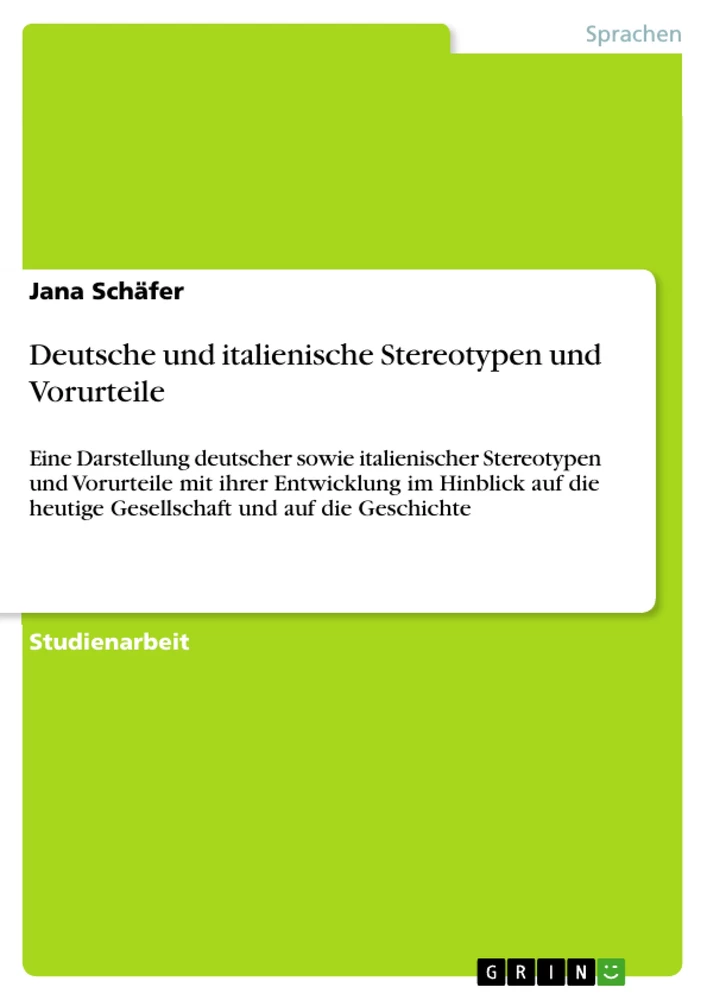Die heute bestehenden Stereotypen und ihre Entwicklung, die im Hinblick auf die Geschichte von Deutschland und Italien von großer Bedeutung für die heutigen gegenseitigen Beziehungen zueinander sind, spielen natürlich für beide Nationen eine wichtige Rolle. Um die relevantesten Merkmale von Stereotypen sowie von den gegenseitigen Vorurteilen negativer und positiver Art genauer zu beschreiben, die sowohl die Deutschen über die Italiener als auch diese über die Deutschen entwickelt haben, wird in der folgenden Arbeit nicht nur ein Überblick über die Entstehung der Denkbilder gegeben, sondern auch beispielhaft herausgestellt, welche gegenseitigen Vorstellungen heute bestehen.
Der Fokus dieser Arbeit liegt dabei auf den Untersuchungen von Walter Lippmann, der sich eingehend mit der Stereotypenforschung beschäftigt hat, sowie auf den Ausarbeitungen von Gian Enrico Rusconi, Sala Cinzia, Eva Sabine Kuntz, Frank Baasner und Valeria Thiel, die sich ganz bewusst mit den Situationen in Deutschland und Italien beschäftigt haben.
Um eine übersichtliche Basis für die Thematik der vorliegenden Arbeit zu erhalten, wird daher zunächst eine allgemeine Definition der Begrifflichkeiten des Stereotyps sowie des Vorurteils gegeben, um anschließend genauer auf das Italienbild der Deutschen einzugehen – sowohl auf dessen Entwicklung als auch auf explizite Beispiele für heute existierende Denkbilder. Ebenso sind auch die Stereotypen und Vorurteile dargestellt, die die Italiener über die Deutschen haben, sodass im Anschluss daran in einer persönlichen Stellungnahme sowohl eine Beurteilung der zuvor dargestellten Denkbilder im Hinblick auf persönliche Erfahrungen gegeben wird, als auch eine Betrachtung der Initiative des Goethe-Instituts, die sich mit den deutsch-italienischen Beziehungen sowie mit den jeweiligen Klischees auseinander setzt.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Stereotypen und Vorurteile, die beide Länder voneinander haben und auch in der Vergangenheit immer hatten, möglichst präzise herauszustellen und anschließend zumindest in Ansätzen zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Deutsch-italienische Stereotypen und Vorurteile
- 2.1 Definition und Abgrenzung des Stereotypenbegriffs vom Terminus Vorurteil
- 2.2 Das Italienbild der Deutschen - Entwicklung von Stereotypen
- 2.3 Stereotypen und Vorurteile der Deutschen gegenüber den Italienern
- 2.4 Das Deutschlandbild der Italiener - Entwicklung von Stereotypen
- 2.5 Stereotypen und Vorurteile der Italiener gegenüber den Deutschen
- 3. Persönliche Stellungnahme
- 3.1 Beurteilung der Denkbilder im Hinblick auf eigene Erfahrungen
- 3.2 Stellungnahme zum Video „Va bene?!“ (Goethe Institut)
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsch-italienischen Stereotypen und Vorurteile, ihre historische Entwicklung und ihre Bedeutung für die heutigen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Die Arbeit analysiert sowohl positive als auch negative Denkbilder und beleuchtet die Perspektiven beider Nationen. Die Untersuchung basiert auf den Arbeiten von Walter Lippmann sowie weiteren Forschern, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
- Definition und Abgrenzung von Stereotypen und Vorurteilen
- Entwicklung des Italienbildes bei den Deutschen
- Entwicklung des Deutschlandbildes bei den Italienern
- Beispiele für bestehende Stereotypen und Vorurteile
- Beurteilung der Denkbilder im Kontext persönlicher Erfahrungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der deutsch-italienischen Stereotypen und Vorurteile ein und betont deren historische Entwicklung und Bedeutung für die heutigen Beziehungen. Sie umreißt den Fokus der Arbeit, der auf den Untersuchungen von Walter Lippmann und weiteren Forschern basiert, und kündigt die Struktur der Arbeit an, welche eine Definition der Begriffe Stereotyp und Vorurteil, die Analyse der gegenseitigen Bilder und eine persönliche Stellungnahme umfasst. Das erklärte Ziel ist eine präzise Darstellung und Bewertung der bestehenden Denkbilder.
2. Deutsch-italienische Stereotypen und Vorurteile: Dieses Kapitel beginnt mit einer genauen Definition von Stereotyp und Vorurteil, unterscheidet zwischen den Begriffen und hebt die kognitive und affektive Komponente von Stereotypen hervor. Es beleuchtet die Rolle von Stereotypen für das Gruppen- und Zugehörigkeitsgefühl. Es diskutiert die Herausforderungen der Stereotypenforschung und nennt verschiedene Forschungsansätze, wie die Analyse historischer Quellen, Schulbücher und Medieninhalte, um ein umfassendes Bild zu erstellen. Der Unterschied zwischen Stereotypen und Vorurteilen wird anhand eines Beispiels (Nudelkonsum der Italiener) veranschaulicht. Das Kapitel legt den Grundstein für die anschließende Analyse der gegenseitigen Wahrnehmung zwischen Deutschen und Italienern.
2.2 Das Italienbild der Deutschen - Entwicklung von Stereotypen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Italienbildes in Deutschland. Es beginnt mit einem Zitat von Professor Gian Enrico Rusconi, das ein gängiges Missverständnis (Liebe vs. Respekt) zwischen den beiden Kulturen aufzeigt. Das Kapitel analysiert die Entstehung und Veränderung der deutschen Stereotypen über Italien, beleuchtet die wichtigsten Aspekte dieses Bildes und liefert konkrete Beispiele für die heute existierenden Denkmuster.
Schlüsselwörter
Stereotypen, Vorurteile, Deutsch-italienische Beziehungen, Italienbild, Deutschlandbild, Walter Lippmann, kulturelle Wahrnehmung, nationale Identität, interkulturelle Kommunikation, Klischees.
FAQ: Deutsch-Italienische Stereotypen und Vorurteile
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert deutsch-italienische Stereotypen und Vorurteile, deren historische Entwicklung und Bedeutung für die heutigen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Sie untersucht sowohl positive als auch negative Denkbilder aus der Perspektive beider Nationen und basiert auf den Arbeiten von Walter Lippmann und weiteren relevanten Forschern. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine detaillierte Untersuchung deutsch-italienischer Stereotypen und Vorurteile, eine persönliche Stellungnahme und eine Zusammenfassung.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit definiert und grenzt die Begriffe Stereotyp und Vorurteil ab. Sie untersucht die Entwicklung des Italienbildes in Deutschland und des Deutschlandbildes in Italien, beleuchtet dabei konkrete Beispiele für bestehende Stereotypen und Vorurteile und bewertet diese im Kontext persönlicher Erfahrungen. Die Rolle von Stereotypen für das Gruppen- und Zugehörigkeitsgefühl wird ebenso diskutiert wie die Herausforderungen der Stereotypenforschung und verschiedene Forschungsansätze.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel über deutsch-italienische Stereotypen und Vorurteile (inkl. Definitionen und Abgrenzung der Begriffe, Entwicklung der gegenseitigen Bilder), ein Kapitel mit einer persönlichen Stellungnahme (inkl. Beurteilung der Denkbilder im Hinblick auf eigene Erfahrungen und Stellungnahme zu einem Video), und eine Zusammenfassung. Das Kapitel über deutsch-italienische Stereotypen und Vorurteile beinhaltet Unterkapitel zur Entwicklung des Italienbildes in Deutschland und des Deutschlandbildes in Italien.
Welche Forschungsansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt verschiedene Forschungsansätze, darunter die Analyse historischer Quellen, Schulbücher und Medieninhalte, um ein umfassendes Bild der deutsch-italienischen Stereotypen und Vorurteile zu erstellen. Die Arbeit basiert auf den Arbeiten von Walter Lippmann und weiteren Forschern, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stereotypen, Vorurteile, Deutsch-italienische Beziehungen, Italienbild, Deutschlandbild, Walter Lippmann, kulturelle Wahrnehmung, nationale Identität, interkulturelle Kommunikation, Klischees.
Welche Quellen werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich explizit auf die Arbeiten von Walter Lippmann und weitere, nicht näher benannte Forscher, die sich mit dem Thema deutsch-italienischer Stereotypen und Vorurteile beschäftigt haben. Zusätzlich wird ein Video des Goethe-Instituts ("Va bene?!") erwähnt.
Gibt es eine persönliche Stellungnahme?
Ja, die Arbeit beinhaltet ein Kapitel mit einer persönlichen Stellungnahme, in dem die Denkbilder im Hinblick auf eigene Erfahrungen beurteilt und das Video „Va bene?!“ (Goethe Institut) kommentiert wird.
- Quote paper
- Jana Schäfer (Author), 2012, Deutsche und italienische Stereotypen und Vorurteile, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209843