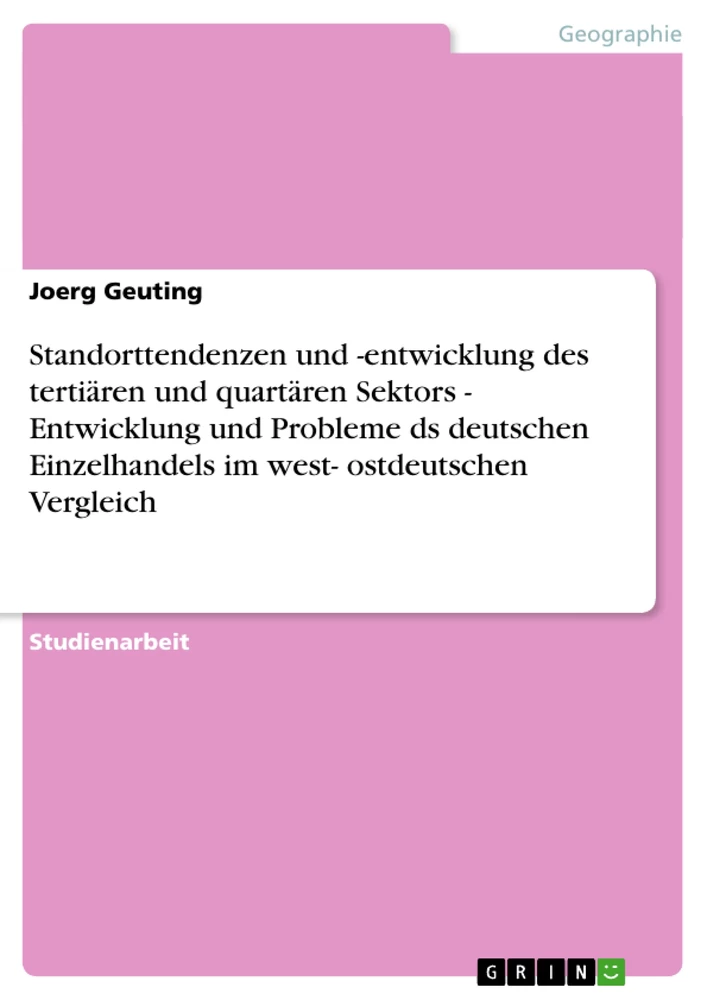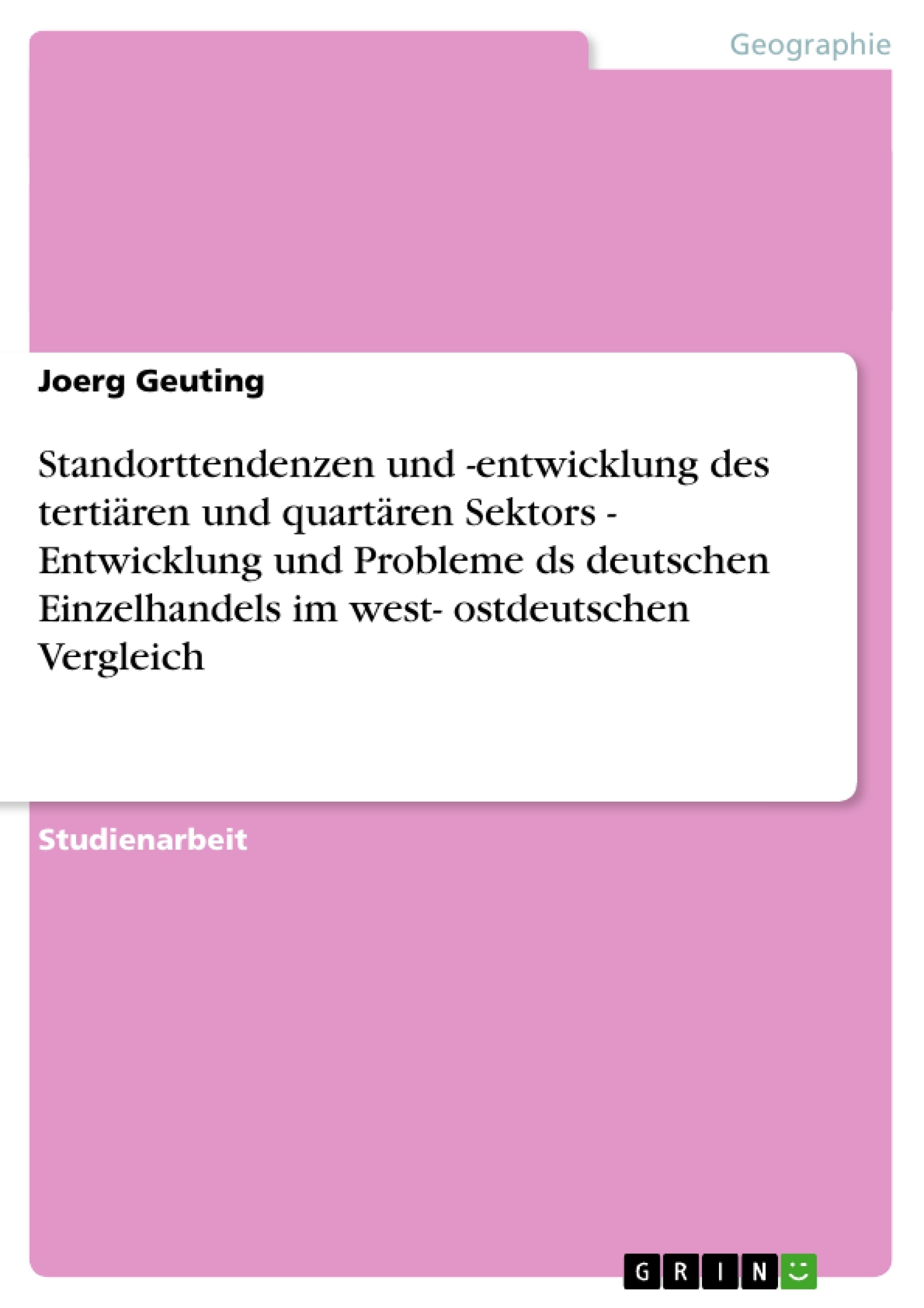Der tertiäre und der quartäre Sektor haben in der heutigen Zeit eine sehr große
Bedeutung für die Wirtschaft in Deutschland. Der Einzelhandel ist Teil des
tertiären Wirtschaftssektors und bildet den Untersuchungsschwerpunkt dieser
Hausarbeit. Es soll aufgeklärt werden, an welchen Standortfaktoren sich der
Einzelhandel orientiert und wie sich der Einzelhandel und die Standortstrukturen
im geteilten Deutschland entwickelt haben, denn die verschiedenen politischen
Systeme hatten auch gravierenden Einfluss auf die Entwicklung des Einzelhandels
und dessen Standortstrukturen. Nach der Wiedervereinigung stand
man vor dem Problem die ostdeutschen Strukturen an die Westlichen angleichen
zu wollen. Welche Probleme dabei entstanden und worin die Ursachen für
die Strukturprobleme in den ostdeutschen Städten lagen, soll an dem Beispiel
der sächsischen Hauptstadt Dresden veranschaulicht werden. Es gab aber auch
positive Entwicklungen bei der Gestaltung von Einzelhandelsstandorten in den
neuen Bundesländern, was am Beispiel der Stadt Jena verdeutlicht werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition der Begriffe „tertiärer Sektor“ und „quartärer Sektor“
- 3. Standortfaktoren des Einzelhandels
- 4. Determinanten des Strukturwandels in Deutschland
- 4.1. Einzelhandelsstruktur in der BRD
- 4.2. Einzelhandelsstruktur in der DDR
- 4.3. Wandel der Einzelhandelsstruktur im vereinigten Deutschland
- 5. Ursachen für die Standortstrukturprobleme in den neuen Bundesländern, am Beispiel der Stadt Dresden
- 6. Chancen zur Revitalisierung der ostdeutschen Innenstädte am Beispiel der thüringischen Stadt Jena
- 6.1. Revitalisierung der Jenaer Innenstadt
- 6.2. Jena als Modellbeispiel für die ostdeutschen Städte
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Standortentwicklung des Einzelhandels in Deutschland, insbesondere im Vergleich zwischen West und Ost. Die Zielsetzung besteht darin, die relevanten Standortfaktoren zu identifizieren und den Einfluss der politischen Systeme auf die Entwicklung der Einzelhandelsstrukturen zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Probleme nach der Wiedervereinigung und untersucht Lösungsansätze anhand von Fallbeispielen.
- Standortfaktoren des Einzelhandels
- Entwicklung der Einzelhandelsstruktur in der BRD und DDR
- Strukturwandel im vereinigten Deutschland
- Standortprobleme in den neuen Bundesländern (Dresden)
- Revitalisierung ostdeutscher Innenstädte (Jena)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Standortentwicklung des tertiären und quartären Sektors in Deutschland ein, wobei der Fokus auf den Einzelhandel liegt. Sie hebt die Bedeutung des Einzelhandels für die deutsche Wirtschaft hervor und benennt die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Analyse der Standortfaktoren und die Entwicklung der Einzelhandelsstrukturen im geteilten und vereinigten Deutschland, insbesondere die Herausforderungen und Chancen der Anpassung ostdeutscher Strukturen an westdeutsche Verhältnisse. Die Arbeit nutzt die Städte Dresden und Jena als Fallbeispiele für die Analyse von Problemen und erfolgreichen Revitalisierungsstrategien.
2. Definition der Begriffe „tertiärer Sektor“ und „quartärer Sektor“: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „tertiärer“ und „quartärer Sektor“ und diskutiert die Schwierigkeiten bei deren Abgrenzung. Es vergleicht die dreigliedrige Sektoreneinteilung von Fourastié mit dem vierteiligen System von Gottmann. Die Diskussion beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Zuordnung von Tätigkeiten mit sowohl materiellen als auch immateriellen Aspekten ergeben, und betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise, um die Komplexität moderner Wirtschaftsprozesse adäquat abzubilden. Der Unterschied zwischen einfachen und komplexeren Dienstleistungen wird hervorgehoben, um den quartären Sektor abzugrenzen.
3. Standortfaktoren des Einzelhandels: Das Kapitel identifiziert fünf Gruppen von Standortfaktoren für den Einzelhandel: absatz- und nachfrageorientierte Faktoren (Marktgröße, Kaufkraft, Präferenzen), Agglomerations- und Konkurrenzfaktoren (Anziehung und Vermeidung von Konkurrenz, Frequenzbringer), beschaffungsorientierte Faktoren (Flächenverfügbarkeit, Arbeitskräfte, Lieferanten), planerische Faktoren (Flächennutzungspläne) und individuelle Faktoren (persönliche Präferenzen der Betreiber). Die Ausführungen verdeutlichen die Interdependenzen zwischen diesen Faktoren und ihren Einfluss auf die Standortentscheidungen von Einzelhandelsunternehmen. Der direkte Kontakt zwischen Anbieter und Nachfrager steht im Mittelpunkt der Analyse.
5. Ursachen für die Standortstrukturprobleme in den neuen Bundesländern, am Beispiel der Stadt Dresden: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen für die Standortprobleme des Einzelhandels in den neuen Bundesländern anhand des Beispiels Dresden. Es analysiert die spezifischen Herausforderungen, die sich aus der Transformation der Wirtschaft und der Anpassung an westdeutsche Marktstrukturen ergeben haben, und vertieft die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen dieses Prozesses. Es beleuchtet die Schwierigkeiten der Anpassung an den neuen Wettbewerb und die Bedeutung spezifischer Standortfaktoren im Kontext der ostdeutschen Einzelhandelslandschaft.
6. Chancen zur Revitalisierung der ostdeutschen Innenstädte am Beispiel der thüringischen Stadt Jena: Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel, das sich mit den Problemen in Dresden befasst, zeigt dieses Kapitel positive Entwicklungen bei der Gestaltung von Einzelhandelsstandorten in Ostdeutschland am Beispiel von Jena. Es präsentiert und analysiert erfolgreiche Revitalisierungsstrategien und untersucht die Faktoren, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Best-Practice-Beispielen und der Ableitung von Schlussfolgerungen für andere ostdeutsche Städte.
Schlüsselwörter
Einzelhandel, Standortfaktoren, Strukturwandel, Wiedervereinigung, Ost-West-Vergleich, Standortprobleme, Revitalisierung, Innenstädte, Dresden, Jena, tertiärer Sektor, quartärer Sektor.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Standortentwicklung des Einzelhandels in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Standortentwicklung des Einzelhandels in Deutschland, insbesondere den Vergleich zwischen Ost und West. Sie untersucht die relevanten Standortfaktoren und den Einfluss der politischen Systeme auf die Entwicklung der Einzelhandelsstrukturen vor und nach der Wiedervereinigung. Die Städte Dresden und Jena dienen als Fallbeispiele zur Untersuchung von Problemen und erfolgreichen Revitalisierungsstrategien.
Welche Sektoren werden betrachtet und wie werden sie definiert?
Die Arbeit betrachtet den tertiären und quartären Sektor. Das Kapitel 2 definiert diese Begriffe und diskutiert die Schwierigkeiten ihrer Abgrenzung, indem es die dreigliedrige Sektoreneinteilung von Fourastié mit dem vierteiligen System von Gottmann vergleicht. Der Unterschied zwischen einfachen und komplexeren Dienstleistungen zur Abgrenzung des quartären Sektors wird hervorgehoben.
Welche Standortfaktoren werden im Einzelnen untersucht?
Kapitel 3 identifiziert fünf Gruppen von Standortfaktoren: absatz- und nachfrageorientierte Faktoren (Marktgröße, Kaufkraft, Präferenzen), Agglomerations- und Konkurrenzfaktoren (Anziehung und Vermeidung von Konkurrenz, Frequenzbringer), beschaffungsorientierte Faktoren (Flächenverfügbarkeit, Arbeitskräfte, Lieferanten), planerische Faktoren (Flächennutzungspläne) und individuelle Faktoren (persönliche Präferenzen der Betreiber). Die Interdependenzen zwischen diesen Faktoren und ihr Einfluss auf Standortentscheidungen werden analysiert.
Welche Probleme im Einzelhandel der neuen Bundesländer werden behandelt?
Kapitel 5 untersucht die Ursachen für Standortprobleme im Einzelhandel der neuen Bundesländer am Beispiel Dresden. Es analysiert die Herausforderungen durch die wirtschaftliche Transformation und die Anpassung an westdeutsche Marktstrukturen, die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen und die Schwierigkeiten der Anpassung an den neuen Wettbewerb.
Wie werden erfolgreiche Revitalisierungsstrategien dargestellt?
Kapitel 6 zeigt positive Entwicklungen am Beispiel Jena. Es präsentiert und analysiert erfolgreiche Revitalisierungsstrategien und die Faktoren, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Der Fokus liegt auf Best-Practice-Beispielen und Schlussfolgerungen für andere ostdeutsche Städte.
Welche Städte dienen als Fallbeispiele?
Die Arbeit verwendet Dresden als Beispiel für die Herausforderungen in den neuen Bundesländern und Jena als Beispiel für erfolgreiche Revitalisierungsstrategien ostdeutscher Innenstädte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Einzelhandel, Standortfaktoren, Strukturwandel, Wiedervereinigung, Ost-West-Vergleich, Standortprobleme, Revitalisierung, Innenstädte, Dresden, Jena, tertiärer Sektor, quartärer Sektor.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Definition der Sektoren, Standortfaktoren, Determinanten des Strukturwandels in Deutschland (mit Unterkapiteln zu BRD, DDR und vereinigtem Deutschland), Ursachen für Standortprobleme in den neuen Bundesländern (Dresden), Chancen zur Revitalisierung ostdeutscher Innenstädte (Jena), und Fazit.
- Quote paper
- Joerg Geuting (Author), 2002, Standorttendenzen und -entwicklung des tertiären und quartären Sektors., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20965