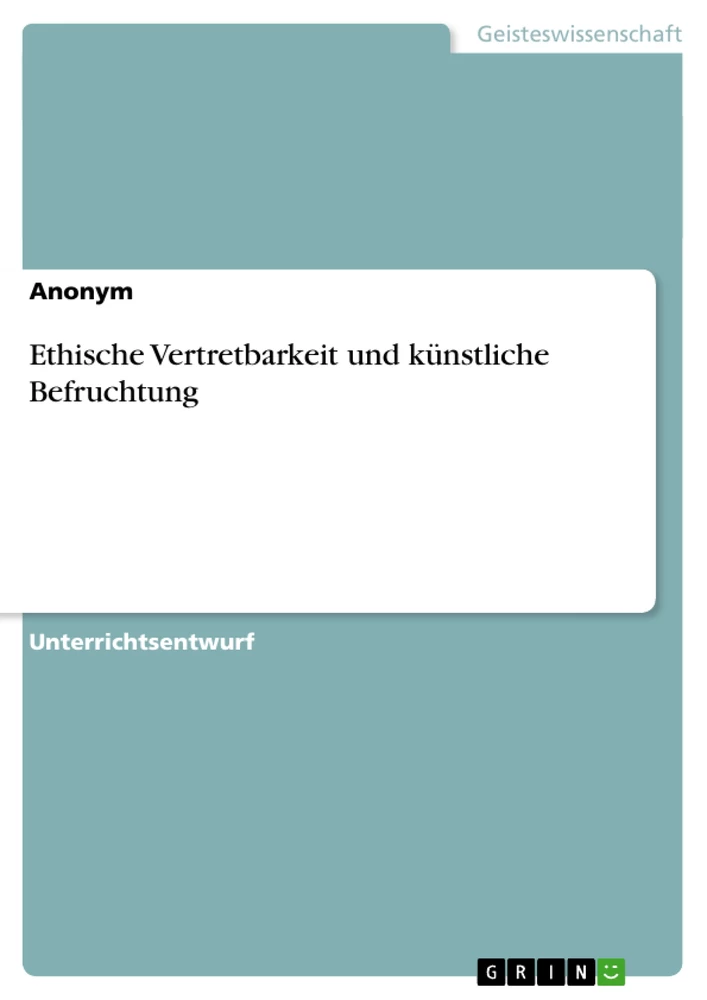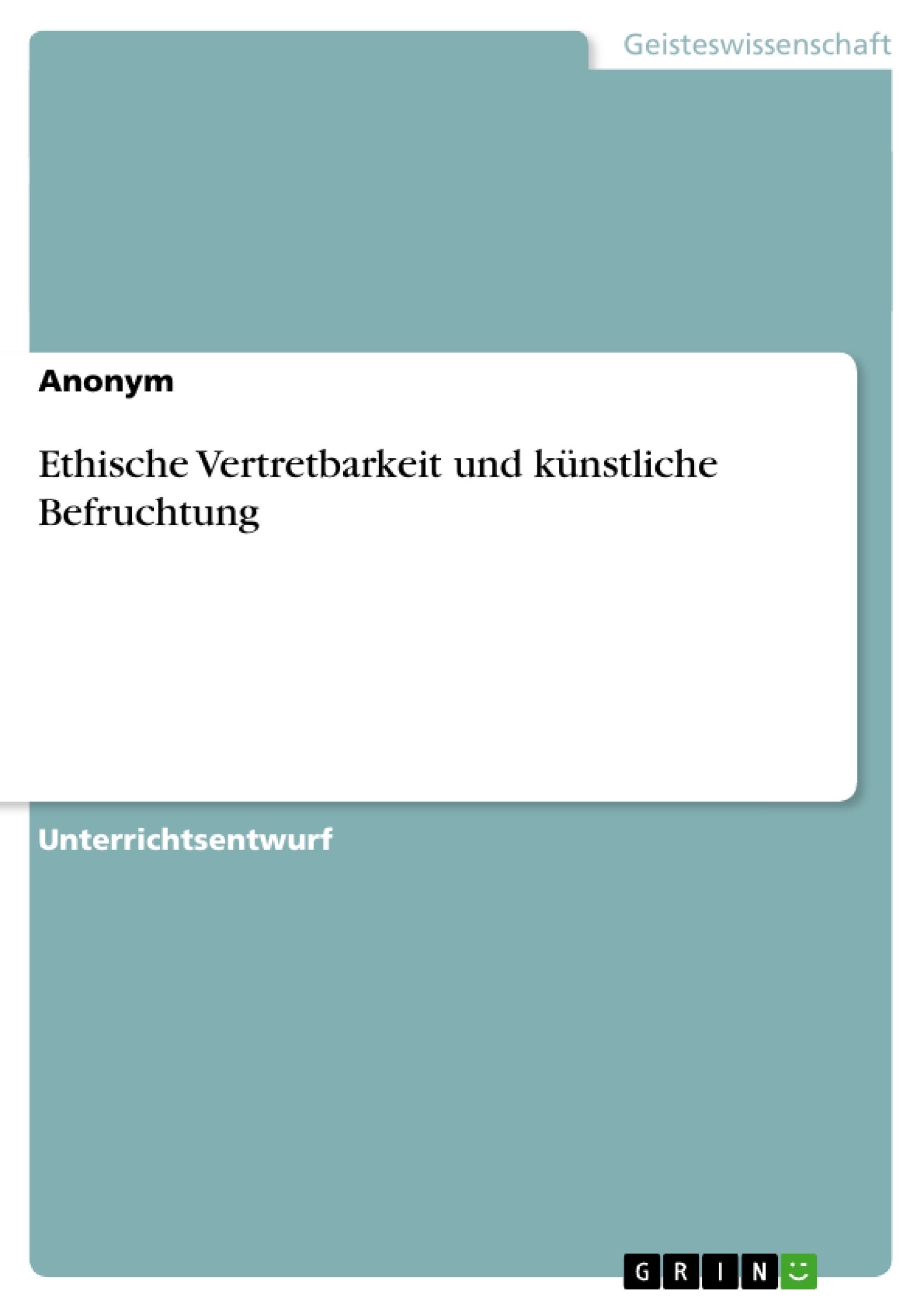In der Schule sollen die Schüler zu mündigen Bürgern erzogen werden, die lernen sollen für sich selbst und andere verantwortungsvoll Entscheidungen treffen zu können und somit zur Mitgestaltung eines gesellschaftlichen Miteinanders befähigt werden. Die methodisch-didaktische Aufbereitung des Themas Menschenwürde ist unverzichtbar und zentrales Leitmotiv in der pädagogischen Arbeit. Den Schülern soll vermittelt werden, was es praktisch bedeutet, sich für die Würde des Menschen einzusetzen.
Des Weiteren erfahren die Schüler die Phasen ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung als Herausforderung und Bereicherung ihrer Lebensmöglichkeiten und erkennen die Bedeutung von Ehe, Elternschaft und Familie für die Verlässlichkeit menschlicher Beziehungen und für den Fortbestand der Gemeinschaft.
Unterrichtsversuch am 24.11.2010 : Ist künstliche Befruchtung ethisch vertretbar?
1.2. Themenerschließung
1.2.1. Vorgabe des Lehrplans
Bildungs- und Erziehungsziele im Bezug auf mein Thema:
In der Schule sollen die Schüler zu mündigen Bürgern erzogen werden, die lernen sollen für sich selbst und andere verantwortungsvoll Entscheidungen treffen zu können und somit zur Mitgestaltung eines gesellschaftlichen Miteinanders befähigt werden. Die methodisch-didaktische Aufbereitung des Themas Menschenwürde ist unverzichtbar und zentrales Leitmotiv in der pädagogischen Arbeit. Den Schülern soll vermittelt werden, was es praktisch bedeutet, sich für die Würde des Menschen einzusetzen.
Des Weiteren erfahren die Schüler die Phasen ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung als Herausforderung und Bereicherung ihrer Lebensmöglichkeiten und erkennen die Bedeutung von Ehe, Elternschaft und Familie für die Verlässlichkeit menschlicher Beziehungen und für den Fortbestand der Gemeinschaft.
Fachprofil im Bezug auf mein Thema:
Die Schüler werden in ihrer persönlichen Entwicklung begleitet und auf ihrer Suche nach einem sinnvollen und selbstbestimmten Leben unterstützt. Dabei sollen sie die lebensbejahende Kraft des christlichen Glaubens erkennen.
Die Schüler werden auf der Grundlage des christlichen Weltverständnisses darin bestärkt, Lebens- und Handlungsgrundsätze für ihre persönliche Lebensentwicklung und für das Zusammenleben mit anderen Menschen zu entwickeln.
Christliche Lebenseinstellungen können ihnen helfen das Leben bewusster zu gestalten, ihr Gewissen wahrzunehmen, zu bilden und verantwortbare Entscheidungen zu treffen.
Pädagogische Leitthemen im Bezug auf mein Thema:
Die Schüler sollen unterschiedliche Formen der Machtausübung kennen lernen und grundlegende Regeln zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Macht kennen lernen.
Christliche Maßstäbe können ihnen dabei helfen, sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen und verantwortliche Entscheidungen zu treffen.
Die Schüler sollen sich mit der Frage auseinandersetzen, ob wir alles machen dürfen, was in unserer Macht steht: Die ethischen Grenzen des technisch Machbaren.
Die didaktischen Schwerpunkte/Zielbeschreibungen im Bezug auf mein Thema:
Ein aktueller Anlass aus dem Bereich Gesellschaft, Wissenschaft und Technik besteht in der Nobelpreisverleihung 2010 in Medizin für den „Vater der Retortenbabys“ Robert Edwards.
Die Schüler sollen die Argumentation des Nobelpreiskomitees und die berechtigten kritischen Einwände der römisch-katholischen Kirche kennen lernen, um, ohne Indoktrination und Manipulation, ihren eigenen Standpunkt zu finden und, um zu lernen diesen vertreten zu können.
2. Planungsphase
2.1. Elementare Strukturen
Grundlegende Analyse:
(vgl. dazu:
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2010-10/robert-edwards-nobelpreis ; aufgerufen am 8.11.2010
http://www.wdr5.de/sendungen/leonardo/s/d/04.10.2010-16.05/b/medizinnobelpreis-fuer-kinder-aus-dem-reagenzglas.html ; aufgerufen am 8.11.2010
http://www.nzz.ch/nachrichten/panorama/nobelpreis_medizin_1.7808418.html ; vom 4.10.2010; aufgerufen am 8.11.2010
http://www.zeit.de/politik/2010-10/vatikan-kritisiert-nobelkomitee ; aufgerufen am 8.11.2010
http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/zukunftsmedizin/news/medizin-nobelpreis-vatikan-kristisiert-ehrung-fuer-in-vitro-pionier_aid_558995.html ; aufgerufen am:
8.11.2010
http://www.domradio.de/news/68146/katholische-kirche-kritisiert-medizinnobelpreis.html ; aufgerufen am 8.11.2010
http://www.katholisch.de/Nachricht.aspx?NId=4992 ; aufgerufen am 8.11.2010)
Edwards gilt als der Begründer der künstlichen Befruchtung (In-Vitro-Fertilisation) und wird im Dezember 2010 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Millionen unfruchtbarer Paare hat er, durch den wissenschaftlichen Fortschritt, zur Erfüllung ihres Kinderwunsches beigetragen.
1969 gelang es Edwards erstmals die menschliche Samenzelle in die Eizelle einer Frau einzuschleusen. 1978 wurde das erste Retortenbaby Louise Brown geboren, eines von rund 4 Millionen Kindern, die im Reagenzglas gezeugt wurden.
Die römisch-katholische Kirche äußert sich sehr entrüstet über die Vergabe des Nobelpreises und kritisiert das Komitee scharf: Das Problem der Unfruchtbarkeit sei dadurch nicht gelöst und Tausende Embryonen würden im Kühlschrank darauf warten zu sterben. Die Zerstörung menschlicher Embryonen ist als Zerstörung menschlichen Lebens zu werten und für die katholische Kirche nicht zulässig. Äußerste Kritik betrifft auch den unmoralischen Handel mit Eizellen. Weiterhin problematisch ist die Testung der Eizellen auf genetische Defekte (Pränataldiagnostik) und die damit einhergehende Unterteilung zwischen „lebenswertem“ und „lebensunwertem“ Leben.
Elementarisierende Zuspitzung:
„Die großteils neuen medizinischen Fortpflanzungstechniken schaffen eine neuartige ethische Konfliktsituation. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass in einem bisher nicht gekannten Maße der Beginn menschlichen Lebens sowie menschlichen Lebens in seiner Identität, Individualität und Existenz verfügbar wird.“ (Merz 1991. S.50)
Religionspädagogische Aufgabe dieser Unterrichtseinheit ist die Beschäftigung mit der ethischen Fragestellung: Ist künstliche Befruchtung moralisch vertretbar?
Damit die Schüler lernen ihren eigenen Standpunkt zu vertreten, ist es unverzichtbar die Argumente für den Nutzen dieser Technologie kennen zu lernen (Argumentation des Nobelpreiskomitees), aber auch Risiken, Schwächen und Gefahren zu thematisieren (Argumentation der katholischen Kirche).
Dabei sollen Inhalte aus Informationsmedien (Zeitungen, Internet…) herangezogen werden, da diese Teil der gesellschaftlichen Realität sind und dem Schüler auch in seiner jetzigen und zukünftigen Lebenswelt begegnen.
Diese ethische Frage ist Teil der Lebenswirklichkeit und muss kontrovers erscheinen, auch wenn häufig Gegenpositionen zur säkularisierten „Leitlinie“ negiert werden.
Die ethische Rechtfertigung einer Sterilitätstherapie wird durch die Einstufung von Sterilität als behandlungsbedürftige Krankheit begründet (vgl. Merz 1991 S.57ff.): Kinderlosen Paaren soll das Leid der Kinderlosigkeit gemindert werden. Dies kann auch eine positive Wirkung auf Ehe und Familie haben (z.B.: Stärkung der Paarbeziehung; Sinnerfüllung; Erhaltung der Ehe; Förderung der familiären Solidarität…) und findet seine Rechtfertigung im Recht auf Selbstbestimmung (Recht auf Gründung einer Familie nach der Genfer Konvention (65), in Artikel 16. 1. der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen sowie nach der Europäischen Menschenrechtskonvention). Die problembehaftete Alternative Adoption (keine eigen „Fleisch und Blut“; Sterilität des Paares wird offenkundig) wird umgangen. Der Wunsch nach einem eigenen Kind wird als „fundamentales menschliches Urbedürfnis“ (Merz 1991. S.57) verstanden: „In ihm verbindet sich das biologisch verankerte Bedürfnis nach Arterhaltung mit dem menschlichen Streben nach individueller und partnerschaftlicher Entfaltung.“ (Merz 1991. S.57).
„In Deutschland sind zur Zeit ca. 850.000 Paare aufgrund der Sterilität, bzw. Unfruchtbarkeit der Partner kinderlos. Zur Überwindung dieses Zustandes bieten sich verschiedene Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung an, die trotz bescheidener Erfolge auch zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen gehören.“ (Günther 1996. S.1)
Die In-Vitro-Fertilisation findet die größte Anwendung und kann in homologe In-Vitro-Fertilisation (Ei- und Samenzellen eines miteinander verheirateten Paares werden verwendet), heterologe In-Vitro-Fertilisation (Partner sind verheiratet, die Frau wird mit dem Samen eines Dritten/Samenspenders befruchtet) und quasi-homologe In-Vitro-Fertilisation (entspricht der Zeugung eines Kindes in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft) unterschieden werden, wobei die Kinder durch die „echte“ Mutter oder einer Leihmutter ausgetragen werden können. (vgl. dazu: Günther 1996. S.1ff.; Hügel 1998. S.2ff.).
Die katholische Kirche nahm in der Verlautbarung des Apostolischen Stuhls „Instruktionen der Kongregation für die Glaubenslehre über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Lebens und die Würde der Fortpflanzung“ Stellung zur künstlichen Befruchtung beim Menschen. (vgl. dazu: Günther 1996. S.12. ff; Schlegel 2000. S.11ff.)
„Eine außerhalb des Leibes der Eheleute erlangte Befruchtung bleibt gerade deswegen der Sinngehalte und der Werte beraubt, die sich in Sprache des Leibes und der Vereinigung der menschlichen Personen ausdrücken.“ (Verlautbarungen. 1987. S.26) Auch trägt die In-Vitro-Fertilisation zur Vernichtung menschlichen Lebens bei (vgl. Verlautbarungen. 1987. S.26ff.)
Des Weiteren wird das Eingreifen eines Dritten (behandelnder Arzt) kritisiert:
„… sie vertraut das Leben und die Identität des Embryo der Macht der Mediziner und Biologen an und errichtet eine Herrschaft der Technik über Ursprung und Bestimmung der menschlichen Person. Eine derartige Beziehung von Beherrschung widerspricht in sich selbst der Würde und der Gleichheit die Eltern und Kindern gemeinsam sein muss…“ (Verlautbarungen. 1987. S.27)
„Obwohl die Technik der In-Vitro-Fertilisation im Grundsatz abgelehnt wird, herrscht doch gleichzeitig die Auffassung vor, dass man jedes Kind, das zur Welt kommt „…als lebendiges Geschenk der göttlichen Güte annehmen und mit Liebe aufziehen muss“ (Verlautbarungen. 1987. S.22). Letztendlich findet dadurch und durch die Aufforderung an den Arzt, im Rahmen seiner Tätigkeit bei der künstlichen Befruchtung sich seiner ethischen Verantwortung bewusst zu sein, eine faktische Billigung der homologen In-Vitro-Fertilisation statt.“ (Günther 1996. S.13).
Die In-Vitro-Fertilisation ist mit großen Risiken und unerwünschten Wirkungen verbunden (vgl. dazu: Hölzle 1991. S.16-26):
Bei der obligatorischen Hormonbehandlung kann es zur Zystenbildung mit pathologischer Vergrößerung der Eierstöcke kommen. Störungen des Wasser- und Elektrolythaushalts können sich einstellen. Dies führt zu Schmerzen im Bereich des Abdomens, in schweren Fällen kann sich Flüssigkeit im Bauch- und Brustraum sammeln. Auch thromboembolischen Komplikation mit Todesfolge konnten beobachtet werden.
Nach hormoneller Stimulation erhöht sich die Rate der Spontanaborte. Es besteht auch der Verdacht auf eine erhöhte Rate chromosomaler Anomalien.
Die bei der In-Vitro-Fertilisation notwendigen Ultraschalluntersuchungen könne aufgrund ihrer Häufigkeit zur Beschädigung von Chromosomen, Zellen und Gewebe führen.
Die Entnahme von Eizellen stellt einen operativen Eingriff dar und ist mit einem Operationsrisiko verbunden.
Beim Embryotransfer können als Komplikationen ebenfalls Verletzungen der Gebärmutterschleimhaut auftreten: Folgen davon sind Blutungen, Infektionen und Defektheilungen.
Während der Laborkultivierung besteht ebenfalls ein erhöhtes Infektionsrisiko.
Schwangerschaftsverlauf und Geburt bei In-Vitro-Fertilisations-Patientinnen verlaufen selten ohne Komplikationen (erhöhtes Abortrisiko; erhöhtes Risiko einer Eileiterschwangerschaft; erhöhtes „Risiko“ Zwillinge zu bekommen; häufig Gestosen (schwangerschaftsspezifische Erkrankung; erhebliche Gefährdung für schwangere Frau und Fötus); häufige Wachstumsretardierung; erhöhtes Risiko einer Frühgeburt…).
Merz äußert als ethische Bedenken gegen die Sterilitätstherapie, dass die Sterilität im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen einen sinnvollen Schutzmechanismus darstellt und der Kinderwunsch entsprechend genau analysiert werden müsse (Merz 1991. S. 61ff.). Auch stellt Leid einen Teil des Lebens dar und die Verarbeitung des Leids muss gegenüber einer simplen Umgehung des Leids Vorrang haben.
2.2. Elementare Erfahrungen
Die Vergabe des Nobelpreises wurde medial stark inszeniert und ist dem Schüler möglicherweise auf vielfältige Art begegnet (Zeitung, TV, Internet, Zeitschriften, Gespräche mit Eltern, Freunden, Verwandten…). Dabei ist es zunächst interessant und wichtig zu erfahren, welchen Standpunkt die Schüler vertreten, welche Argumentationen ihnen vertraut sind. Vorschnell werden solche existenziellen Fragestellungen (Wann beginnt Leben? Kann/Darf „lebenswertes“ und „lebensunwertes“ Leben unterschieden werden? ...) übergangen und ohne ausgiebige Analyse Urteile gefällt.
Das Thema Kind bzw. Kinderwunsch geht jedoch die gesamte Menschheit an.
[...]
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2010, Ethische Vertretbarkeit und künstliche Befruchtung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209622