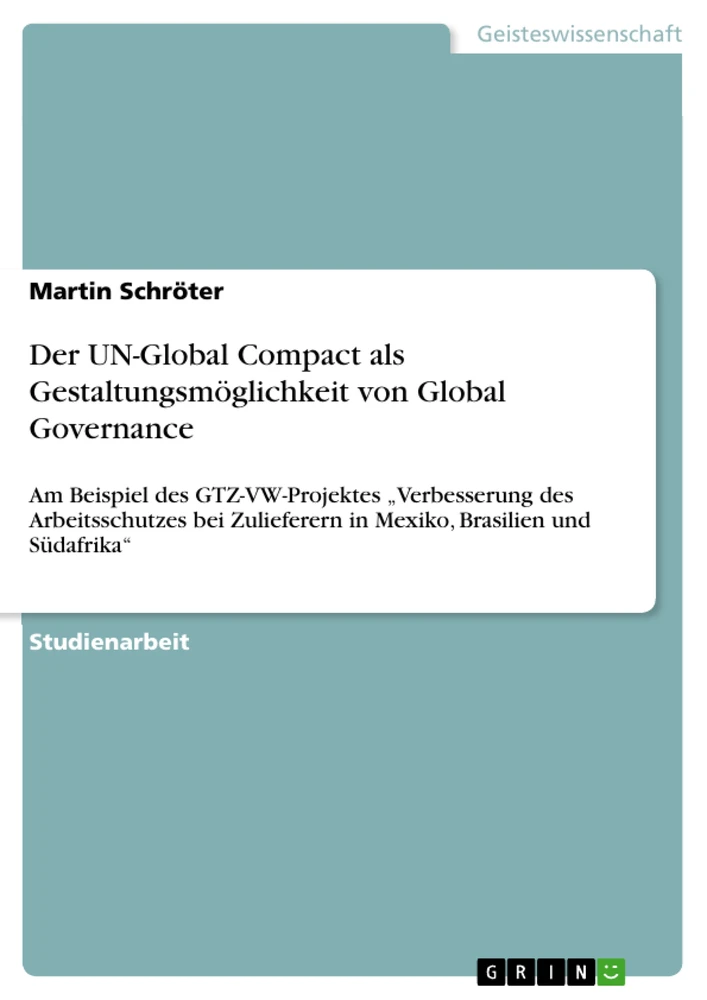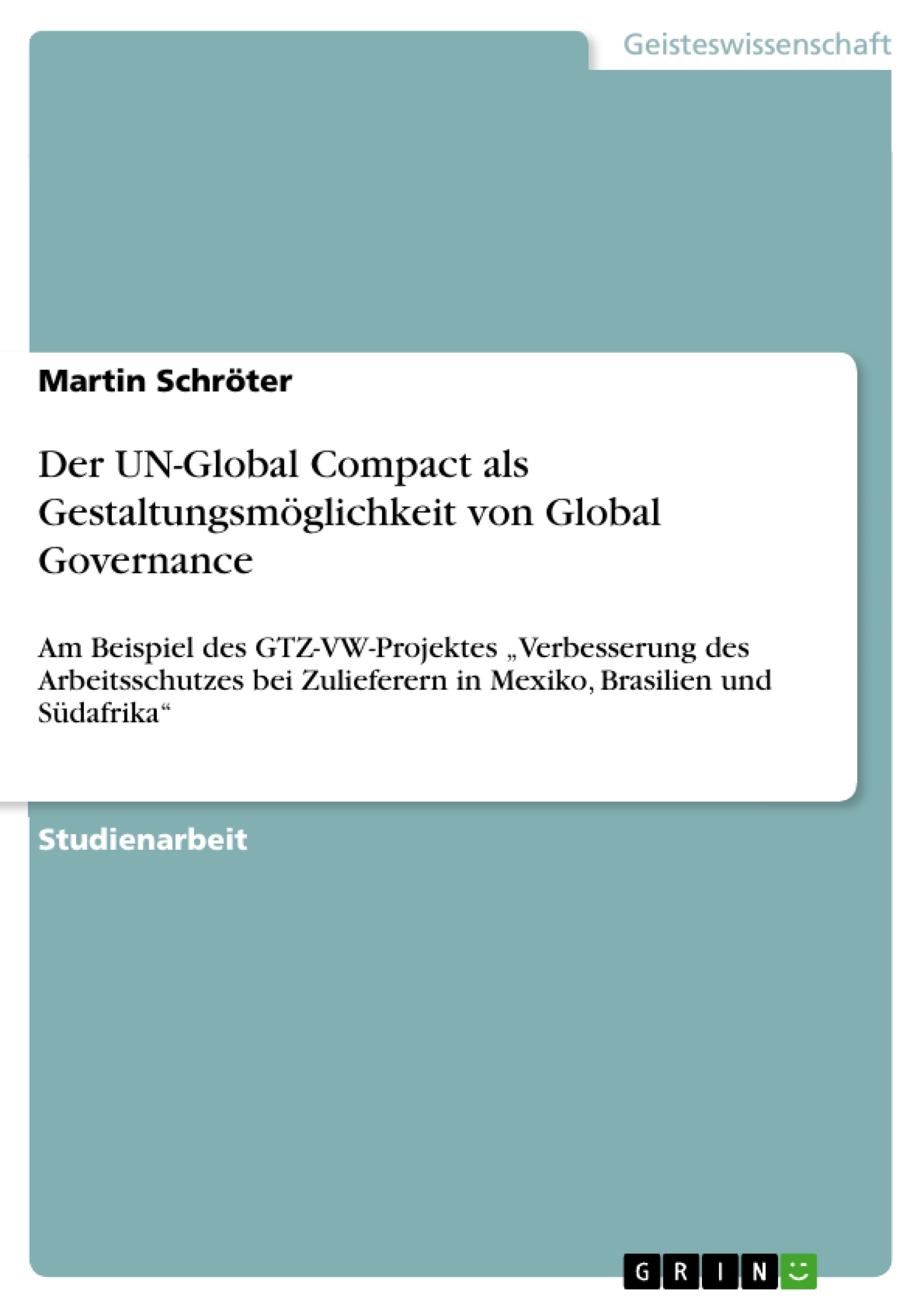Als Kofi Annan am 31. Januar 1999 auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos den „Global Compact“ ins Leben rief, schufen die Vereinten Nationen (UN) eine innovative Form von „Global Governance“, mit der sie erstmals Akteure aus der Wirtschaft darum warb, auf freiwilliger Basis und in Zusammenarbeit mit staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren Maßnahmen zu einer umfangreichen gesellschaftlichen Verantwortung zu ergreifen.
Annan richtete sich mit dem Global Compact insbesondere an multinationale Unternehmen (MNU), denen eine besondere Bedeutung für die Weltwirtschaft und damit verbunden eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung von Umweltschutz sowie Arbeits- und Sozialstandards zukommt.
Begreift man Global Governance als Gerüst gesellschaftlicher Selbstregulierung, an der nicht-staatliche Akteure wie Unternehmen, NGOs und Gewerkschaften beteiligt sind, so kann der UN-Global Compact als eine Form von Global Governance par excellence gedeutet werden.
Vor allem mithilfe so genannter Public-Private-Partnerships (PPP) soll es gelingen zur „Stärkung regulativer Kapazitäten in Entwicklungsländern“ (Beisheim/Fuhr 2008: 16) beizutragen, indem globale Governancestrukturen in regionale Kontexte implementiert werden. Gleichzeitig kommt dem Global Compact auch in Hinblick auf die Milleniumsentwicklungsziele der UN (englisch: Millenium Development Goals – MDGs) eine zentrale Rolle zu.
Am Beispiel einer Public-Private-Partnership im Rahmen des Global Compact zwischen dem Volkswagen Konzern (VW), der International Labour Organisation (ILO) und der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) soll im Folgenden die Durchsetzungsmöglichkeit des Global Compact als Gestaltungsmöglichkeit von Global Governance analysiert werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, in wie weit die gesellschaftliche Selbstregulierung des Global Compact zur Stärkung regulativer Kapazitäten in Entwicklungsländern beitragen kann. Die Frage ist daher auch in Zusammenhang mit der Frage nach der allgemeinen Effektivität und Legitimität des Global Compact als Gestaltungsform von Global Governance zu sehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung und Problemstellung: Global Governance und internationale Erwerbsregulierung
- Der Global Compact der Vereinten Nationen
- Das GTZ-VW-Projekt „Verbesserung des Arbeitsschutzes bei Zulieferern in Mexiko, Brasilien und Südafrika“
- Firmenprofil Volkswagen
- Hintergrund
- Durchführung
- Zentrale Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den UN-Global Compact als Gestaltungsmöglichkeit von Global Governance am Beispiel des GTZ-VW-Projektes „Verbesserung des Arbeitsschutzes bei Zulieferern in Mexiko, Brasilien und Südafrika". Dabei steht im Vordergrund, inwiefern die gesellschaftliche Selbstregulierung des Global Compact zur Stärkung regulativer Kapazitäten in Entwicklungsländern beitragen kann. Die Arbeit beleuchtet die Effektivität und Legitimität des Global Compact als Gestaltungsform von Global Governance.
- Global Governance und internationale Erwerbsregulierung
- Der UN-Global Compact und seine Rolle in der globalen Wirtschaft
- Public-Private-Partnerships im Rahmen des Global Compact
- Die Bedeutung des Global Compact für die Milleniumsentwicklungsziele der UN
- Die Stärkung regulativer Kapazitäten in Entwicklungsländern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Global Compact der Vereinten Nationen vor und erläutert seine Bedeutung als innovative Form von Global Governance. Sie fokussiert auf die Rolle multinationaler Unternehmen in der Weltwirtschaft und die damit verbundene Herausforderung der Durchsetzung von Umweltschutz sowie Arbeits- und Sozialstandards.
- Begriffsbestimmung und Problemstellung: Global Governance und internationale Erwerbsregulierung: Dieses Kapitel definiert den Begriff Global Governance und analysiert die Rolle nicht-staatlicher Akteure in der globalen Politikgestaltung. Es beleuchtet die Bedeutung multinationaler Unternehmen als treibende Kraft der Globalisierung und den Legitimationsdruck, der auf sie in Bezug auf die Verantwortungsübernahme für ihre Geschäftstätigkeiten lastet.
- Der Global Compact der Vereinten Nationen: Das Kapitel beschreibt den Global Compact der UN als eine Multi-Stakeholder-Initiative zur Förderung gesellschaftlicher Selbstregulierung. Es stellt die Kritik und Problematiken des Global Compact dar und analysiert seine Rolle in der Gestaltung von Global Governance.
- Das GTZ-VW-Projekt „Verbesserung des Arbeitsschutzes bei Zulieferern in Mexiko, Brasilien und Südafrika“: Dieses Kapitel präsentiert das Kooperationsprojekt zwischen Volkswagen, der International Labour Organisation und der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ). Es stellt den VW-Konzern vor, beleuchtet die Hintergründe des Projekts und gibt einen Überblick über die Durchführung des Projekts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Global Governance, UN-Global Compact, Public-Private-Partnerships, gesellschaftliche Selbstregulierung, internationale Erwerbsregulierung, multinationale Unternehmen, Arbeits- und Sozialstandards, Entwicklungsländer, Milleniumsentwicklungsziele und die Stärkung regulativer Kapazitäten.
- Quote paper
- Martin Schröter (Author), 2011, Der UN-Global Compact als Gestaltungsmöglichkeit von Global Governance, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209605