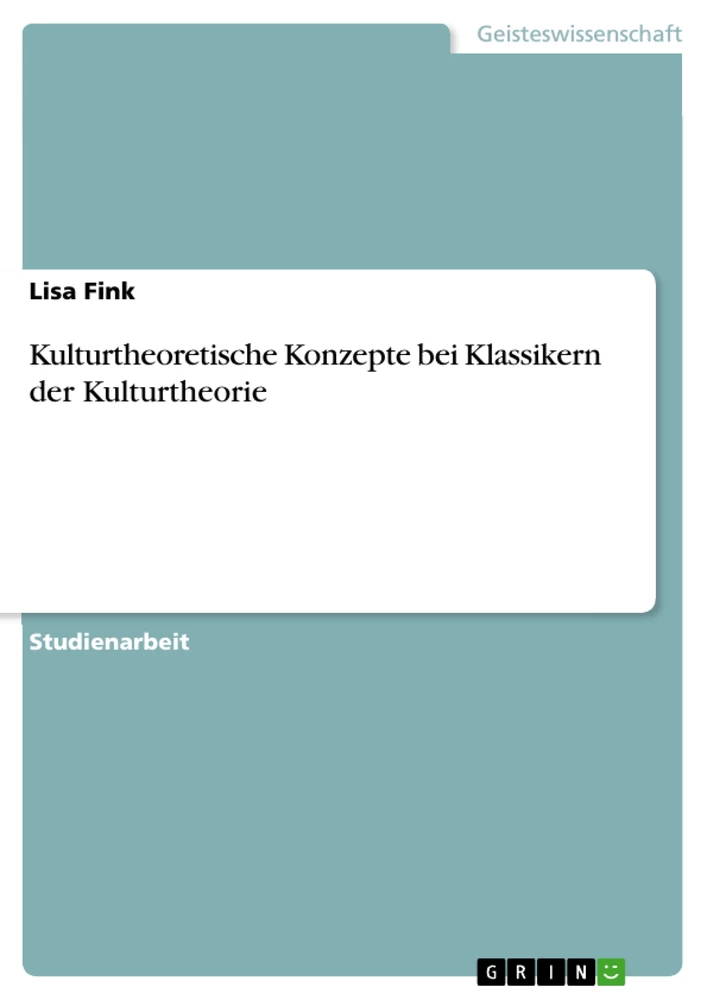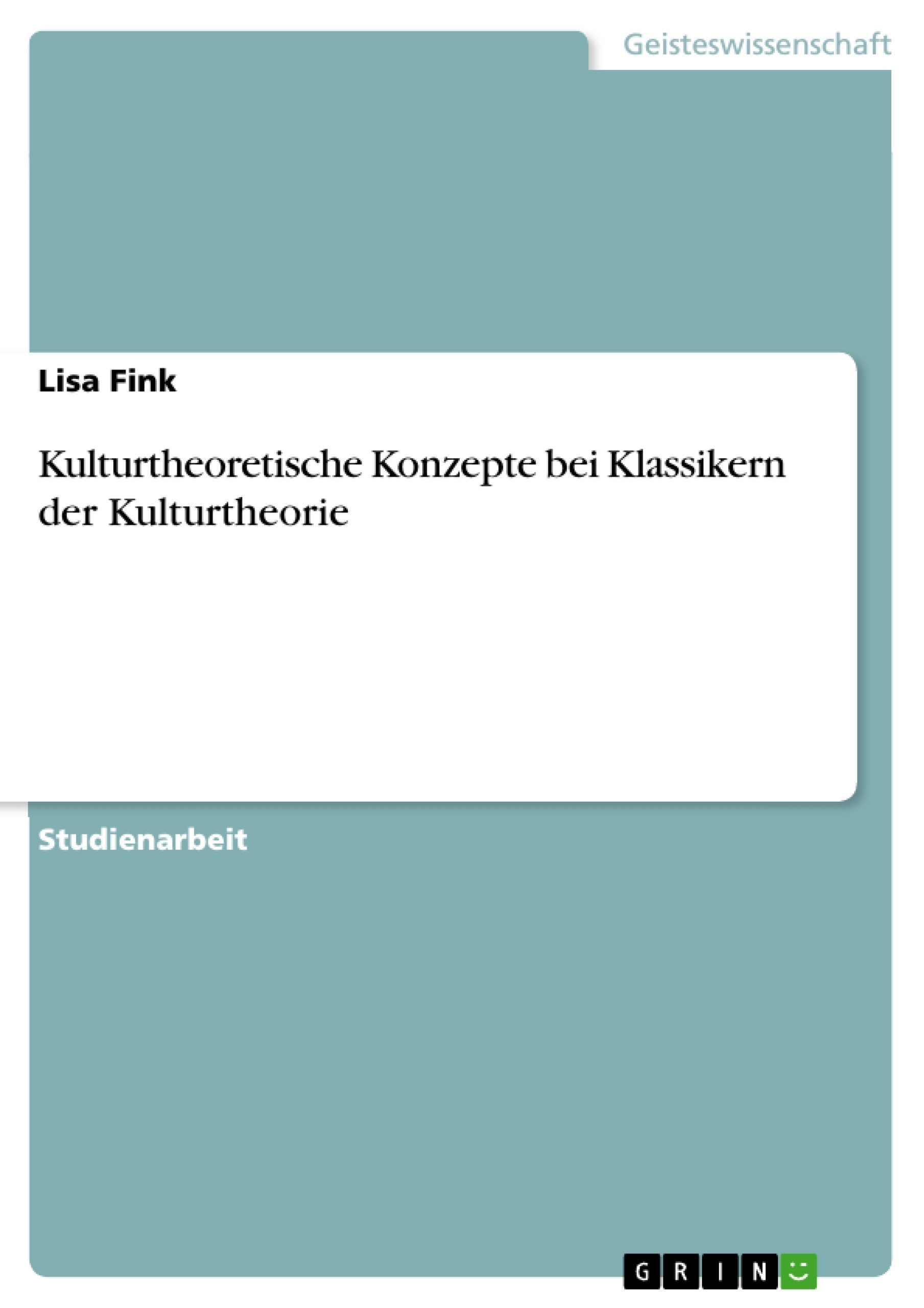Die Beschäftigung mit der Frage „Was ist Kultur“ kann wohl kein Student eines Kulturwissenschaftlichen Faches umgehen. Ebenso unumgänglich sind Kulturtheorien verschiedenster Art, die sich mit Aspekten und Phänomenen einer Kultur auseinandersetzen, sie in ihrem Kontext analysieren und nach Erklärungen dafür suchen. Die behandelten Themen können dabei - wie die Kultur selbst - sehr komplex und vielseitig sein.
Im Folgenden sollen, nach einer kurzen Definition des Begriffs „Kulturtheorie“, drei unterschiedliche Beispiele klassischer Kulturtheorien zu bestimmten kulturellen Themen inhaltlich knapp dargestellt werden.
Auf eine Diskussion über die Definition von „Kultur“, sowie auf eine ausführliche Auseinandersetzung mit den genannten Kulturtheorien, muss auf Grund der beschränkten Kapazität eines Seminaraufsatzes an dieser Stelle verzichtet werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Begriff „Kulturtheorie“
3. Klassische Beispiele für Kulturtheorien
3.1 Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit
3.2 Klassifikationsgitter und Gruppe
3.3 Verhält sich männlich zu weiblich wie Natur zu Kultur?
4. Schlusswort
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Beschäftigung mit der Frage „Was ist Kultur“ kann wohl kein Student eines Kulturwissenschaftlichen Faches umgehen. Ebenso unumgänglich sind Kulturtheorien verschiedenster Art, die sich mit Aspekten und Phänomenen einer Kultur auseinandersetzen, sie in ihrem Kontext analysieren und nach Erklärungen dafür suchen. Die behandelten Themen können dabei - wie die Kultur selbst - sehr komplex und vielseitig sein.
Im Folgenden sollen, nach einer kurzen Definition des Begriffs „Kulturtheorie“, drei unterschiedliche Beispiele klassischer Kulturtheorien zu bestimmten kulturellen Themen inhaltlich knapp dargestellt werden.
Auf eine Diskussion über die Definition von „Kultur“, sowie auf eine ausführliche Auseinandersetzung mit den genannten Kulturtheorien, muss auf Grund der beschränkten Kapazität eines Seminaraufsatzes an dieser Stelle verzichtet werden.
2. Der Begriff „Kulturtheorie“
Ehe man sich mit der bewussten Lektüre klassischer Kulturtheorien beschäftigt, sollte zunächst einmal der Begriff der „Kulturtheorien“ näher betrachtet werden.
So versteht man unter einer Kulturtheorie allgemein eine Theorie, die „aus unterschiedlichen theoretischen und disziplinären Perspektiven Erklärungsangebote sowohl für den Wirkungszusammenhang von Kultur und Gesellschaft, als auch für Kultur als einen mehr oder weniger eigenständigen Phänomenbereich bieten“. Sie sind dabei Teil kulturtheoretischer Felder, deren zentrale Gemeinsamkeit in einem wachsenden Interesse für die kulturellen Dimensionen des Sozialen besteht.
Kulturtheorien gehen davon aus, dass die Welt für den Menschen nur insofern existiert, „als ihr auf der Grundlage von symbolischen Ordnungen Bedeutungen zugeschrieben und sie damit gewissermaßen erst sinnhaft produziert wird“. Entscheidend ist demnach nicht so sehr, Sinn primär auf der Ebene von Zwecken und Normen anzusiedeln, da diese hier vielmehr als abgeleitete Phänomene erscheinen.[1]
3. Klassische Beispiele für Kulturtheorien
3.1 Die gesellschaftliche Konstruktion derWirklichkeit
Da der Mensch mit keinem entwickelten Instinktapparat ausgestattet ist, nimmt er eine besondere Rolle im Reich der Tiere ein. Durch seine fehlende Sicherheit und seine unspezia- lisierte Ausrichtung bietet sich ihm jedoch ein breites Spektrum , in dem er seine naturgegebenen Fähigkeiten anwenden kann, wobei er die fehlende natürliche Umwelt durch eine künstliche Welt, die er durch sein Verhalten erst erschafft, ersetzt. Er prägt seine Umwelt und wird wiederum von dieser geprägt, wobei hier - neben der natürlichen - insbesondere seine kulturelle Umwelt gemeint ist (Berger/Luckmann 1969, S.51ff.). Kultur wird somit zu einer zweiten Natur des weltoffenen Menschen (Vgl. Schnettler 2006, S. 173).
Doch wie konstruiert der Mensch nun seine gesellschaftliche Wirklichkeit? Nach Berger und Luckmann sieht sich der Mensch in jedem Augenblick des Lebens, als Ausgleich seines Mängelwesens, dazu gezwungen, zu handeln und wirkt somit in die Welt hinein. Jegliche daraus entstehenden Produkte haben für den Menschen wiederum eigenständige Faktizität und wirken ihrerseits auf das Individuum zurück (Vgl. Schnettler 2006, S.173). Bei dem Phänomen, dass alle Verhaltensweisen des Menschen, seine verbale und nonverbale Kommunikation, sein Wissen und sein subjektiv gemeinter Sinn stets entäußert werden, spricht man von Externalisierung.
Jede Handlung des Menschen, die dabei öfter wiederholt wird, verfestigt sich im Laufe der Zeit zur Gewohnheit, bzw. zur Routine. Bei diesem Phänomen handelt es sich um die Ha- bitualisierung, durch die der Mensch von eigenen Entscheidungen entlastet wird und somit offen für Erneuerungen ist (Vgl. Berger/Luckmann 1969, S.57ff.).
Wenn mehrere Akteure eines bestimmten Typus auf eine jeweils typische Art und Weise handeln, das Verhalten daher wiedererkannt und vom Individuum nachvollzogen werden kann, spricht man von Typisierung. Jedes Individuum spielt demnach seine ihm zugewiesene typische Rolle.
Habitualisierung lebt demnach auch von der Notwendigkeit, gewisse Verhaltensweisen stets wieder neu kreieren zu müssen. Bei wechselseitigen sozialen Handlungen entwickeln sich, durch die Typisierung, automatisch Erwartungszwänge bei den Beteiligten, die Handlungsverpflichtungen mit sich bringen, mit deren Hilfe einmal gefundene Problemlösungen für bestimmte Handlungsprobleme verfestigt werden (Vgl. Schnettler 2006, S.174). Die Habitualisierung geht der Institutionalisierung voraus, da man von Institutionalisierung spricht, wenn routinisierte Verhaltensweisen normiert und in einen gemeinsamen Handlungsrahmen gesetzt werden und, wenn sie begründet werden, als Allgemeingut gelten. Eine institutionalisierte Welt wird von den Individuen also als objektive Wirklichkeit erlebt (Vgl. Berger/Luckmann 1969, S.64).
Von Objektivation wird gesprochen, wenn diese Institutionen an Dritte, etwa die nächste Generation, weitergegeben werden, sich selbst verwirklichen und somit vergegenständlicht werden.
Für die nachfolgenden Generationen bedarf es jedoch der Legitimation, um nachvollziehbar zu sein. Diese erfolgt dabei durch die Erfahrungen der Individuen mit der sozialen Wirklichkeit. Da diese Allgemeingut und somit gemeinsame Wirklichkeit ist, kommt es zur institutionalen Integration. Wenn es um die Institutionalisierung gesellschaftlichen Handelns geht, reichen rein subjektive Bedeutungen nicht aus, vielmehr werden lediglich regelmäßig wiederholte wechselseitige und als selbstverständlich angesehene gesellschaftliche Handlungen institutionalisiert (Vgl. Berger/Luckmann 1969, S.65ff.).
Internalisierung meint dabei, dass zunächst subjektiv gemeinte Wirklichkeit mittlerweile zur objektiven Wirklichkeit geworden ist, die vom Individuum wiederum, im Laufe der Sozialisation, als solch objektive Wahrheit einverleibt wird. Bizarr ist dabei, dass der Mensch das, was er im Grunde selbst produziert hat, als selbstverständlich und unveränderlich ansieht und seine menschliche Welt nicht als menschliches Produkt ansieht.
Dass es im Laufe der Menschheitsgeschichte dennoch immer wieder zu Wandel und Fortschritt kommt, begründen Luckmann und Berger damit, dass der Mensch nur einen Teil seiner gemachten Erfahrungen, die sogenannten Sedimente, im Bewusstsein bewahren kann. Auf diese Weise werden die abgelagerten Erfahrungen der Gesellschaft im Laufe der Zeit stets mit neuen Erfahrungen angereichert und es kommt nicht zum kulturellen Stillstand.
Quellen:
-Berger,Peter L./Thomas Luckmann (1969), Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt am Main: Fischer
-Schnettler, Bernt (2006), Thomas Luckmann: Kultur zwischen Konstitution, Konstruktion und Kommunikation, in: Stephan Moebius/Dirk Quadflieg (Hg.), Kulturtheorien der Gegenwart - Heterotopien der Theorie, Wiesbaden: VS, S. 170-184.
[...]
[1] Kimmich, Dorothee/ Schahadat, Schamma/ Hauschild, Thomas (Hg.) 2010: Kulturtheorie. Bielefeld: Transcript Verlag, S.10
- Quote paper
- Lisa Fink (Author), 2013, Kulturtheoretische Konzepte bei Klassikern der Kulturtheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209553