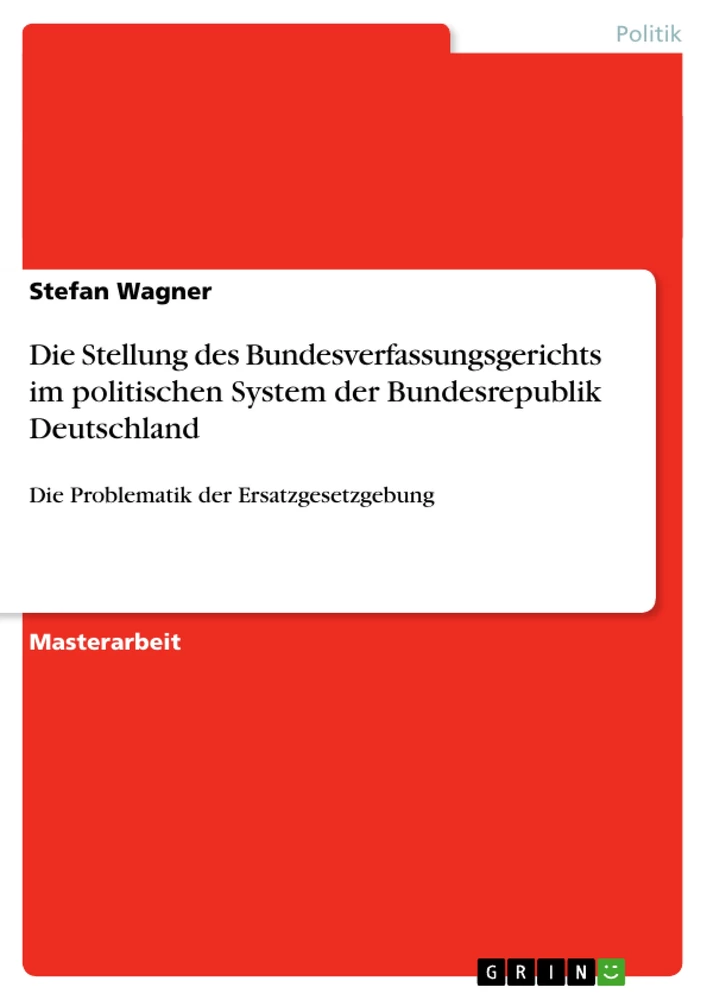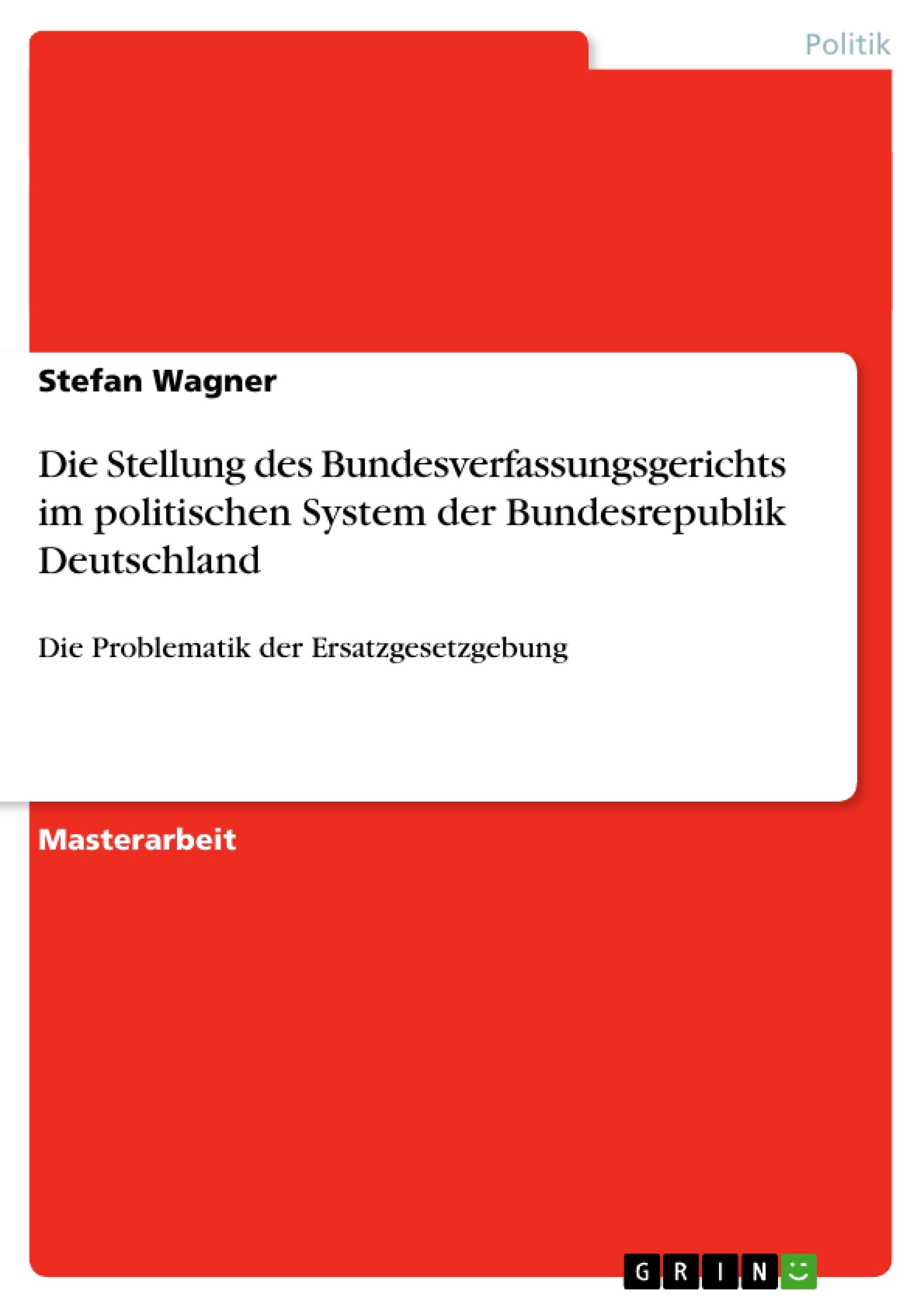Das Bundesverfassungsgericht ist die höchstrangige Institution der rechtsprechenden Gewalt der Bundesrepublik Deutschland. Es ist der sogenannte Hüter der Verfassung – also des Grundgesetzes – und kontrolliert die Verfassungsmäßigkeit des politischen Lebens. Dabei gehört es nicht dem Instanzenzug an, was bedeutet, dass es keine vollständige Rechtsprüfung ausübt, sondern es überprüft Entscheidungen anderer Gerichte und sonstige Anträge als Akte der Staatsgewalt am Maßstab des Verfassungsrechts. Das Grundgesetz stellt also die oberste Richtschnur dar, anhand derer sämtliches staatliches Handeln interpretiert und gemessen wird. In seinem nunmehr über 60 Jahre andauernden Bestehen, war und ist das Bundesverfassungsgericht stets die Institution, die tonangebend in der Auslegung des Grundgesetzes war und diesem Aufmerksamkeit und Respekt verschaffte. „Insbesondere seine Rechtsprechung zu den Grundrechten hat bewirkt, dass das Grundgesetz konkrete Gestalt gewonnen und in der politischen Kultur Deutschlands verwurzelt ist.“
Das Parlament, die Regierung und auch die übrige Rechtsprechung sind in ihrem Handeln an die Verfassung gebunden und das Bundesverfassungsgericht überwacht diese Verfassungsmäßigkeit. „Es kann das Parlament in die Schranken der Verfassung weisen und dessen Gesetze für nichtig erklären, wenn und soweit sie mit dem Grundgesetz unvereinbar sind.“
...
Die Arbeit soll sich deshalb dem Thema der besonderen Stellung des Bundesverfassungsgerichts im Gesamtgefüge der deutschen Staatsorgane widmen sowie identifizierbare Probleme nennen, und untersuchen, worauf diese Stellung gegründet ist, welches Verhältnis der Organe untereinander dadurch entsteht und wie insgesamt mit der Gefahr eines Ersatzgesetzgebers „Bundesverfassungsgericht“ umgegangen werden kann und wird. Auch sollen die Grenzen zwischen Rechtsprechung und Politik thematisiert werden, welche stets und ständig ein die Verfassungsgerichtsbarkeit begleitendes Thema darstellen, welches dahingehend Fragen aufwirft, ob das Gericht sich allmählich über die Politik und den Gesetzgeber erhebt, oder ob dem Gericht seitens des Gesetzgebers mehr und mehr Aufgaben zugespielt werden, die dessen eigentlich vorgesehenen Kompetenzbereich beständig erweitern.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlegendes zum Bundesverfassungsgericht
- 2.1 Die Entstehung des Bundesverfassungsgerichts
- 2.1.1 Die Arbeit des Parlamentarischen Rates
- 2.1.2 Das Bundesverfassungsgericht - eine (deutsche) Institution sui generis
- 2.1.3 Die Konstitution des Bundesverfassungsgerichts
- 2.2 Der organisatorische Aufbau des Bundesverfassungsgerichts
- 2.2.1 Die Richter des Bundesverfassungsgerichts und ihre Wahl
- 2.2.2 Die Kritik der Richterwahl
- 2.3 Die Aufgabenbereiche des Bundesverfassungsgerichts
- 2.1 Die Entstehung des Bundesverfassungsgerichts
- 3 Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im politischen System der Bundesrepublik Deutschland
- 3.1 Das Bundesverfassungsgericht – Gericht & Verfassungsorgan
- 3.2 Die Interpretation der Verfassung
- 3.2.1 Der souveräne Deuter
- 3.2.2 Die Bindungswirkung der Urteile
- 3.3 Das Bundesverfassungsgericht als Akteur der Grauzone zwischen Politik und Recht
- 3.4 Zwischenfazit zur Stellung des Bundesverfassungsgerichts im politischen System der Bundesrepublik Deutschland
- 4 Thesenbereich I: Das Bundesverfassungsgericht als politisch mächtiger Akteur mit Tendenz zur Ersatzgesetzgeberschaft
- 4.1 Einleitung – Das Verhältnis zum Gesetzgeber
- 4.2 These I 1. Macht durch Kontrolle
- 4.3 These I 2. Macht durch Mitgestaltung
- 4.4 These I 3. Macht durch Deutung
- 4.5 These I 4. Macht durch Minderheitenschutz
- 4.6 These I 5. Macht durch Normverwerfung
- 4.7 Fazit Das Verhältnis zum Gesetzgeber
- 5 Thesenbereich II: Die Relativierung der Macht
- 5.1 Einleitung – Die Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit
- 5.2 These II 1. Machtbegrenzung durch Antragspflicht
- 5.3 These II 2. Machtbegrenzung durch fehlende Gestaltungsmöglichkeiten
- 5.4 These II 3. Machtbegrenzung durch judicial self-restraint
- 5.5 These II 4. Machtbegrenzung durch fehlende Sanktionsmöglichkeiten
- 5.6 These II 5. Notkompetenz und geliehene Macht
- 5.7 These II 6. Ein negativer Legislateur ist unmöglich
- 5.8 Fazit - Die Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im deutschen politischen System, insbesondere die Problematik der Ersatzgesetzgebung. Ziel ist es, die Macht des Gerichts zu analysieren und die Grenzen seiner Befugnisse zu definieren.
- Entstehung und organisatorischer Aufbau des Bundesverfassungsgerichts
- Die Rolle des Gerichts als Hüter der Verfassung und Interpret des Grundgesetzes
- Das Verhältnis zwischen dem Bundesverfassungsgericht und anderen Staatsorganen (Parlament, Regierung)
- Die Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit und die Gefahr der Ersatzgesetzgebung
- Die Legitimation und Kritik an der Richterwahl
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt das Bundesverfassungsgericht als oberste Instanz der rechtsprechenden Gewalt vor und hebt seine Rolle als Hüter der Verfassung hervor. Sie betont die Bedeutung der Verfassungsinterpretation durch das Gericht und die Notwendigkeit einer starken Verfassungsgerichtsbarkeit im Lichte der deutschen Geschichte. Die Arbeit untersucht die besondere Stellung des Gerichts und die damit verbundenen Herausforderungen, insbesondere die Gefahr der Ersatzgesetzgebung.
2 Grundlegendes zum Bundesverfassungsgericht: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Bundesverfassungsgerichts, seinen organisatorischen Aufbau, die Wahl der Richter und die damit verbundene Kritik, sowie die Aufgabenbereiche des Gerichts. Es legt den Grundstein für das Verständnis der Institution und ihrer Funktionsweise im deutschen politischen System.
3 Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im politischen System der Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die zentrale Rolle des Bundesverfassungsgerichts als Gericht und Verfassungsorgan. Es untersucht die Interpretation der Verfassung durch das Gericht, die Bindungswirkung seiner Urteile und seine Position in der Grauzone zwischen Politik und Recht. Die Diskussion über die Macht des Gerichts und die potenziellen Konflikte mit anderen Staatsorganen steht im Mittelpunkt.
4 Thesenbereich I: Das Bundesverfassungsgericht als politisch mächtiger Akteur mit Tendenz zur Ersatzgesetzgeberschaft: Dieser Abschnitt untersucht die Macht des Bundesverfassungsgerichts aus verschiedenen Perspektiven: durch Kontrolle, Mitgestaltung, Deutung, Minderheitenschutz und Normverwerfung. Er beleuchtet die Argumente, die die These von der Ersatzgesetzgebung unterstützen.
5 Thesenbereich II: Die Relativierung der Macht: Im Gegensatz zu Kapitel 4, konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Grenzen der Macht des Bundesverfassungsgerichts. Er beleuchtet die Machtbegrenzungen durch Antragspflicht, fehlende Gestaltungsmöglichkeiten, judicial self-restraint, fehlende Sanktionsmöglichkeiten, Notkompetenz und die Unmöglichkeit eines negativen Gesetzgebers. Es wird argumentiert, dass die Macht des Gerichts nicht uneingeschränkt ist.
Schlüsselwörter
Bundesverfassungsgericht, Grundgesetz, Verfassungsgerichtsbarkeit, Gewaltenteilung, Ersatzgesetzgebung, Verfassungsinterpretation, Richterwahl, Rechtsprechung, Politik, Macht des Gerichts, Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, demokratische Legitimation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im deutschen politischen System
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Stellung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) im deutschen politischen System mit besonderem Fokus auf die Problematik der Ersatzgesetzgebung. Sie untersucht die Macht des Gerichts und definiert die Grenzen seiner Befugnisse.
Welche Aspekte des Bundesverfassungsgerichts werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und den organisatorischen Aufbau des BVerfG, seine Rolle als Hüter der Verfassung und Interpret des Grundgesetzes, das Verhältnis zu anderen Staatsorganen (Parlament, Regierung), die Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit und die Gefahr der Ersatzgesetzgebung sowie die Legitimation und Kritik an der Richterwahl.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen des BVerfG, ein Kapitel zur Stellung des Gerichts im politischen System, einen Thesenbereich zur Macht des Gerichts als politischer Akteur mit Tendenz zur Ersatzgesetzgebung und einen Thesenbereich zur Relativierung dieser Macht durch Betrachtung der Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, sowie eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird detailliert zusammengefasst.
Welche These wird im ersten Thesenbereich vertreten?
Der erste Thesenbereich argumentiert, dass das Bundesverfassungsgericht ein politisch mächtiger Akteur ist und Tendenzen zur Ersatzgesetzgebung aufweist. Diese Macht wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet: durch Kontrolle, Mitgestaltung, Deutung, Minderheitenschutz und Normverwerfung.
Welche These wird im zweiten Thesenbereich vertreten?
Der zweite Thesenbereich relativiert die These des ersten Teils und konzentriert sich auf die Grenzen der Macht des BVerfG. Hier werden Machtbegrenzungen durch Antragspflicht, fehlende Gestaltungsmöglichkeiten, "judicial self-restraint", fehlende Sanktionsmöglichkeiten, Notkompetenz und die Unmöglichkeit eines negativen Gesetzgebers diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bundesverfassungsgericht, Grundgesetz, Verfassungsgerichtsbarkeit, Gewaltenteilung, Ersatzgesetzgebung, Verfassungsinterpretation, Richterwahl, Rechtsprechung, Politik, Macht des Gerichts, Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, demokratische Legitimation.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen für jedes Kapitel, beginnend mit der Einleitung über die Grundlagen des BVerfG und dessen Stellung im politischen System bis hin zu den beiden Thesenbereichen zur Macht und deren Grenzen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Analyse der Macht des Bundesverfassungsgerichts und die Definition der Grenzen seiner Befugnisse, insbesondere im Hinblick auf die Problematik der Ersatzgesetzgebung.
- Quote paper
- Master of Arts Stefan Wagner (Author), 2012, Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209431