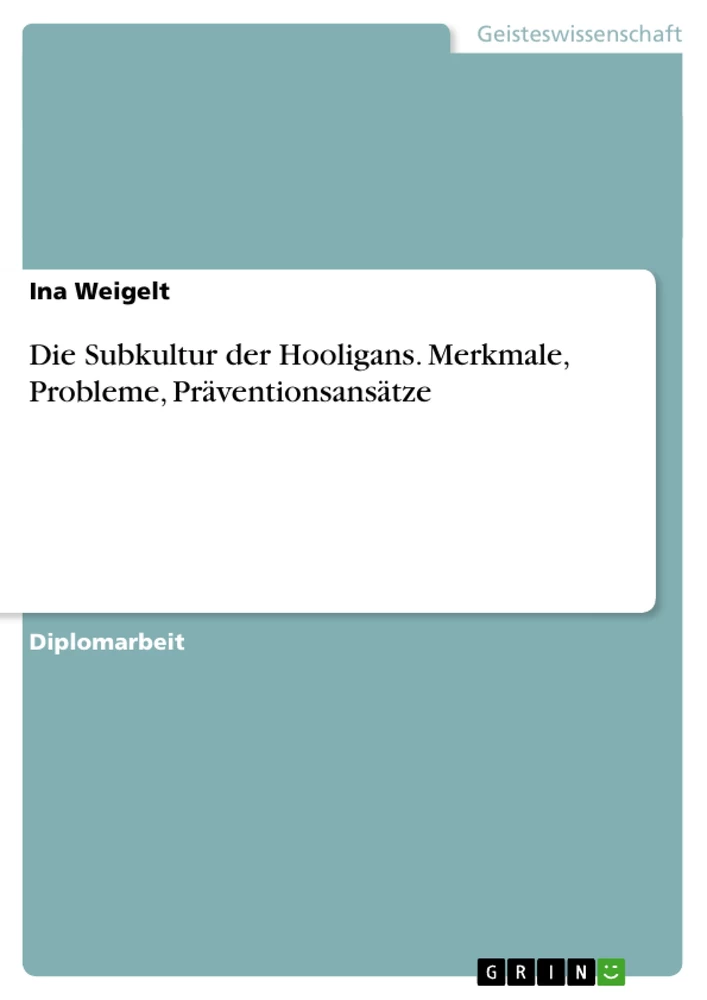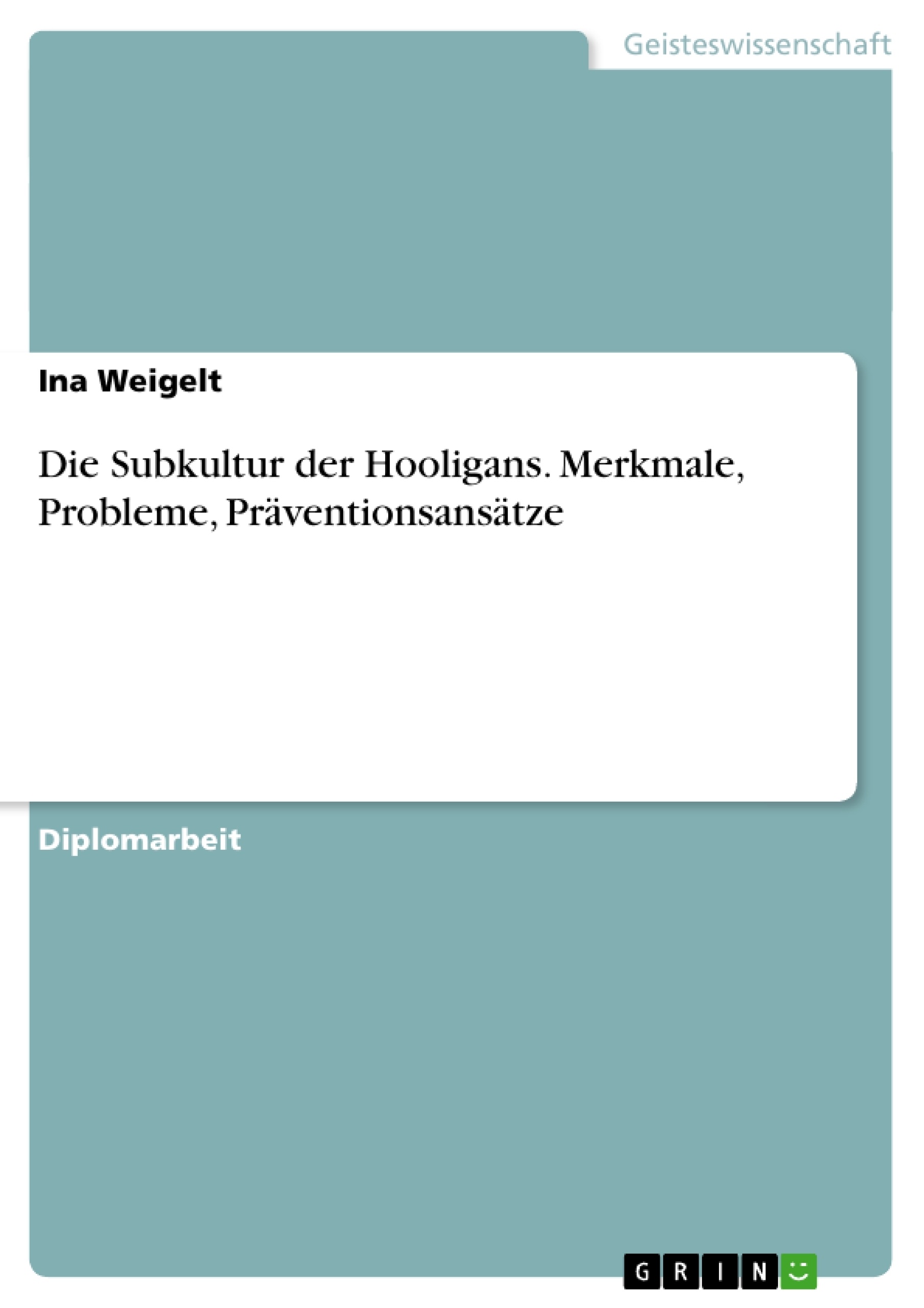Spätestens seit den Ereignissen in Lens (zur Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich 1998) dürfte ein Großteil der deutschen Bevölkerung wissen, was Hooligans sind: brutale Schläger, zurückgebliebene Jugendliche mit schlechter Kindheit, Neonazis und vor allem keine richtigen Fußballfans. Da sind sich vor allem die Offiziellen (von den Vereinen, vom
DFB etc.) einig. Dass dieses Raster nicht so einfach über die gewaltbereiten Jugendlichen und jungen Männer gelegt werden kann, will ich mit dieser Arbeit richtig stellen. Ich will die Subkultur der Hooligans gründlich analysieren, um dabei die Vorurteile von den wirklichen empirisch nachgewiesenen Gegebenheiten zu trennen.
Aus dieser Zielsetzung heraus lag dementsprechend das Hauptaugenmerk meiner Arbeit auf dem ersten Teil, in welchem ich versuchte, die besonderen Spezifika der Subkultur herauszufiltern. Dafür notwendig waren anfangs die klare Abgrenzung der Begriffe und die Erklärungen über die Geschichte des Hooliganismus, die auch die heutige Differenzierung der (deutschen) Fußballfanszene begründet. Nicht zuletzt sollten innerdeutsche Unterschiede dabei herausgearbeitet werden. Nach diesen
Vorüberlegungen und Differenzierungen habe ich mich der Ursachenanalyse zugewandt.
Schnell habe ich festgestellt, dass es nicht die Ursache für jugendliches Gewalthandeln
gibt, deshalb war es notwendig mehrere (theoretische wie praktische) Ansätze zu erläutern. Schließlich habe ich mich den spezifischen Merkmalen und Verhaltensweisen der Hooligans gewidmet. Auch hier war es nicht mein Ziel, ein bestimmtes Raster
anzulegen, nach dem Hooligans „erkannt“ und „entlarvt“ werden können, vielmehr war es mein Anliegen zu zeigen, wie viele Facetten diese Subkultur hat und wo Affinitäten zu anderen Jugend(sub)kulturen zu finden sind.
Im zweiten Teil meiner Arbeit habe ich besondere Probleme – Hooligans würden vielleicht eher sagen: Aspekte – der Hooliganszene vorgetragen, die im ersten Teil noch nicht mit zum Ausdruck kamen. So werden die politischen Orientierungen der Hools, die Rolle der Medien, das Problem Länderspiele, die deutsch-holländischen Hooligan- und Fanbeziehungen und die Rolle der Frauen in der Szene aufgegriffen, um das Bild der Hooligans und ihrer Umstände zu verfeinern. Im letzten Teil schließlich beschäftige ich mich mit den Präventionsmaßnahmen. Prävention wird von allen Instanzen, die sich mit „Hooliganbekämpfung“ beschäftigen, groß geschrieben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Merkmale
- 2.1 Begriffsklärungen
- 2.1.1 Hooligan / Hooliganismus
- 2.1.2 Devianz / Gewalt
- 2.1.3 Subkultur
- 2.2 Geschichte des Hooliganismus
- 2.2.1 Geschichte von Krawallen bei sportlichen Großveranstaltungen, insbesondere bei Fußballspielen
- 2.2.2 Ausdifferenzierung der Fan-Szene
- 2.2.2.1 „Neckermänner“
- 2.2.2.2 „Kutten“
- 2.2.2.3 „Hools“
- 2.2.3 Entwicklung des Hooliganismus in der DDR und in den neuen Bundesländern
- 2.2.4 Ost-West-Vergleich der heutigen Hooligan-Szene
- 2.2.5 Neuere Entwicklungen
- 2.3 Ursachen von Zuschauerausschreitungen und Hooliganismus
- 2.3.1 Die Entwertungsthese (nach Heitmeyer) – Individualisierung und ihre Folgen
- 2.3.2 „Gewalt macht Spaß“ – Die Frage nach dem Warum
- 2.3.3 Massenbewegungen und Gruppenverhalten
- 2.3.4 Gewalt bei den Fußballspielern
- 2.3.5 Die Rolle des DFB, der Vereine und die zunehmende Kommerzialisierung und Professionalisierung des Profi-Fußballs
- 2.3.6 Aggressor in Grün – Die Polizei als „3. Mob“
- 2.4 Spezifische Merkmale und Verhaltensweisen der Hooligansubkultur
- 2.4.1 Identifikation mit dem Verein
- 2.4.2 Äußerliche Erscheinung
- 2.4.3 Hierarchisierung („Gute“, Mitläufer, „Lutscher“)
- 2.4.4 Ehrenkodex
- 2.4.5 Alkohol- und Drogenkonsum
- 2.4.6 Visualisierungen (Fanzines, Transparente, Aufkleber, Comics etc.)
- 2.4.7 Exkurs: Ultras – eine Abgrenzung
- 2.4.8 Solidarität und Anerkennung
- 2.4.9 Männlichkeit und Körperlichkeit
- 2.4.10 Freund- und Feindschaften
- 2.4.11 Provokation als wichtigstes „Instrument“ der Hooligans
- 2.4.12 Der Ablauf eines Hooligan-„Spieltags“
- 2.1 Begriffsklärungen
- 3 Ausgewählte Probleme
- 3.1 Politisierung der Hooligan-Szene – „rechte“ und „linke“ Gewalt
- 3.2 Die Rolle der Medien bei der Gewaltentstehung
- 3.3 Besonderes Problem: Länderspiele
- 3.4 Auf gute Feindschaft: Das deutsch-holländische (Fußball-)Verhältnis
- 3.5 Frauen in der Fußballfan- und Hooliganszene
- 4 Prävention von gewalttätigem Zuschauerverhalten
- 4.1 durch die Sozialarbeit
- 4.1.1 Fan-Projekte
- 4.1.2 Akzeptierende Jugendsozialarbeit nach Krafeld
- 4.1.3 Sportsozialarbeit
- 4.2 durch die Polizei
- 4.3 durch Stadienordnung und -architektur
- 4.4 durch die Ordner
- 4.5 durch die Vereine/den DFB
- 4.1 durch die Sozialarbeit
- 5 Persönliches Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Hooligansubkultur in Deutschland. Ziel ist es, Vorurteile zu entkräften und ein differenziertes Bild dieser Jugendkultur zu zeichnen, indem empirische Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse ausgewertet werden. Die Arbeit untersucht die Geschichte des Hooliganismus, die Ursachen gewalttätigen Verhaltens, spezifische Merkmale der Subkultur, und schließlich Präventionsmaßnahmen.
- Entwicklung und Geschichte des Hooliganismus in Deutschland
- Ursachen gewalttätigen Verhaltens im Kontext von Fußballspielen
- Spezifische Merkmale und Verhaltensweisen der Hooligansubkultur (z.B. Identifikation, Erscheinungsbild, Hierarchien)
- Die Rolle von Medien und Politik in der Hooliganszene
- Präventionsmaßnahmen und deren Wirksamkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Hooligansubkultur eingehend zu analysieren und gängige Vorurteile mit empirischen Daten zu konfrontieren. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Subkultur und der Ursachenanalyse gewalttätigen Verhaltens, gefolgt von einer Untersuchung verschiedener Präventionsmaßnahmen.
2 Merkmale: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von zentralen Begriffen wie Hooliganismus, Devianz und Subkultur. Es wird die Geschichte des Hooliganismus nachgezeichnet, wobei die Ausdifferenzierung der Fanszene in verschiedene Gruppen (Neckermänner, Kutten, Hools) und die Entwicklung in der DDR beleuchtet werden. Schließlich werden verschiedene Ursachen für gewalttätiges Zuschauerverhalten untersucht, wie die Entwertungsthese, das Suchtpotential von Gewalt, gruppendynamische Effekte und die Rolle der Spieler und des Fußballs selbst.
3 Ausgewählte Probleme: Dieses Kapitel behandelt spezifische Probleme der Hooliganszene, wie die Politisierung (rechte und linke Tendenzen), die Rolle der Medien bei der Verstärkung von Gewalt, die besondere Problematik von Länderspielen, das deutsch-holländische Fußballverhältnis und die geringe Beteiligung von Frauen an der Szene.
Schlüsselwörter
Hooliganismus, Fußballgewalt, Jugendsubkultur, Devianz, Entwertungsthese, Massenbewegungen, Gruppendynamik, Medienwirkung, Prävention, Fanprojekte, Polizei, Rechtsextremismus, Männlichkeit, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Hooligansubkultur in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Analyse der Hooligansubkultur in Deutschland. Sie untersucht die Geschichte des Hooliganismus, die Ursachen gewalttätigen Verhaltens, spezifische Merkmale der Subkultur und verschiedene Präventionsmaßnahmen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Subkultur, der Ursachenanalyse gewalttätigen Verhaltens und der Untersuchung verschiedener Präventionsmaßnahmen. Die Arbeit zielt darauf ab, Vorurteile zu entkräften und ein differenziertes Bild dieser Jugendkultur zu zeichnen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themengebiete: Begriffsklärungen (Hooliganismus, Devianz, Subkultur), die Geschichte des Hooliganismus (inkl. Entwicklung in der DDR und im Ost-West-Vergleich), Ursachen von Zuschauerausschreitungen (Entwertungsthese, Gruppendynamik, Rolle des Fußballs etc.), spezifische Merkmale der Hooligansubkultur (Identifikation, Erscheinungsbild, Hierarchien, Verhaltensweisen), ausgewählte Probleme (Politisierung, Medienwirkung, Länderspiele, deutsch-holländisches Verhältnis, Rolle der Frauen), und schließlich verschiedene Präventionsmaßnahmen (durch Sozialarbeit, Polizei, Stadienordnung, Vereine etc.).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Merkmale der Hooligansubkultur, Ausgewählte Probleme, Prävention gewalttätigen Zuschauerverhaltens und ein persönliches Resümee. Kapitel 2 ("Merkmale") befasst sich detailliert mit der Definition zentraler Begriffe, der Geschichte des Hooliganismus und den Ursachen gewalttätigen Verhaltens. Kapitel 3 ("Ausgewählte Probleme") beleuchtet spezifische Herausforderungen der Hooliganszene. Kapitel 4 ("Prävention") untersucht verschiedene Strategien zur Gewaltprävention.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Hooliganismus, Fußballgewalt, Jugendsubkultur, Devianz, Entwertungsthese, Massenbewegungen, Gruppendynamik, Medienwirkung, Prävention, Fanprojekte, Polizei, Rechtsextremismus, Männlichkeit und Identität.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein differenziertes und wissenschaftlich fundiertes Bild der Hooligansubkultur zu zeichnen, gängige Vorurteile zu widerlegen und effektive Präventionsmaßnahmen zu beleuchten. Durch die Auswertung empirischer Daten und wissenschaftlicher Erkenntnisse soll ein umfassendes Verständnis der Hooligansubkultur geschaffen werden.
Wer sollte diese Arbeit lesen?
Diese Arbeit richtet sich an alle, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Hooliganismus auseinandersetzen möchten, einschließlich Studierender, Wissenschaftler*innen und Personen, die im Bereich der Präventionsarbeit tätig sind. Sie ist auch für alle interessant, die ein tieferes Verständnis der Hooligansubkultur und ihrer Ursachen entwickeln möchten.
- Quote paper
- Ina Weigelt (Author), 2003, Die Subkultur der Hooligans. Merkmale, Probleme, Präventionsansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20919