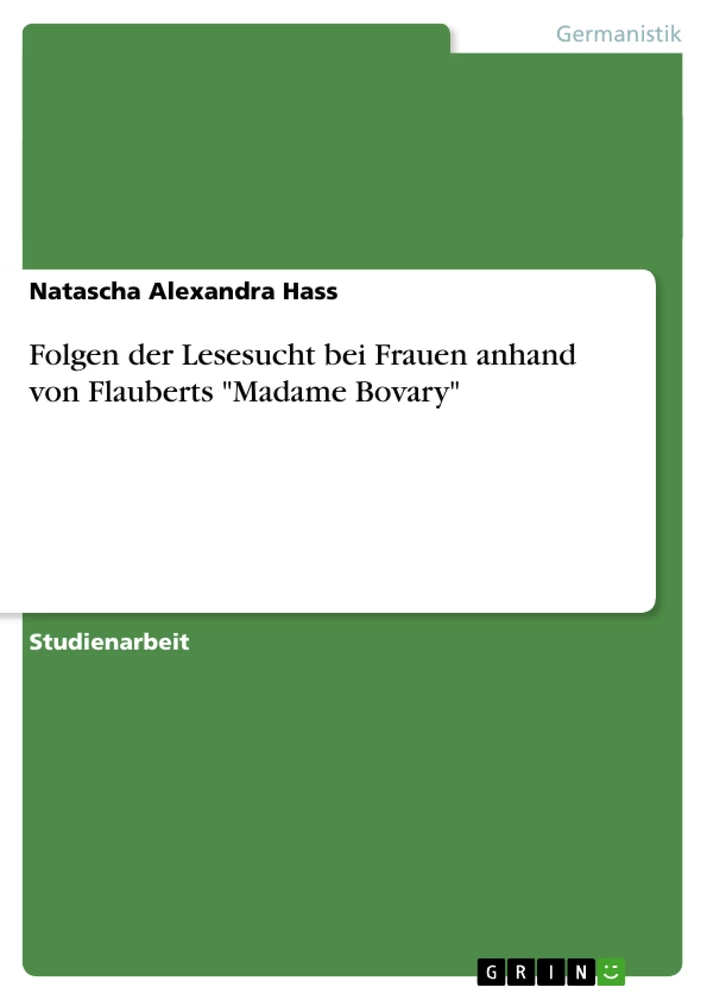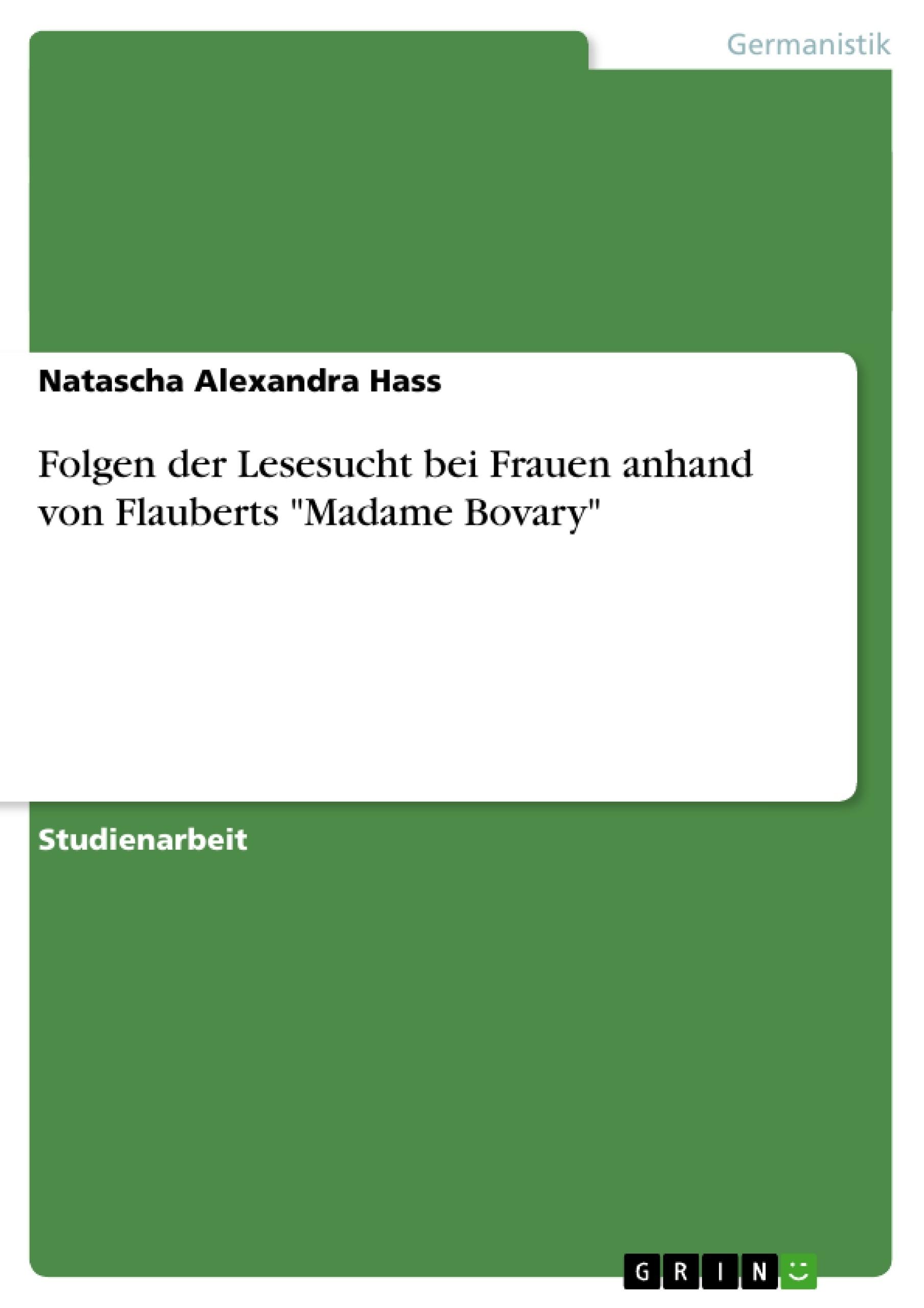Die Hauptseminararbeit legt den Fokus auf die Lesesuchtdebatte um das weibliche Geschlecht und untersucht, welche Auswirkungen von verschiedensten Seiten prognostiziert werden. Verfolgt wird die These, ob gerade das Leseverbot von Belletristik für Frauen auf Grund der Angst vor Emanzipation und zur vorsorglichen Unterdrückung des weiblichen Geschlechts verhängt wird und ob die gesamte Lesesuchtdebatte eine von den Obrigkeiten angestoßene Diskussion ist, um das Bürgertum zu kontrollieren. Von Interesse ist zudem, ob sich die Gründe für die Suchtdiskussionen bis in die Gegenwart hinein geändert haben, oder ob es sich immer noch um ähnliche Hintergründe und Besorgnisse handelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Änderung der Lesegewohnheiten im 18. Jahrhundert
- 2. Folgen und Gefahren der Lesesucht
- 2.1 Aufkommende Lesesuchtdebatte im 18. Jahrhundert
- 2.2 Körperliche und psychische Auswirkungen der übermäßigen Lektüre bei Frauen
- 2.3 Gefahr der Romane: Vollkommenheit der Fiktion vs. Unvollkommenheit der Realität
- 3. Madame Bovary - eine Lesesüchtige
- 3.1 Flauberts Realismus und das Leseverhalten im 19. Jahrhundert
- 3.2 Realitätsverlust von Emma: Flucht in die Welt der Phantasie
- 3.3 Folgen: Vernachlässigung der Familie, des Haushalts und Ehebruch
- 3.4 Verfall von Geist und Körper: Zerbrechen an der Unvollkommenheit der Realität
- 4. Aktualität der Suchtdebatte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lesesuchtdebatte des 18. Jahrhunderts, insbesondere im Hinblick auf Frauen und die Auswirkungen des exzessiven Konsums von Belletristik. Es wird analysiert, welche Gefahren und Folgen der Lesesucht zugeschrieben wurden und ob ein Zusammenhang zwischen dem Leseverbot für Frauen und der Angst vor Emanzipation besteht. Die Aktualität dieser Debatte und die Kontinuität der dahinterstehenden Sorgen werden ebenfalls thematisiert.
- Änderung der Lesegewohnheiten im 18. Jahrhundert und die Entstehung eines neuen Lesepublikums
- Die Folgen und Gefahren der Lesesucht, insbesondere für Frauen
- Die Kritik an Romanen und die Angst vor Realitätsverlust
- Die Rolle der Lesesuchtdebatte in der Kontrolle des Bürgertums
- Die Aktualität der Suchtdebatte und die Kontinuität der Sorgen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Änderung der Lesegewohnheiten im 18. Jahrhundert: Das Kapitel beschreibt die Veränderung der Lesegewohnheiten im 18. Jahrhundert, ausgehend von einer „Ehrfurcht vor dem Buch“ mit wenigen, teuren Büchern und Wiederholungslektüre hin zu einem breiteren Lesepublikum im aufstrebenden Bürgertum. Die Entstehung von Leihbibliotheken und Lesegesellschaften ermöglichte einen grösseren Zugang zu Literatur. Eine zunehmende Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern führte dazu, dass Frauen vermehrt Unterhaltungsliteratur lasen, während Männer sich Sachliteratur zuwandten. Die weltliche Literatur rückte in den Vordergrund, und die didaktischen Absichten des Lesens traten in den Hintergrund. Die wachsende Nachfrage nach Belletristik, insbesondere bei Frauen, wird als Ausdruck eines Bedürfnisses nach Handlungsmöglichkeiten interpretiert, die ihnen im realen Leben verwehrt waren. Die Trennung von Vergnügung und Nützlichkeit wich der Begeisterung für das Lesen in allen Altersklassen, was zu Klagen über "Vielleserei" führte.
2. Folgen und Gefahren der Lesesucht: Dieses Kapitel analysiert die aufkommende Lesesuchtdebatte im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Die Kritik an der fiktionalen Literatur fokussiert auf die angebliche Förderung von Unmoral, die Vernachlässigung von Pflichten und insbesondere bei Frauen, die Vernachlässigung von Familie und Haushalt. Die "Verselbstständigung des Lesers" und die Ignoranz von Leseempfehlungen werden ebenfalls kritisiert. Die Aufklärung instrumentalisierte den Roman zu aufklärerisch-nützlichen Zwecken, was die Kritik an anderen Romanen verstärkte. Die Angst vor Realitätsverlust und der Unfähigkeit, zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu unterscheiden, steht im Mittelpunkt der Debatte, da dies zu einem immer tieferen Eintauchen in die Phantasie führen sollte.
Schlüsselwörter
Lesesucht, Lesewut, Belletristik, Romanlektüre, Frauen, 18. Jahrhundert, Aufklärung, Realitätsverlust, Emanzipation, Bürgertum, Kontrolle, Moral, Geschlechterrollen.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Lesesuchtdebatte im 18. und 19. Jahrhundert
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Lesesuchtdebatte des 18. Jahrhunderts, insbesondere ihre Auswirkungen auf Frauen und den exzessiven Konsum von Belletristik. Es wird untersucht, welche Gefahren und Folgen der Lesesucht zugeschrieben wurden und ob ein Zusammenhang zwischen dem Leseverbot für Frauen und der Angst vor Emanzipation besteht. Die Aktualität dieser Debatte und die Kontinuität der dahinterstehenden Sorgen werden ebenfalls thematisiert.
Welche Veränderungen der Lesegewohnheiten im 18. Jahrhundert werden beschrieben?
Das 18. Jahrhundert erlebte einen Wandel von einer elitären Lesekultur mit wenigen, teuren Büchern hin zu einem breiteren Lesepublikum im aufstrebenden Bürgertum. Die Entstehung von Leihbibliotheken und Lesegesellschaften erweiterte den Zugang zu Literatur. Frauen lasen vermehrt Unterhaltungsliteratur, während Männer sich stärker Sachbüchern zuwandten. Die weltliche Literatur gewann an Bedeutung, und die didaktischen Aspekte des Lesens traten in den Hintergrund. Die steigende Nachfrage nach Belletristik, insbesondere bei Frauen, wird als Ausdruck eines Bedürfnisses nach Handlungsmöglichkeiten interpretiert, die ihnen im realen Leben verwehrt waren.
Welche Gefahren und Folgen der Lesesucht wurden im 18. Jahrhundert gesehen?
Die Lesesuchtdebatte des 18. Jahrhunderts kritisierte die fiktionale Literatur wegen der angeblichen Förderung von Unmoral und der Vernachlässigung von Pflichten, insbesondere bei Frauen (Familie und Haushalt). Die „Verselbstständigung des Lesers“ und die Ignoranz von Leseempfehlungen wurden ebenfalls kritisiert. Die Aufklärung instrumentalisierte den Roman teilweise zu aufklärerisch-nützlichen Zwecken, was die Kritik an anderen Romanen verstärkte. Die Angst vor Realitätsverlust und der Unfähigkeit, Fiktion und Wirklichkeit zu unterscheiden, stand im Mittelpunkt der Debatte.
Welche Rolle spielte die Lesesuchtdebatte in der gesellschaftlichen Kontrolle?
Die Arbeit impliziert, dass die Lesesuchtdebatte ein Mittel der gesellschaftlichen Kontrolle, insbesondere des Bürgertums, darstellte. Die Angst vor der Emanzipation von Frauen durch die Lektüre von Romanen spielte dabei eine wichtige Rolle. Das Leseverbot für Frauen und die Kritik an Belletristik dienten dazu, traditionelle Geschlechterrollen und soziale Strukturen aufrechtzuerhalten.
Wie wird Madame Bovary in die Analyse eingebunden?
Madame Bovary wird als Beispiel einer lesesüchtigen Frau im 19. Jahrhundert verwendet. Flauberts Realismus und das Leseverhalten im 19. Jahrhundert werden analysiert, um Emmas Flucht in die Welt der Phantasie und die daraus resultierenden Folgen (Vernachlässigung der Familie, Ehebruch, Verfall von Geist und Körper) zu beleuchten. Ihr Schicksal wird als Folge des Zerbrechens an der Unvollkommenheit der Realität im Vergleich zur idealisierten Welt der Romane dargestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lesesucht, Lesewut, Belletristik, Romanlektüre, Frauen, 18. Jahrhundert, Aufklärung, Realitätsverlust, Emanzipation, Bürgertum, Kontrolle, Moral, Geschlechterrollen.
Welche Aktualität besitzt die Lesesuchtdebatte?
Die Arbeit betont die Aktualität der Lesesuchtdebatte und die Kontinuität der dahinterstehenden Sorgen. Obwohl der Kontext sich verändert hat, bestehen Ängste vor Realitätsverlust, Einfluss von Medienkonsum und gesellschaftlicher Kontrolle weiterhin fort.
- Quote paper
- Natascha Alexandra Hass (Author), 2012, Folgen der Lesesucht bei Frauen anhand von Flauberts "Madame Bovary", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209153