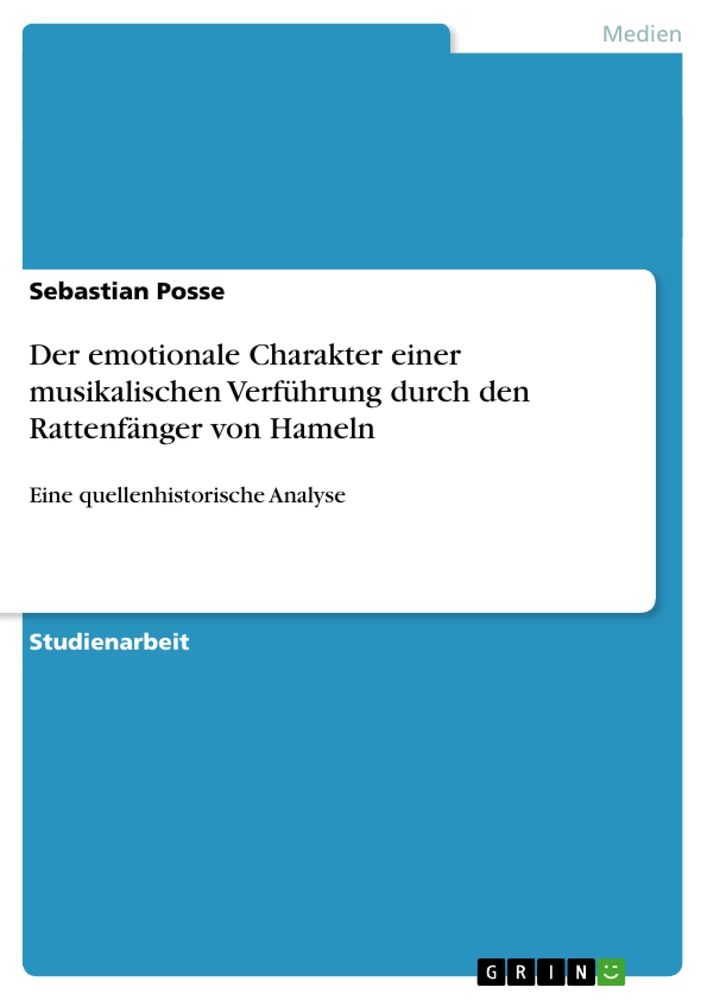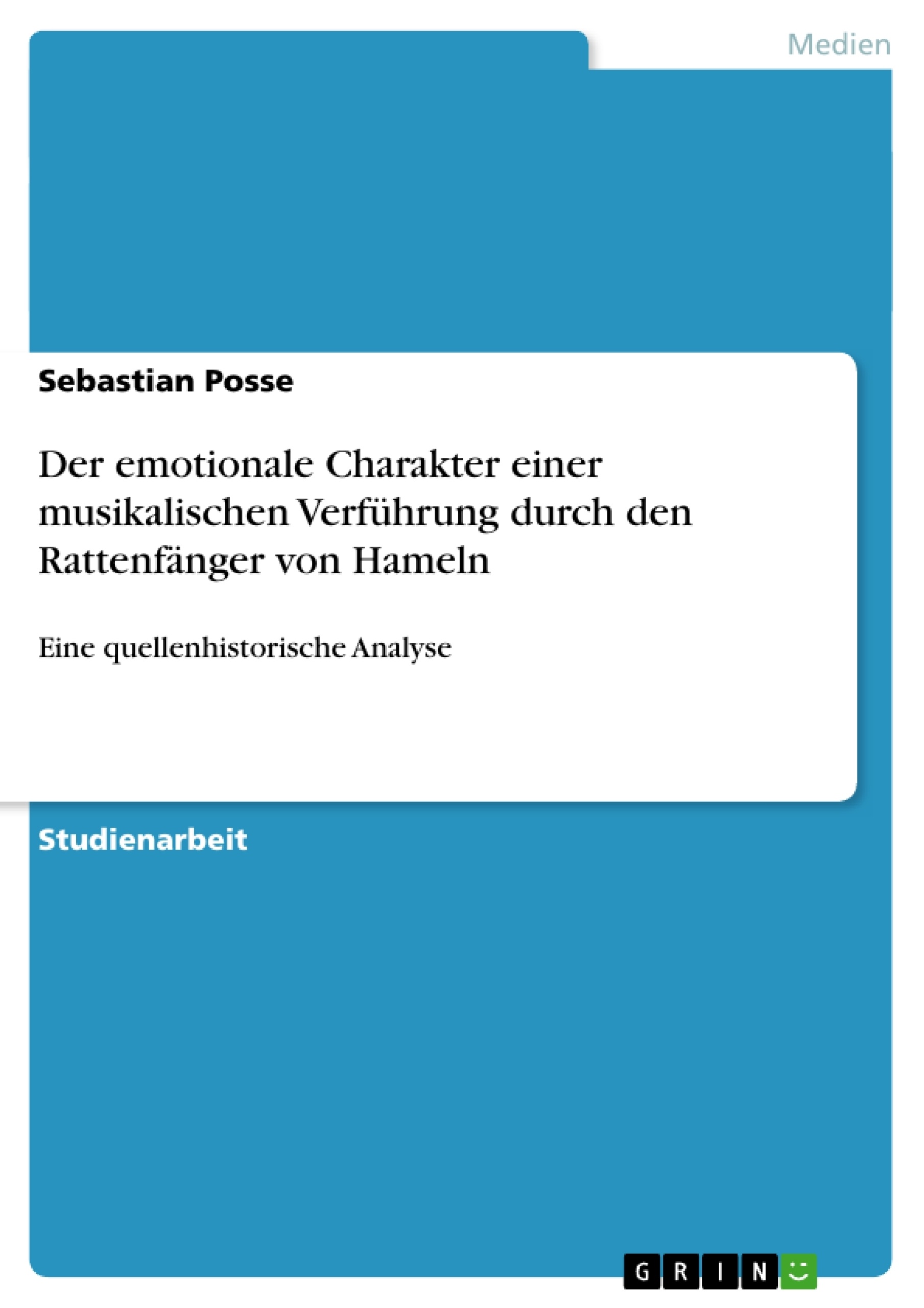Am „Rattenfänger von Hameln“ lässt sich wie an keiner anderen Sage zeigen, wie sich der Blickwinkel auf eine Geschichte mit der Zeit veränderte. Bisher weitgehend unbeachtet ist jedoch die Sage als Träger von emotionalem Gehalt, was umso mehr erstaunt wenn man bedenkt, dass letztlich Emotionen für die Überlieferung eines Geschehnisses in Geschichten-, sprich Sagenform verantwortlich sind. Die hier vorliegende Arbeit hat zum Ziel, diese Lücke zu schließen und eine emotionstheoretische Analyse in verschiedenen Stadien der Rezeption vorzunehmen. Dazu sollen u.a. die Emotionstheorien von Sir Anthony Kenny, William Lyons und Ronald de Sousa verwendet werden, welche exemplarisch für neuere Theorien von Emotionalität als analytische Werkzeuge zur Anwendung kommen.
Die Eingangs- und Leitthese dazu lautet, dass sich ein wesentlicher Erkenntnisgewinn über die Rolle von Emotionen als motivierender Faktor in Sage und Märchen aus einer kritisch-analytischen Betrachtung des „Rattenfänger von Hameln“ ziehen lässt. Das Motiv der Verführung durch Musik wird dabei auf verschiedenen Ebenen beleuchtet, was zu einem umfassenden Gesamtbild und letztlich einer emotionstheoretischen Deutung dieses Sagenmotivs führen soll. Zudem werden so Betrachtungen über eine sich verändernde Emotionalität in der Rezeption über die Jahrhunderte möglich, die nirgendwo sonst stattfinden könnten. Die Akteure der Sage, die Kinder als Verführte und besonders der Rattenfänger als Verführer, durchlaufen dabei faszinierende Transformationsprozesse, nicht zuletzt durch ein sich veränderndes Verständnis des emotionalen Gehalts der Sage.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und These
- Kapitel 1 - Vorstellung der Sage und der Methodik
- a.) Darstellung der Sage und der Theorien zum historischen Ereignis
- b.) Die Rezeptionsgeschichte des Stoffes im Überblick
- c.) Analytische Werkzeuge: Die Emotionstheorien und ihre Anwendung
- Kapitel 2 - Die Quellen der Sage
- a.) Heinrich von Herford (u.a.), Cantena aurea, Nachtrag (1430/50)
- b.) Athanasius Kircher, Musurgia unversalis (1650)
- c.) Jakob und Wilhelm Grimm, Deutsche Sagen (1816)
- Kapitel 3 - Musik als Verführung
- a.) Literarische Bearbeitungen der Rattenfängersage
- b.) Das Motiv einer Entführung durch Musik im europäischen Märchen
- c.) Eine systematisch-vergleichende Analyse aller Quellen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rattenfängersage aus emotionstheoretischer Perspektive. Sie analysiert die Rolle von Emotionen als motivierenden Faktor in der Sage und ihren verschiedenen Rezeptionsstadien. Der Fokus liegt auf dem Motiv der musikalischen Verführung und deren Wandel über die Jahrhunderte.
- Die emotionale Wirkung der Musik in der Rattenfängersage
- Die Rezeptionsgeschichte der Sage und die Veränderung ihrer emotionalen Bedeutung
- Anwendung von Emotionstheorien zur Analyse der Sage
- Der Rattenfänger als Verführer und die Kinder als Verführte
- Der historische Kern der Sage und seine Verbindung zu den emotionalen Aspekten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und These: Die Einleitung stellt die Rattenfängersage als einen bekannten Sagenstoff vor und hebt ihre einzigartige Rezeptionsgeschichte hervor. Sie betont die bisherigen Forschungsansätze, die sich vorwiegend auf den historischen Kern der Sage konzentrierten, und verweist auf die bisher vernachlässigte emotionale Komponente. Die Arbeit verfolgt das Ziel, diese Lücke zu schließen und eine emotionstheoretische Analyse der Sage in verschiedenen Rezeptionsstadien durchzuführen. Die zentrale These ist, dass sich durch eine kritische Betrachtung der Sage wichtige Erkenntnisse über die Rolle von Emotionen als motivierender Faktor gewinnen lassen.
Kapitel 1 - Vorstellung der Sage und der Methodik: Dieses Kapitel beschreibt zunächst den Grundgehalt der Rattenfängersage basierend auf der Grimm'schen Version. Es werden vier zentrale Motive identifiziert: Musik als Verführungsmittel, Kindesentführung, der Rattenfänger als unehrlicher Landfahrer und der Bezug zu einem historischen Ereignis. Der Unterschied zwischen Sage und Märchen wird anhand des historischen Kerns der Sage erläutert. Schließlich werden die Emotionstheorien von Kenny, Lyons und de Sousa als analytische Werkzeuge vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit angewendet werden.
Kapitel 2 - Die Quellen der Sage: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Quellen der Rattenfängersage, u.a. Werke von Heinrich von Herford, Athanasius Kircher und den Brüdern Grimm. Es untersucht die unterschiedlichen Darstellungen der Sage und ihre Variationen, um ein umfassendes Bild der Quellenlage zu erhalten und die Entwicklung der Erzählung über die Zeit nachzuvollziehen. Der Fokus liegt auf der Analyse der jeweiligen Darstellung des Motivs der musikalischen Verführung und deren emotionalen Implikationen.
Kapitel 3 - Musik als Verführung: Kapitel 3 beleuchtet das Motiv der musikalischen Verführung in der Rattenfängersage anhand literarischer Bearbeitungen und vergleichender Analysen europäischer Märchen. Die Analyse wird auf die verschiedenen Ebenen der Verführung eingehen, um ein umfassendes Bild der emotionalen Wirkung der Musik zu schaffen und deren Rolle bei der Gestaltung der Handlung und der Charaktere zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Rattenfängersage, Emotionstheorie, Musik, Verführung, Rezeptionsgeschichte, Kinder, Märchen, Sage, historische Ereignis, analytische Werkzeuge, Emotionen als motivierender Faktor.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über die Rattenfängersage
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Rattenfängersage aus einer emotionstheoretischen Perspektive. Der Fokus liegt auf der Analyse der Rolle von Emotionen als motivierender Faktor in der Sage und ihren verschiedenen Interpretationen über die Jahrhunderte hinweg. Besonders im Mittelpunkt steht das Motiv der musikalischen Verführung.
Welche Quellen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Quellen der Rattenfängersage, darunter Werke von Heinrich von Herford (Cantena aurea), Athanasius Kircher (Musurgia universalis) und den Brüdern Grimm (Deutsche Sagen). Der Vergleich dieser Quellen soll ein umfassendes Bild der Entwicklung der Erzählung und ihrer Variationen über die Zeit vermitteln.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit nutzt Emotionstheorien von Kenny, Lyons und de Sousa als analytische Werkzeuge, um die emotionale Wirkung der Musik in der Sage und die Veränderung ihrer emotionalen Bedeutung im Laufe der Rezeptionsgeschichte zu untersuchen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: die emotionale Wirkung der Musik in der Rattenfängersage; die Rezeptionsgeschichte der Sage und die Veränderung ihrer emotionalen Bedeutung; die Anwendung von Emotionstheorien zur Analyse der Sage; der Rattenfänger als Verführer und die Kinder als Verführte; und der historische Kern der Sage und seine Verbindung zu den emotionalen Aspekten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung mit These, drei Kapitel und eine Zusammenfassung. Kapitel 1 stellt die Sage und die Methodik vor. Kapitel 2 analysiert die Quellen der Sage. Kapitel 3 beleuchtet das Motiv der musikalischen Verführung. Die Einleitung präsentiert die These, dass die emotionale Komponente der Sage bisher vernachlässigt wurde und eine kritische Betrachtung wichtige Erkenntnisse über die Rolle von Emotionen als motivierender Faktor liefert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rattenfängersage, Emotionstheorie, Musik, Verführung, Rezeptionsgeschichte, Kinder, Märchen, Sage, historisches Ereignis, analytische Werkzeuge, Emotionen als motivierender Faktor.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass durch eine kritische Betrachtung der Rattenfängersage unter Einbezug von Emotionstheorien wichtige Erkenntnisse über die Rolle von Emotionen als motivierender Faktor gewonnen werden können.
Welche Rolle spielt die Musik in der Sage?
Die Arbeit untersucht ausführlich die Rolle der Musik als Verführungsmittel in der Rattenfängersage und analysiert deren emotionale Wirkung auf die verschiedenen Akteure und im Laufe der Rezeptionsgeschichte.
- Quote paper
- Sebastian Posse (Author), 2012, Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209093