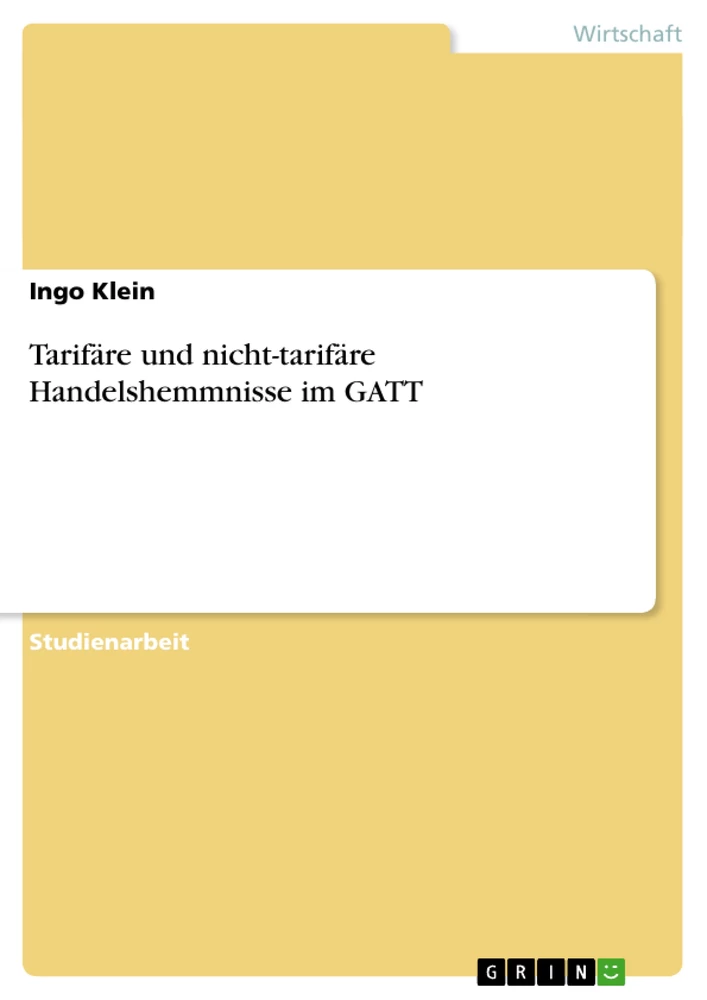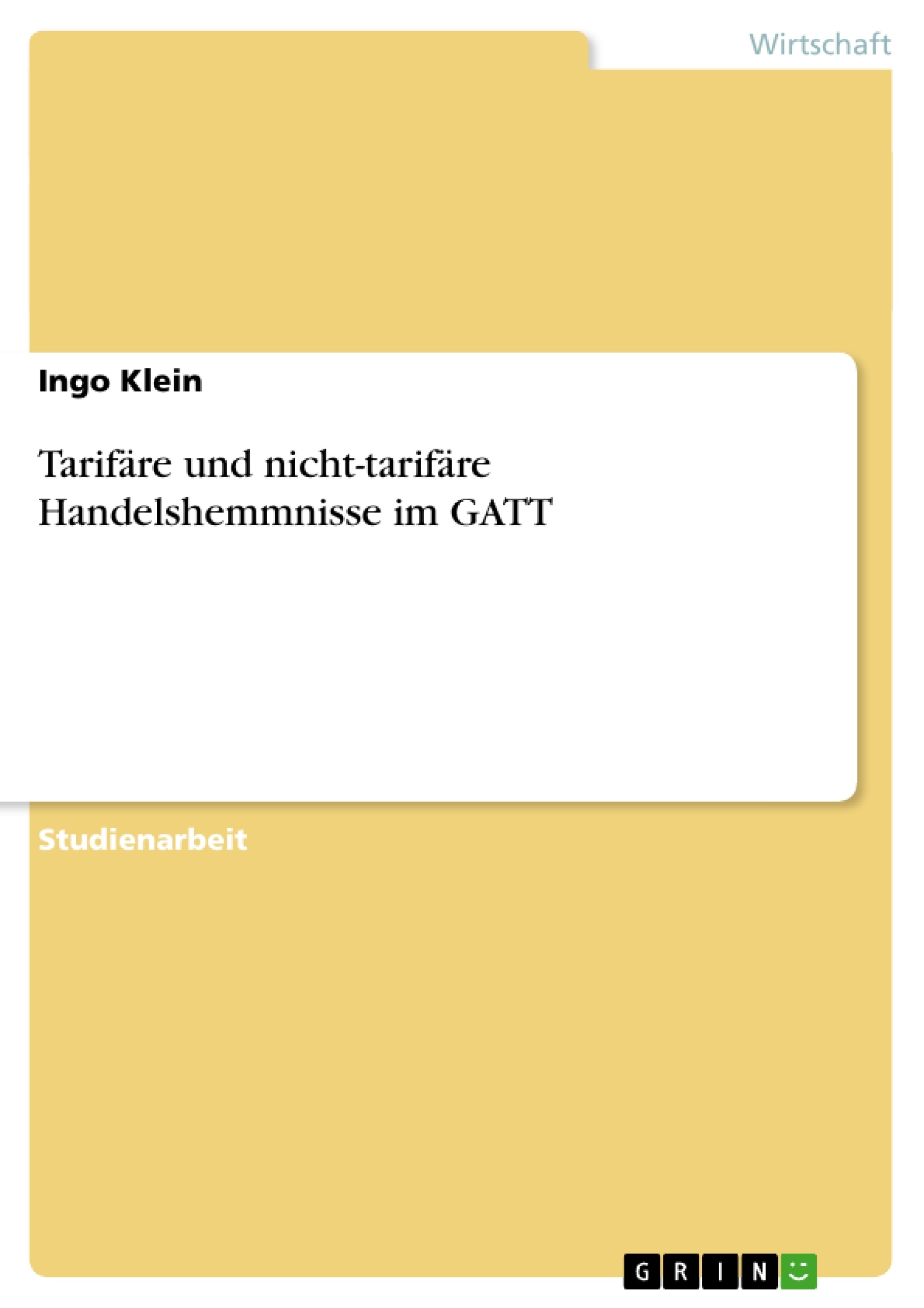1947 setzte sich das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (engl. GATT= General
Agreements on Tariffs and Trade) zum Ziel, den Lebensstandard, den
Beschäftigunsgrad und das Realeinkommen auf internationaler Ebene zu erhöhen.
Die wichtigsten Werkzeuge stellten hierbei die Steigerung der nationalen Produktion
sowie intensivierter Güteraustausch dar. Hierbei entwickelte sich das als Alternative
gestartete GATT1 von einem Handelsabkommen zu einer 146 Länder umspannenden
Handelsorganisation mit intergouvernementalem Charakter, d.h. ohne supranationale
Entscheidungsbefugnis.
Die Begründung des Strebens nach internationalem Freihandel liegt in den
Effizienzgewinnen aller am Tauschprozess beteiligten Parteien2. Dieser globale
„Win-win“-Gedanke tritt jedoch allzu oft mit nationalen oder lobbyistischen
Interessen in Konflikt. Um diese Interessen durchzusetzen, werden staatliche
Maßnahmen tarifärer und nicht-tarifärer Art implementiert, um die eigene Wohlfahrt
überproportional zu steigern bzw. zu erhalten. 3
Diese Arbeit hat zum Ziel, im Groben aufzuzeigen, was tarifäre und nicht-tarifäre
Handelshemmnisse ausmacht, ihre Bedeutung innerhalb des GATT zu skizzieren und
inwiefern sie heute die Landschaft des internationalen Handels mitprägen.
1 Das GATT war nach der gescheiterten Ratifikation der Havanna-Charta (1947) installiert worden
2 Vgl. Theorem der komparativen Kostenvorteile nach Ricardo (1815)
3 Vgl. Ströbele/ Wacker (1995), S. 57
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung von Handelshemmnissen für die Wirtschaft
- Tarifäre Handelshemmnisse
- Nicht-tarifäre Handelshemmnisse (NTH)
- Fallbeispiel eines Zollkonflikts: Der Streit um die US-Stahlzölle März 2002 - Dezember 2003
- Fazit Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse im Kontext des GATT. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Hemmnisse für die Wirtschaft aufzuzeigen und ihren Einfluss auf den internationalen Handel zu skizzieren. Die Arbeit beleuchtet dabei sowohl die theoretischen Grundlagen als auch ein konkretes Fallbeispiel.
- Tarifäre Handelshemmnisse (Zölle) und deren Arten
- Nicht-tarifäre Handelshemmnisse und ihre Auswirkungen
- Die Rolle des GATT im Umgang mit Handelshemmnissen
- Konfliktbeispiele im internationalen Handel
- Die Bedeutung von Freihandel und dessen Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnisse ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie beschreibt das GATT als Ausgangspunkt für den internationalen Freihandel und hebt den Konflikt zwischen dem Ideal des "Win-win"-Szenarios und nationaler bzw. lobbyistischer Interessen hervor. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Bedeutung von Handelshemmnissen und deren Einfluss auf die Gestaltung des internationalen Handels.
Die Bedeutung von Handelshemmnissen für die Wirtschaft: Dieses Kapitel analysiert die ökonomischen Auswirkungen tarifärer und nicht-tarifärer Handelshemmnisse. Es beschreibt zunächst tarifäre Handelshemmnisse, vor allem Zölle, ihre verschiedenen Arten und die dahinterstehenden Ziele wie die Verbesserung der Tauschverhältnisse, den Schutz inländischer Produktionszweige und die Verminderung des Preisdrucks. Der Abschnitt verdeutlicht die Komplexität des GATT-Regelwerks und dessen Prinzipien im Umgang mit Zöllen. Das Verständnis der ökonomischen Folgen von Zöllen und die Einordnung in das GATT-Regelwerk sind zentrale Bestandteile dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
GATT, Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen, tarifäre Handelshemmnisse, Zölle, nicht-tarifäre Handelshemmnisse, internationaler Handel, Freihandel, Protektionismus, Wirtschaftspolitik, Zollkonflikte, Terms of Trade.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Seminararbeit über Handelshemmnisse
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse im Kontext des GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen). Sie beleuchtet die ökonomischen Auswirkungen dieser Hemmnisse auf den internationalen Handel und analysiert ein konkretes Fallbeispiel eines Zollkonflikts.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt tarifäre Handelshemmnisse (insbesondere Zölle), nicht-tarifäre Handelshemmnisse, die Rolle des GATT im Umgang mit diesen Hemmnissen, Konfliktbeispiele im internationalen Handel, die Bedeutung von Freihandel und die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Es wird der Konflikt zwischen dem Ideal des "Win-win"-Szenarios und nationalen bzw. lobbyistischen Interessen thematisiert.
Welche Arten von Handelshemmnissen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen tarifären Handelshemmnissen (z.B. Zölle mit verschiedenen Arten) und nicht-tarifären Handelshemmnissen. Es werden die jeweiligen ökonomischen Auswirkungen und Ziele (z.B. Verbesserung der Tauschverhältnisse, Schutz inländischer Produktion) erläutert.
Welche Rolle spielt das GATT?
Das GATT dient als Ausgangspunkt für die Betrachtung des internationalen Freihandels. Die Arbeit analysiert die Komplexität des GATT-Regelwerks und dessen Prinzipien im Umgang mit Zöllen und anderen Handelshemmnissen.
Enthält die Arbeit ein Fallbeispiel?
Ja, die Arbeit enthält ein Fallbeispiel eines Zollkonflikts (der Streit um die US-Stahlzölle März 2002 - Dezember 2003), das die theoretischen Ausführungen veranschaulicht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Bedeutung von Handelshemmnissen für die Wirtschaft (mit Unterkapiteln zu tarifären und nicht-tarifären Hemmnissen), ein Kapitel zu einem konkreten Fallbeispiel eines Zollkonflikts und ein Fazit/Ausblick.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: GATT, Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen, tarifäre Handelshemmnisse, Zölle, nicht-tarifäre Handelshemmnisse, internationaler Handel, Freihandel, Protektionismus, Wirtschaftspolitik, Zollkonflikte, Terms of Trade.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die Bedeutung von Handelshemmnissen für die Wirtschaft aufzuzeigen, ihren Einfluss auf den internationalen Handel zu skizzieren und die theoretischen Grundlagen mit einem konkreten Fallbeispiel zu veranschaulichen.
- Quote paper
- Ingo Klein (Author), 2003, Tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse im GATT, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20904