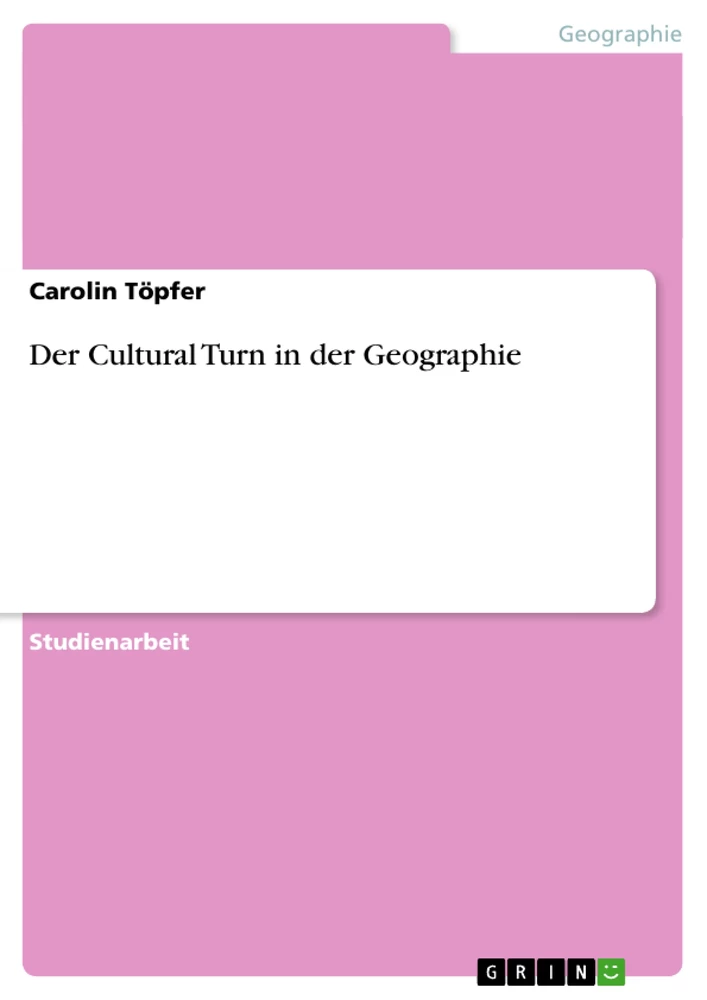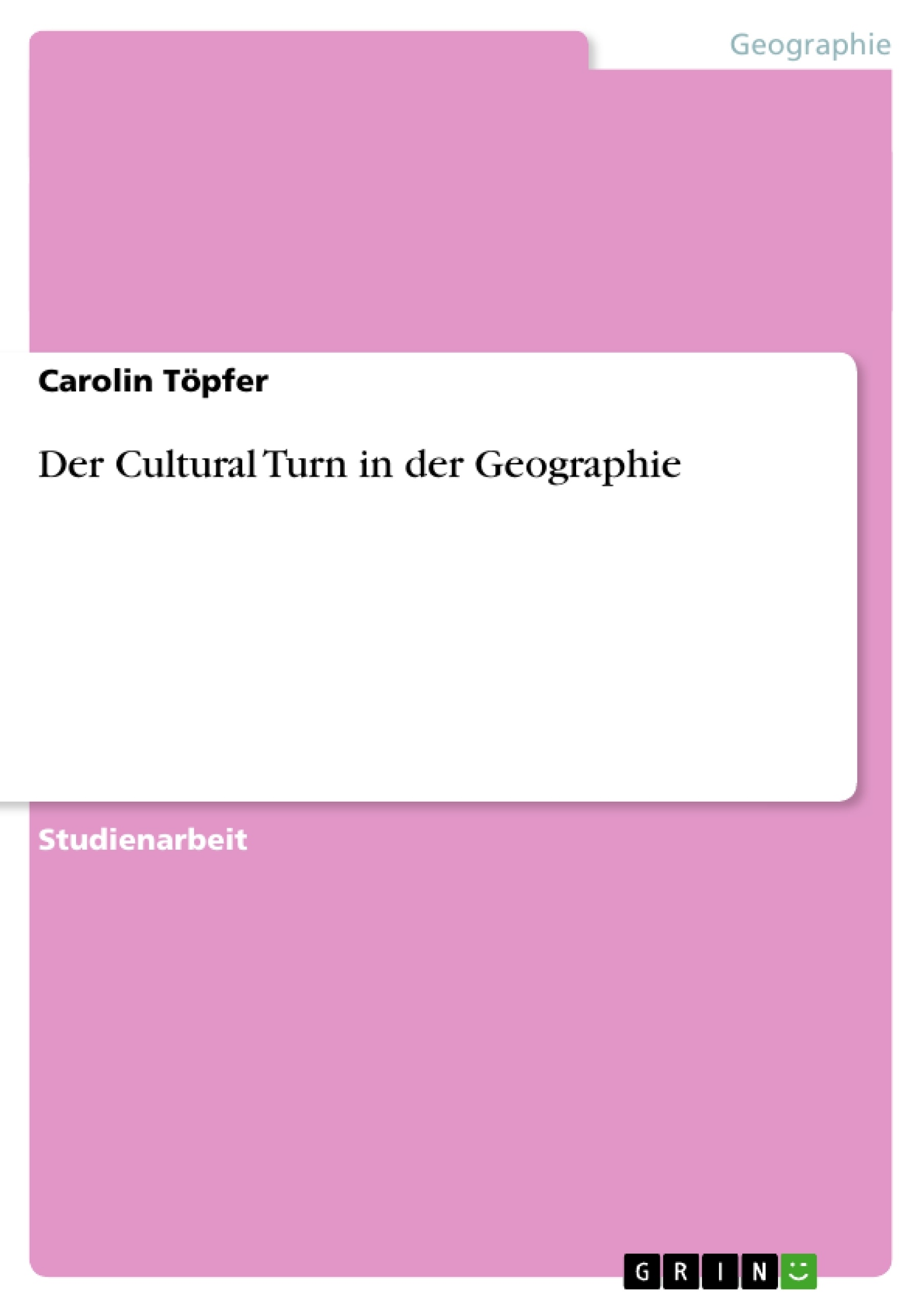Sozialgeographie versteht sich als Wissenschaft von „Raum“ und „Gesellschaft“. Ein Blick in die Fachgeschichte zeigt jedoch, dass die Geographen bis in die 60er Jahre des vergangen Jahrhunderts eine Wissenschaft betrieben haben, die sich primär auf den „Raum“ konzent¬rierte und die „Gesellschaft“ weitestgehend außer Acht ließ. Der Cultural Turn, der auch als Zweite kulturtheoretische Wende bezeichnet wird, beschreibt jene Periode, in der sich die Geographie, insbesondere die Sozialgeographie, wieder mehr auf die Schnittstelle zwischen Raum und Gesellschaft zubewegte. Derartige wissenschaftstheoretische Veränderungen müs¬sen stets vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher Bedingungen analysiert werden. Einschneidende Veränderungen in der Gesellschaft (wie beispielsweise die Globalisierung) verändern zumindest langfristig den Forschungsgegenstand der Sozial- und Gesellschaftswis¬senschaften.
Dementsprechend wird diese Hausarbeit die Anpassung der Geographie, insbesondere der Sozialgeographie, an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen erläutern.
Es wird zunächst eine Erste kulturtheoretische Wende betrachtet werden. Die Emanzipation der Geistes- von den Naturwissenschaften, als Hauptpunkt dieser Wende, wird in ihren Ursa¬chen und Ausprägungen beschrieben werden. In einem weiteren Schritt wird es um eine Wis¬senschaftsperiode gehen, in der die Geographie die Folgen dieser Ersten kulturtheoretischen Wende bearbeitet und eine Zweite Wende vorbereitet. Im dritten Punkt wird schließlich jener Cultural Turn beschrieben, der die Geographie nachhaltig beeinflusste. Die neue wissen¬schaftliche Ausrichtung der Sozialgeographie soll beschrieben werden, ihre Methoden, Theo¬rien und ihre Methodologie werden erläutert und in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
1) Einleitung
2) Ausgangslage vor der Ersten kulturtheoretischen Wende
2.1 Situation der Geographen vor der Ersten kulturtheoretischen Wende
2.2 Die Geisteswissenschaftler
3) Folgen der Ersten kulturtheoretischen Wende für die Geographie
3.1 Methodologisches Elaborat
3.2 Die Raumversessenheit der Geographen
3.3 Neuorientierung der Geographen
4) Der Weg zur Zweiten kulturtheoretischen Wende
4.1 Rahmenbedigungen des Cultural Turns
4.2 Der Cultural Turn
4.3 Kritik an den Cultural Studies
5) Fazit
Literaturverzeichnis
1) Einleitung
Sozialgeographie versteht sich als Wissenschaft von „Raum“ und „Gesellschaft“. Ein Blick in die Fachgeschichte zeigt jedoch, dass die Geographen bis in die 60er Jahre des vergangen Jahrhunderts eine Wissenschaft betrieben haben, die sich primär auf den „Raum“ konzentrierte und die „Gesellschaft“ weitestgehend außer Acht ließ. Der Cultural Turn, der auch als Zweite kulturtheoretische Wende bezeichnet wird, beschreibt jene Periode, in der sich die Geographie, insbesondere die Sozialgeographie, wieder mehr auf die Schnittstelle zwischen Raum und Gesellschaft zubewegte. Derartige wissenschaftstheoretische Veränderungen müssen stets vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher Bedingungen analysiert werden. Einschneidende Veränderungen in der Gesellschaft (wie beispielsweise die Globalisierung) verändern zumindest langfristig den Forschungsgegenstand der Sozial- und Gesellschaftswissenschaften.
Dementsprechend wird diese Hausarbeit die Anpassung der Geographie, insbesondere der Sozialgeographie, an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen erläutern.
Es wird zunächst eine Erste kulturtheoretische Wende betrachtet werden. Die Emanzipation der Geistes- von den Naturwissenschaften, als Hauptpunkt dieser Wende, wird in ihren Ursachen und Ausprägungen beschrieben werden. In einem weiteren Schritt wird es um eine Wissenschaftsperiode gehen, in der die Geographie die Folgen dieser Ersten kulturtheoretischen Wende bearbeitet und eine Zweite Wende vorbereitet. Im dritten Punkt wird schließlich jener Cultural Turn beschrieben, der die Geographie nachhaltig beeinflusste. Die neue wissenschaftliche Ausrichtung der Sozialgeographie soll beschrieben werden, ihre Methoden, Theorien und ihre Methodologie werden erläutert und in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gestellt werden.
2) Ausgangslage vor der Ersten kulturtheoretischen Wende
Der folgende Abschnitt soll einen Überblick über die Inhalte und die Methodologie der Geo-graphen vor der Ersten kulturtheoretischen Wende geben. Außerdem werden am Beispiel Hegels und Webers die Entwicklungen im geisteswissenschaftlichen Forschungsbereich dargestellt.
Hinter jeder wissenschaftlichen Forschung steht eine philosophische Tradition. Die meisten Kulturtheorien seit Platon und Aristoteles sind „Klimatheorien“, welche den Zusammenhang von Mensch und Natur charakterisieren. Hegel spricht unter anderem vom „Naturtypus der Localität, welcher genau zusammenhängt mit dem Typus und Charakter des Volks, das der Sohn solchen Bodens ist“ (Hegel 18402:99).
„Die philosophischen Vorarbeiten bildeten den Ausgangspunkt für den ersten Cultural Turn Ende des 19. Jahrhunderts“ (Werlen 2003:252). Die Geisteswissenschaften strebten die Emanzipation von den Naturwissenschaften an und veränderten ihre Methodologie dahingehend, dass sie die Menschen und ihre Handlungen verstehen und nicht nur erklären wollten (Werlen 2003:252). Diese Veränderung bildet, wie noch gezeigt wird, den Ausgangspunkt für den zweiten Cultural Turn.
2.1 Die Situation der Geographen vor der Ersten kulturtheoretischen Wende
Die Geographie wird schon im Altertum als beschreibende Wissenschaft verstanden. In ihren Anfängen diente sie vor allem dazu, Karten zu entwerfen und sogenannte „blinde Flecken“ auf der Erde zu erforschen und zu kartieren. Schon „die Römer erkannten [den Nutzen der Geographie] für die staatliche Organisation des gewaltigen Imperiums“ (Hübner 2000:11). Poseidonius wies in seinem Werk „Über den Ozean und die umliegenden Gebiete“ auf die „Abhängigkeit menschlicher Rassen von den klimatischen und topographischen Gegebenheiten“ (Hübner 2000:13) hin. Es kann festgehalten werden, dass sogenannte „Klimatheorien“ als entscheidender Argumentationspunkt vorherrschten.
Alexander von Humboldt ist für die Geschichte des Faches Geographie und deren Entwicklung bedeutend. Er gehörte zu einer Gruppe von Geographen, die nicht nur eine Erdbeschreibung anstrebten, sondern darüber hinaus „Universalgelehrtheit“. So brachte er in sein Werk „Kosmos“ nicht nur geographisches Wissen ein, sondern bezog sich auch auf die Botanik und Literatur (Werner 2004:47). „Um die Mitte des 17. Jahrhunderts ging das erste Zeitalter der Entdeckungen zu Ende, das der allgemeinen Entschleierung der Erde gedient hatte“ (Bitterling 1959:95).
Humboldt legte großen Wert auf die Betonung des Zusammenhangs von Mensch und Natur. So findet sich ein Kapitel in seinem „Kosmos“ mit der Überschrift „Naturgefühl nach Verschiedenheit der Breiten und der Völkerstämme“. Seinem Werk hat er den Anspruch, nicht nur empirische Gesetze aufzufinden, sondern vor allem Kausalzusammenhänge aufzudecken und zu erforschen (Werner 2004:51). Seine Forschungsreisen, unter anderem nach Amerika, verbessern die wissenschaftlichen Methoden und erweitern die damaligen Vorstellungen über die Welt (Ochoa 2001:165). Darüber hinaus gab er „Anregung oder Grundlegung zu neuen Wissenszweigen, wie in der Pflanzengeographie, der Meteorologie und Klimatologie, der Meereskunde und nicht zuletzt in der Länderkunde“ (Bitterling 1959:100). Er selbst be-gnügte sich in seinen Forschungen mit einem „Welt-Bild“ und strebte nach einer Welterklärung durch das Aufsuchen kausaler Gesetze (Bitterling 1959:112f). Humboldt bezog wie selbstverständlich den Menschen als einen Teil der Physikalischen Geographie in seine Betrachtungen ein (Beck 1985:303). „Die Durchführung seiner Methode der vergleichenden Geographie machte Alexander von Humboldt neben Carl Ritter zum Begründer der neuzeitlichen Erdkunde als Wissenschaft“ (Bitterling 1959:100).
Carl Ritters geographische Fragestellung ähnelte der Humboldts: „Wie und warum kommt es im Gesamtbereich menschlicher Existenz zu einer solchen Fülle von Differenzierung mensch-licher Lebens-, Schaffens-, Denk- und Verhaltensweisen im Raum?“ (Schach 1996:20) Ritter lehnte ein deduktives Herangehen ab und forderte anstelle dessen die Induktion, da nur diese die Komplexität der Welt erschließbar machen könnte (Schach 1996:26). Deswegen sollte die Geographie auch nie ausschließlich ein beschreibendes Kompendium sein, sondern sie muss dem Menschen den Gesamtorganismus der Welt verständlich machen und somit zu einer Welterklärung taugen (Schach 1996:27). Ritters Auffassung nach werden Mensch und Natur von der Schöpfung bzw. Gott determiniert. Der Mensch wird darüber hinaus zusätzlich von der Natur determiniert. Durch diese einschränkenden natürlichen Lebensbedingungen müssen zwangsläufig unterschiedliche Kulturen entstehen (Schach 1996:45f). Plewe beschreibt diese These an einem allgemeinen Beispiel: „Wo sich eine einförmige Natur weitflächig ausbreitet, regt sie ihre Menschen nicht an, beharren sie i.d.R. beim Althergebrachten, erhalten sie Anstöße meist nur von außen her. Wo die Natur aber auf engem Raume starke Kontraste aufweist, wo […] man auf zwei Tagesreisen vom tropischen Klima bis an den Gletscherrand heran den entsprechenden Wechsel der Vegetation vor Augen hat, lässt das auf Dauer die Phantasie nicht unbeeindruckt und wird zu Konsequenzen anregen“ (Plewe 1981:49).
Auch Alfred Hettner sei an dieser Stelle erwähnt. Er war ein Vertreter der deduktiven Methode und wollte die inneren Zusammenhänge der Erscheinungen aufzeigen. Hettner war demnach ebenfalls der geographischen Forschungsmeinung zuzuordnen, dessen Ziel es war, Kausalgesetzte aufzudecken. Er wollte die Verschiedenheit der Erscheinungsklassen von Ort zu Ort und den Zusammenhang verschiedener Erscheinungsklassen am gegebenen Ort beschreiben. Allerdings plädierte er im Gegensatz zu Humboldt und Ritter für eine erklärende Form der Beschreibung (Wardenga 1995:134). Doch auch Hettner setzte sich für die Einheit des Faches Geographie ein (Wardenga 1995:146).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Kultur und der Raum bzw. Kultur und Natur von den eben aufgeführten Wissenschaftlern als deckungsgleich angesehen wurden (Werlen 2003:252). Kulturen stellten sich als territorial existent und in Lebensräumen verankert dar. Die Klimatheorien behielten in der geographischen Forschung eine große Prägekraft (Werlen 2003:253). Darüber hinaus waren zwei Erklärungen der Nutzung und Umgestaltung der Natur von Bedeutung: die possibilistische und die naturdeterministische Auffassung. Die possibilistische Variante erklärte die „(Regional)Kultur als ein regional entwickelter Deutungsrahmen zur Bewältigung der Existenzprobleme“ (Werlen 2003:253), währenddessen in der naturdeterministischen Auffassung die „Kultur nicht nur als räumliches Phänomen [erklärt], sondern zum unmittelbaren Ausdruck natürlicher Bedingungen“ wurde (Werlen 2003:253). Der naturdeterministische Ansatz war die Grundlage der traditionellen Länderkunde, welche die „Einheit von Natur, Raum und Kultur innerhalb von (größeren oder kleineren) räumlichen Behältnissen“ (Werlen 2003:253f) nachweisen wollte.
In der Geographie wurde also weiterhin die Einmaligkeit jedes Landes, jeder Region und jeder Landschaft betont. Diese Wissenschaft beharrte auf einer reinen Erdbeschreibung (Werlen 2003:254).
2.2 Die Geisteswissenschaftler
An dieser Stelle soll nun auf die Ansätze der Geisteswissenschaftler eingegangen werden, die den Überlegungen der Geographen zu Grunde lagen. In diesem Rahmen sollen lediglich Georg Friedrich Wilhelm Hegel und Max Weber dargestellt werden, wenngleich noch weitere Philosophen und ihre Denkansätze erwähnt werden könnten.
Hegel hielt Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte, in denen er auch Bezug auf den Raum nahm, in dem sich Geschichte abgespielt hat. Es geht ihm dabei nicht darum, „den Boden als äußeres Local kennen zu lernen, sondern den Naturtypus der Localität, welcher genau […] mit dem Typus und Charakter des Volks [zusammenhängt], das der Sohn solchen Bodens ist“ (Hegel 1840:99). Hegel spricht in diesem Zusammenhang davon, dass sich der Schauplatz für die Weltgeschichte nicht im hohen Norden oder tiefen Süden befinden kann, weil dort die Natur von Extremen geprägt ist. Die Menschen können sich laut seiner Auffassung in diesen Breiten nicht frei bewegen und ihr Geist ist nicht fähig, sich eine Welt zu erbauen. Aus diesen Gründen lokalisiert er den Schauplatz der Weltgeschichte im nördlichen Teil der gemäßigten Zone (Hegel 1840:99f). Hegel beschreibt daraufhin besondere Charakterzüge von Menschen, die in bestimmten Höhenlagen siedeln. So bilden die Menschen in Hochländern kleine Familien, die keinen Ackerbau betreiben, da der Boden unfruchtbar, oder nur vorübergehend fruchtbar ist. Die Menschen seien sorglos und würden nicht für den Winter vorsorgen. Es gäbe kein Rechtsverhältnis, wodurch die Charaktere der Bewohner entweder durch äußerste Gastfreundlichkeit oder aber Räuberei gekennzeichnet wären. In den unter den Hochländern liegenden Engtälern wohnen hingegen ruhige Gebirgsvölker, welche Ackerbau und Viehzucht betreiben (Hegel 1840:110). Es wird deutlich, dass er ableitend von der natürlichen Oberfläche der jeweiligen Höhenlage auf den Charakter der Menschen schließt- die schroffen Gebirgszüge eines Hochlandes sich also bei den Menschen durch sehr unterschiedliche Stufen an Freundlichkeit offenbaren. Nach dieser Charakterisierung durch Höhenstufen, widmet sich Hegel der Beschreibung der Wesenszüge und Entwicklungen der Bewohner von Afrika, Asien und Europa. Er stellt fest, dass der Afrikaner den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit darstellt und er findet nichts an das Menschliche Anklingende in seinem Charakter (Hegel 1840:115). Asien hingegen beschreibt er als wesentlich weiter entwickelt. In Anlehnung an die geographische Lage bezeichnet er es als Ursprung des Lichts des Geistes und den Anfang der Weltgeschichte (Hegel 1840:123). Schließlich beschreibt er Europa und unterstellt ihm die wichtigste Rolle: der Anfang aller religiösen und staatlichen Prinzipien wurde in Asien gemacht, doch in Europa wurden sie erst entwickelt. Dies begründet er wiederum mit geographischen Sachverhalten. So ist Europa durch weniger starke Unterschiede in der Landschaft gestaltet als Afrika und Asien, deswegen ist der Charakter der Europäer ausgeglichener und ruhiger. Sie müssen sich nicht mit starken Naturgewalten auseinandersetzen und können sich so besser entwickeln als die anderen Länder (Hegel 1840:126).
[...]
- Quote paper
- Carolin Töpfer (Author), 2011, Der Cultural Turn in der Geographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209020