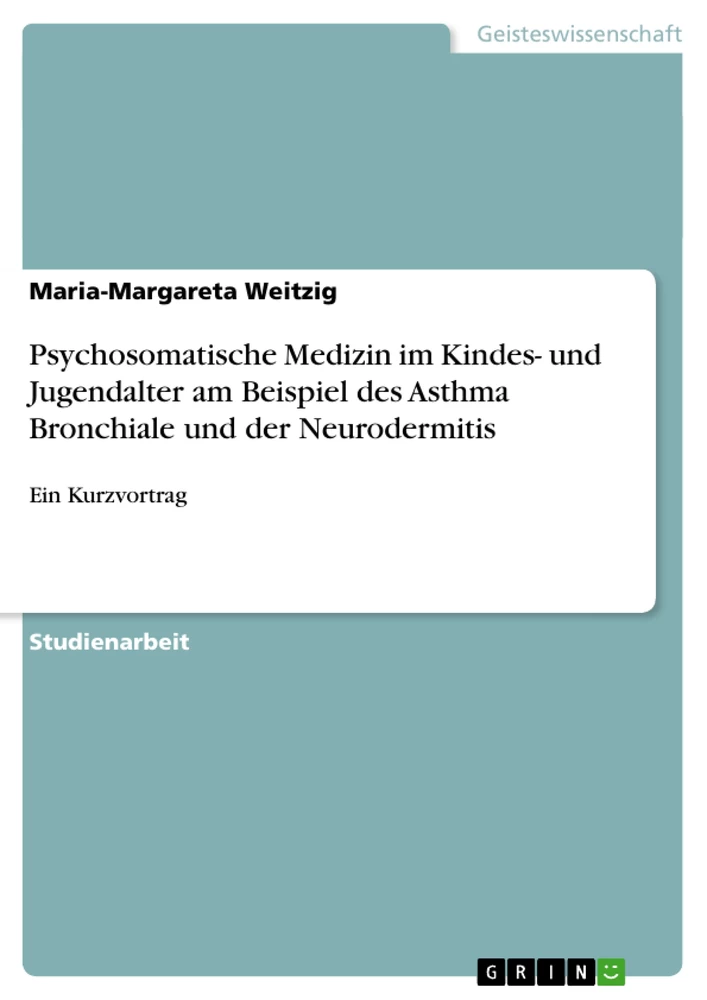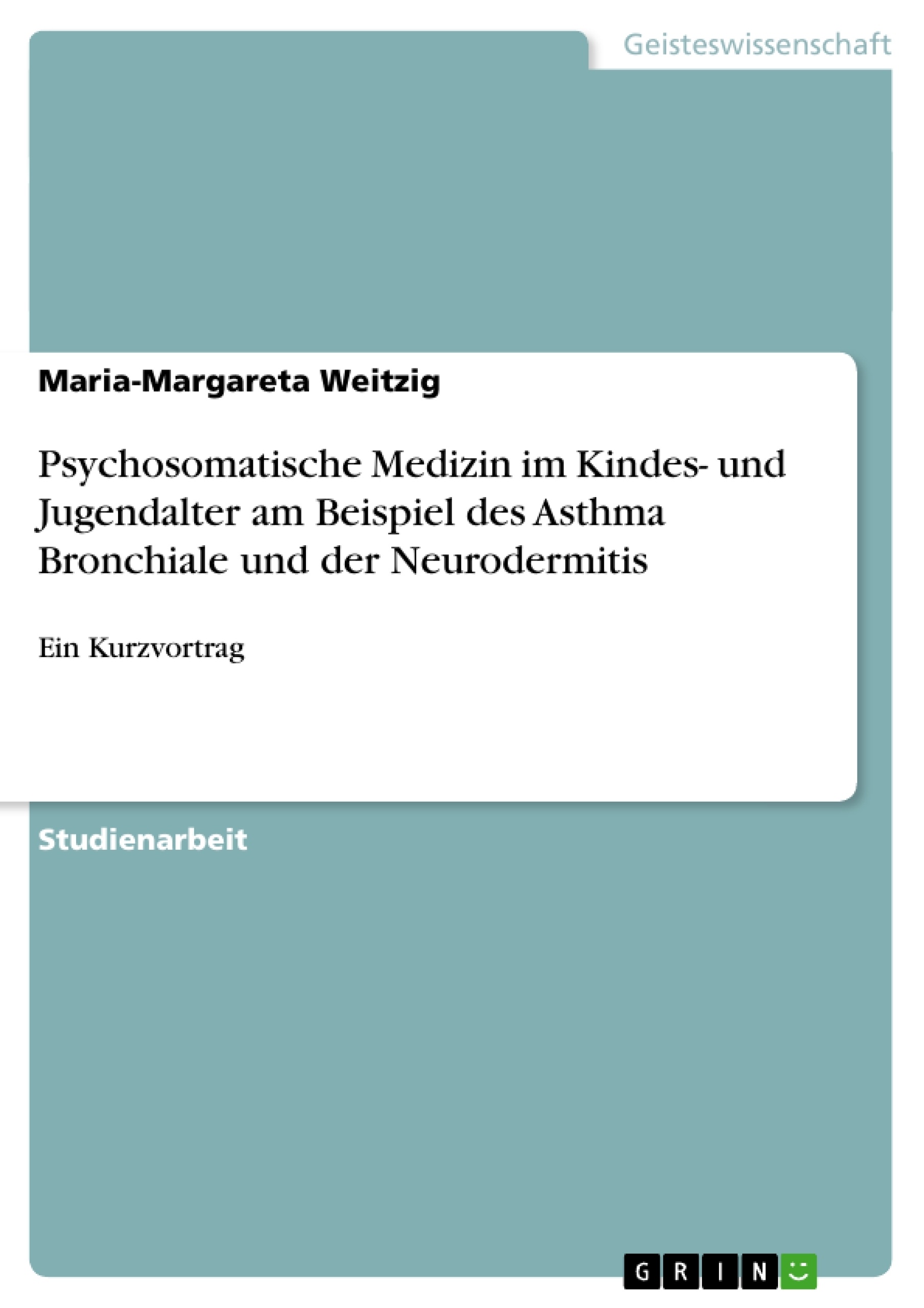1 Atopien
"Eine anlagemäßige vererbte Bereitschaft zur Überempfindlichkeit mit einer bestimmten Überreaktion wird Atopie genannt." (Sopko in:Uexküll 1996 S. 1122) -Griechisch - atopos-: nicht an einem festen Ort auftretend. Als "allergisch" werden in der Regel solche erworbenen körperlichen Reaktionen bezeichnet, die durch Vermittlung von Antikörpern oder immunkompetenten Zellen entstehen. Das Auftreten von Antikörpern oder immunkompetenten Zellen setzt eine vorherige Sensibilisierung voraus, d. h. das Immunsystem bildet spezifische Antikörper auf in den Organismus eingedrungene "Fremdstoffe", die in der Lage sind, bei erneutem Kontakt mit diesen Fremdstoffen zu reagieren. (z.B. Antikörperbildung nach Kinderkrankheiten) Im Falle der Immunität führt diese Auseinandersetzung zu einem Schutz, hingegen liegen die Dinge bei der Allergie umgekehrt: Primär unschädliche tolerierte Stoffe werden infolge von Reaktionen mit Antikörpern oder sensibilisierten T-Zellen pathogen und können zu Krankheitserscheinungen führen. Die allergische Reaktion manifestiert sich zunächst an demjenigen Organ, durch welches das Allergen in den Organismus gelangte, also Hautkontakt bewirkt Kontaktekzem, Nasenschleimhaut Fließschnupfen und Bronchialschleimhaut Asthma usw. Die Kontaktregel gilt jedoch nur unter Einschränkungen, es kann auch zu Fernreaktionen wie Arzneimittelallergien und Insektengiftallergien kommen oder die allergische Reaktion tritt generalisiert auf wie beim anaphylaktischem Schock. Es gibt Inhalationsallergene, Nahrungsmittelallergene, Parasitenallergene, Kontaktallergene, Arzneimittelallergene und weitere. Unter Atopie versteht man also eine konstitutionell erhöhte Bereitschaft, auf bestimmte Antigene mit der Bildung von Antikörpern zu reagieren. Bei diesen Antikörpern, sog. Reaginen, handelt es sich um Immunglobine des Typs E.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Atopien
- 2. Neurodermitis
- 2.1 Allgemeine Symptomatik
- 2.2 Psychosomatische Aspekte
- 2.3 Krankheitsauslösende Faktoren und Krankheitsverlauf
- 2.4 Therapie
- 3. Asthma Bronchiale
- 3.1 Krankheitsbild des Asthma bronchiale
- 3.2 Psychoanalytische Befunde
- 3.3 Psychosomatik
- 3.4 Therapie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die psychosomatischen Aspekte von atopischem Asthma bronchiale und Neurodermitis im Kindes- und Jugendalter. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen psychischen Faktoren und dem Krankheitsverlauf dieser Erkrankungen. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen genetischer Disposition, Umweltfaktoren und emotionalen Belastungen.
- Definition und Charakteristika von Atopien
- Psychosomatische Aspekte der Neurodermitis
- Einfluss psychischer Faktoren auf den Krankheitsverlauf
- Interaktion zwischen körperlichen und psychischen Symptomen
- Rollen von genetischer Veranlagung und Umweltfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Atopien: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in den Begriff der Atopie, definiert als eine vererbte Bereitschaft zu Überempfindlichkeitsreaktionen. Es erläutert den Unterschied zwischen allergischen Reaktionen und Atopie, wobei der Fokus auf der Bildung von Antikörpern (Immunglobuline vom Typ E) liegt. Der Text verdeutlicht, wie die ursprünglich für die Infektionsabwehr entwickelten Immunsysteme bei Atopien fehlreagieren und harmlose Stoffe als pathogen einstufen. Der genetische Aspekt wird hervorgehoben, wobei die familiäre Häufung von atopischen Erkrankungen (Ekzem, Asthma, Heuschnupfen) betont wird. Schließlich wird der Einfluss ungünstiger Verhaltensmuster auf die Aktivierung des endokrinen Systems und die Beeinträchtigung des Immunsystems diskutiert, was das Risiko für atopische Erkrankungen erhöht.
2. Neurodermitis: Dieses Kapitel behandelt die Neurodermitis (atopische Dermatitis) als häufigste Hauterkrankung mit psychischen Einflussfaktoren. Sie wird als Teil der Trias atopischer Erkrankungen (mit allergischer Rhinitis und Asthma bronchiale) beschrieben. Es wird betont, dass Neurodermitis keine primär allergische Erkrankung ist, sondern durch eine genetische Disposition (allergische Disposition, Immunglobulin-E-Überproduktion) ausgelöst wird und zu einer chronischen, das Kind und die Familie belastenden Krankheit führt. Der Text beschreibt die unterschiedlichen Symptome im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter, inklusive des quälenden Juckreizes und seiner Folgen (Schlafentzug, Konzentrationsschwäche). Die Symptomatik wird detailliert beschrieben, und der Einfluss auf die psychosoziale Entwicklung wird hervorgehoben.
2.2 Psychosomatische Aspekte: Dieser Abschnitt analysiert den psychosomatischen Aspekt der Neurodermitis. Die Haut als Sinnes- und Grenzorgan wird im Kontext der seelischen Entwicklung und Beziehungsentwicklung des Kindes beschrieben. Der chronische Juckreiz wird als ein Faktor dargestellt, der die Entwicklung innerseelischer Eigenständigkeit erschwert und Nähe-Distanz-Konflikte hervorrufen kann. Es wird jedoch betont, dass ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen spezifischen Persönlichkeitstypen, Konflikten oder Familienstrukturen und der Entstehung von Neurodermitis nicht bewiesen ist. Vielmehr wird ein komplexes Bedingungsgefüge von interagierenden Faktoren postuliert, wobei psychische Spannungszustände, sowohl positive als auch negative, die Neurodermitis auslösen, verschlimmern oder das Abheilen verhindern können. Der Abschnitt thematisiert die historische Fehlinterpretation der Neurodermitis als rein nervliche oder seelische Erkrankung und die überbetonte Rolle der Mutter in der psychoanalytischen Psychosomatik. Stattdessen wird ein heutiges Verständnis betont, das von einem komplexen Zusammenspiel von Faktoren ausgeht.
2.3 Krankheitsauslösende Faktoren und Krankheitsverlauf: Dieser Abschnitt befasst sich mit den krankheitsauslösenden Faktoren der Neurodermitis. Psychische Faktoren werden als wichtige Auslöser im Kontext der genetischen Disposition herausgestellt, wobei die individuelle Fallbezogenheit betont wird. Der Zusammenhang zwischen seelischer Belastung und Asthmaanfällen bzw. Neurodermitis-Exazerbationen wird beleuchtet, wobei die Haut als Stressindikator für das gesamte System beschrieben wird. Es wird jedoch klargestellt, dass weder psychische Störungen die körperliche Erkrankung verursachen noch umgekehrt. Allergie und emotionale Auslöser ergänzen sich in ihrer Wirkung, wobei die genetische Disposition durch äußere Faktoren (Klima, Kleidung etc.) und psychische Faktoren (die den Verlauf bestimmen) beeinflusst wird.
Schlüsselwörter
Atopie, Neurodermitis, Asthma bronchiale, Psychosomatik, Kindesalter, Jugendalter, psychische Faktoren, Krankheitsverlauf, genetische Disposition, Umweltfaktoren, Immunsystem, Haut, Juckreiz, Mutter-Kind-Beziehung, Stress, Allergie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Psychosomatische Aspekte von atopischem Asthma bronchiale und Neurodermitis im Kindes- und Jugendalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die psychosomatischen Aspekte von atopischem Asthma bronchiale und Neurodermitis im Kindes- und Jugendalter. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen psychischen Faktoren und dem Krankheitsverlauf dieser Erkrankungen. Es werden die komplexen Zusammenhänge zwischen genetischer Disposition, Umweltfaktoren und emotionalen Belastungen beleuchtet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Charakteristika von Atopien, psychosomatische Aspekte der Neurodermitis, den Einfluss psychischer Faktoren auf den Krankheitsverlauf, die Interaktion zwischen körperlichen und psychischen Symptomen, und die Rolle von genetischer Veranlagung und Umweltfaktoren. Sie beinhaltet Kapitel zu Atopien im Allgemeinen, Neurodermitis (inklusive allgemeiner Symptomatik, psychosomatischer Aspekte, krankheitsauslösender Faktoren und Therapie), und Asthma bronchiale (mit Krankheitsbild, psychoanalytischen Befunden, Psychosomatik und Therapie).
Was sind Atopien?
Atopien werden als eine vererbte Bereitschaft zu Überempfindlichkeitsreaktionen definiert. Es wird der Unterschied zwischen allergischen Reaktionen und Atopie erklärt, mit Fokus auf die Bildung von Immunglobulinen vom Typ E. Die Arbeit beschreibt, wie das Immunsystem bei Atopien fehlreagiert und harmlose Stoffe als pathogen einstuft. Der genetische Aspekt und der Einfluss ungünstiger Verhaltensmuster auf das endokrine System und das Immunsystem werden diskutiert.
Wie wird Neurodermitis beschrieben?
Neurodermitis (atopische Dermatitis) wird als häufigste Hauterkrankung mit psychischen Einflussfaktoren beschrieben, Teil der Trias atopischer Erkrankungen (mit allergischer Rhinitis und Asthma bronchiale). Es wird betont, dass Neurodermitis nicht primär allergisch ist, sondern durch genetische Disposition ausgelöst wird und zu einer chronischen Erkrankung führt. Die Arbeit beschreibt die Symptome im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter, den quälenden Juckreiz und dessen Folgen (Schlafentzug, Konzentrationsschwäche) und den Einfluss auf die psychosoziale Entwicklung.
Welche psychosomatischen Aspekte der Neurodermitis werden behandelt?
Dieser Abschnitt analysiert die Haut als Sinnes- und Grenzorgan im Kontext der seelischen und Beziehungsentwicklung des Kindes. Der chronische Juckreiz wird als Faktor dargestellt, der die Entwicklung innerseelischer Eigenständigkeit erschwert und Nähe-Distanz-Konflikte hervorrufen kann. Es wird betont, dass kein direkter kausaler Zusammenhang zwischen Persönlichkeitstypen, Konflikten oder Familienstrukturen und der Entstehung von Neurodermitis bewiesen ist. Stattdessen wird ein komplexes Bedingungsgefüge postuliert, wobei psychische Spannungszustände den Verlauf beeinflussen.
Welche Rolle spielen krankheitsauslösende Faktoren und der Krankheitsverlauf?
Psychische Faktoren werden als wichtige Auslöser im Kontext der genetischen Disposition herausgestellt. Der Zusammenhang zwischen seelischer Belastung und Asthmaanfällen bzw. Neurodermitis-Exazerbationen wird beleuchtet, wobei die Haut als Stressindikator beschrieben wird. Es wird klargestellt, dass weder psychische Störungen die körperliche Erkrankung verursachen noch umgekehrt. Allergie und emotionale Auslöser ergänzen sich in ihrer Wirkung, wobei die genetische Disposition durch äußere und psychische Faktoren beeinflusst wird.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Atopie, Neurodermitis, Asthma bronchiale, Psychosomatik, Kindesalter, Jugendalter, psychische Faktoren, Krankheitsverlauf, genetische Disposition, Umweltfaktoren, Immunsystem, Haut, Juckreiz, Mutter-Kind-Beziehung, Stress, Allergie.
- Quote paper
- Maria-Margareta Weitzig (Author), 2000, Psychosomatische Medizin im Kindes- und Jugendalter am Beispiel des Asthma Bronchiale und der Neurodermitis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20897