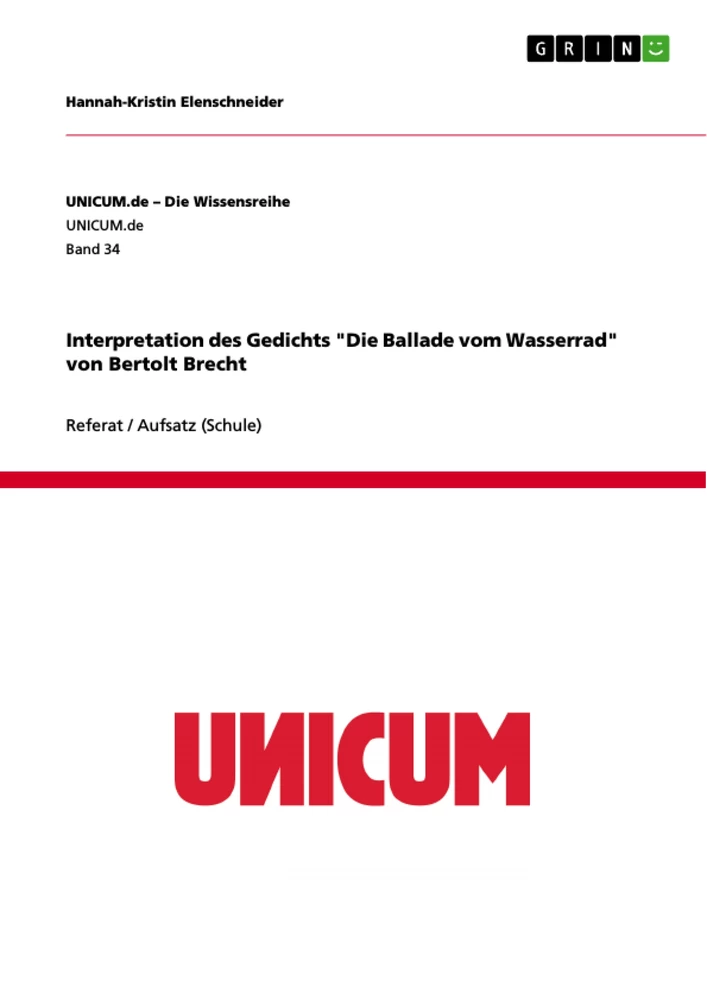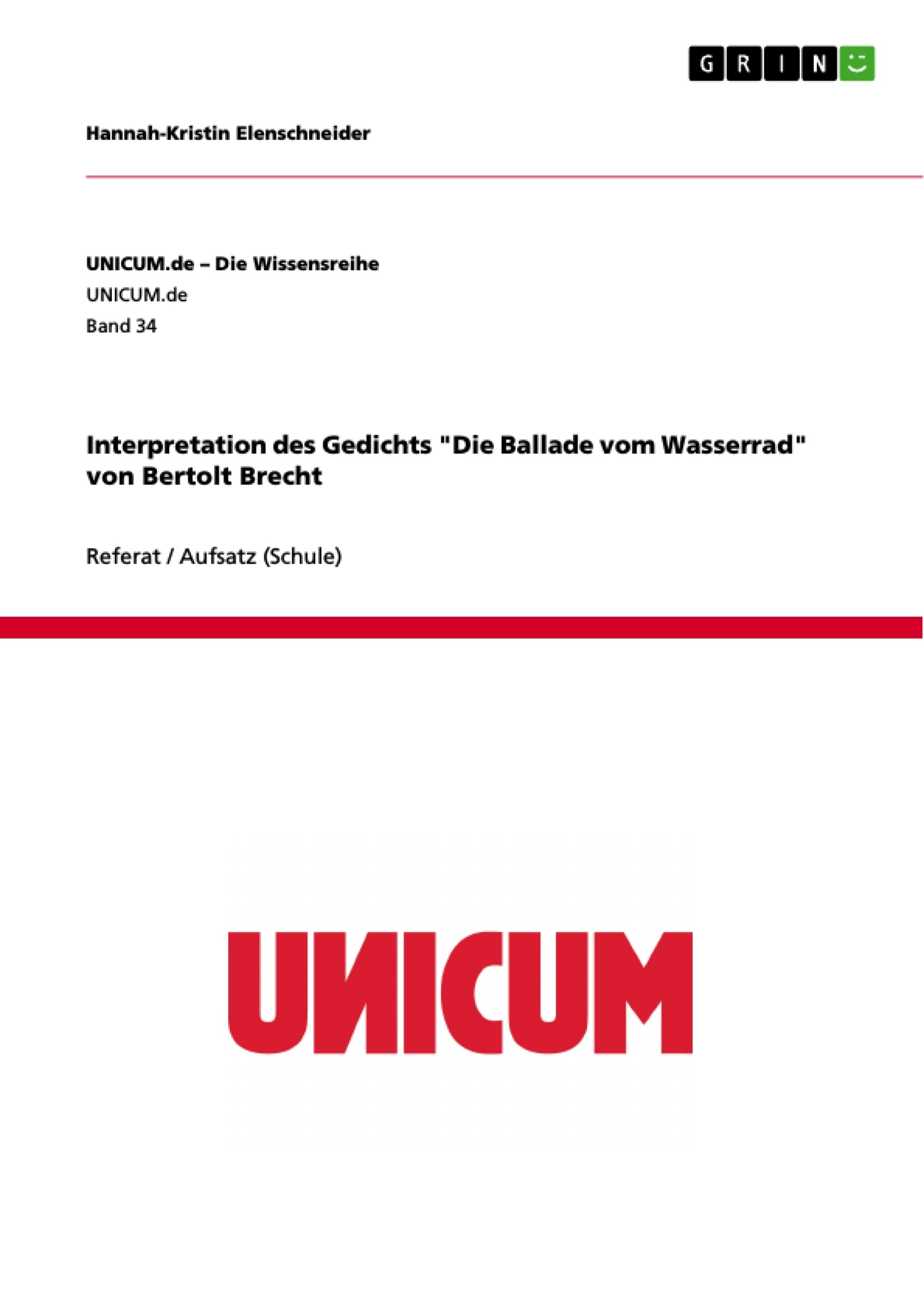A. Allgemeine Informationen
B. Interpretation des Gedichts "Die Ballade vom Wasserrad" von Bertolt Brecht
I. Beschreibung von Inhalt und Aufbau
1. Allgemein
2. 1. Strophe
3. 2. Strophe
4. 3. Strophe
5. Refrain
II. Untersuchung der formalen und sprachlich-stilistischen Gestaltung
1. Formale Gestaltung
1.1. Gedichtform
1.2. Strophenform
1.3. Versform
2. Sprache und Stil
2.1. Reim
2.2. Klangfiguren
2.3. Bildlichkeit
2.4. Wortwahl
2.5. Syntaktische Besonderheiten
III. Deutung
1. Position des lyrischen Ich
2. Motivik
C. Zusammenfassung
Inhaltsverzeichnis
- I. Das Gedicht „Die Ballade vom Wasserrad“
- 1. Aufbau und Inhalt
- 2. Erste Strophe
- 3. Zweite Strophe
- 4. Dritte Strophe
- 5. Der Refrain
- II. Formale Analyse
- 1. Aufbau und Reimschema
- 2. Sprache und Stil
- III. Lyrisches Ich und Motiv
- 1. Haltung des lyrischen Ich
- 2. Motiv des Gedichtes
- C. Intention des Autors
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Bertolt Brechts Gedicht „Die Ballade vom Wasserrad“ ist ein kritisches Werk, das die gesellschaftlichen Machtverhältnisse zwischen Herrschenden und Beherrschten analysiert. Die Ballade zeichnet ein Bild der Unterdrückung und des Klassenkampfes und plädiert gleichzeitig für eine revolutionäre Veränderung der bestehenden Strukturen.
- Das Verhältnis zwischen Mächtigen und Beherrschten
- Die Rolle des Volkes in der Geschichte
- Der Aufruf zur Revolution
- Die Bedeutung von Sprache und Stil
- Die symbolische Funktion des Wasserrads
Zusammenfassung der Kapitel
I. Das Gedicht „Die Ballade vom Wasserrad“
Die erste Strophe des Gedichts beschreibt die Herrscher als „Große“ (V. 1), die im Spiegel der Heldenlieder als auf- und untergehende „Gestirne“ (V. 3) dargestellt werden. Das lyrische Ich stellt jedoch die Situation des Volkes heraus, das die „Großen“ ernähren muss und unter den gleichen Bedingungen lebt: „Nur: für uns, die wir sie / nähren müssen / Ist das leider immer ziemlich gleich gewesen“ (V. 6f).
In der zweiten Strophe wird die Perspektive des Volkes eingenommen. Das lyrische Ich spricht von den Herrschern als „Herren“ (V. 13) und zeigt, wie sie vom Volk „genährt“ wurden (V. 16). Die Unterdrückung durch die Herrschenden wird deutlich, wenn das lyrische Ich fordert: „Daß wir / keine andern Herren brauchen, sondern keine!“ (V. 20).
Die dritte Strophe zeigt die Herrscher in ihrer gegenwärtigen Rolle. Sie kämpfen um die Beibehaltung ihrer Macht und bestrafen das Volk (V. 19). Das lyrische Ich spricht von den „sie“ (V. 25), die „wir (...) nicht mehr ernähren wollen“ (V. 31). Es wird deutlich, dass das Volk zum Subjekt der Geschichte wird und zum Klassenkampf greift, um eine klassenlose Gesellschaft zu erreichen.
II. Formale Analyse
Die Ballade ist durch ihren regelmäßigen Aufbau und den Refrain als ein liedhaftes Element am Ende jeder Strophe gekennzeichnet. Die Sprache ist einfach und schlicht, um die Botschaft der Revolution einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Gleichzeitig wird sie durch rhetorische Figuren wie Wiederholungen, Anaphern und Vergleiche verstärkt.
III. Lyrisches Ich und Motiv
Das lyrische Ich des Gedichts vermittelt seine Beobachtungen über das Verhältnis von Volk und Herrschenden und will zur Revolution anregen. Es spricht im Namen des Volkes und identifiziert sich mit dessen Leid: „Ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer / Und / uns trat er“ (V. 18f).
Das zentrale Motiv des Gedichts ist das Wasserrad. Das „Rad“ (V. 9) symbolisiert den ewigen Kreislauf der Herrscher, während das „Wasser“ (V. 11) für das Volk steht, dessen Leben sich nicht verändert. Dieses Motiv findet seinen Ausdruck im Refrain, der die Dialektik von „oben“ (V. 10) und „unten“ (V. 11) verkörpert.
Schlüsselwörter
Das Gedicht „Die Ballade vom Wasserrad“ behandelt Themen wie gesellschaftliche Machtverhältnisse, Klassenkampf, Revolution, Unterdrückung und Freiheit. Es greift auf Symbole wie das Wasserrad, das Volk, die Herrscher, das „Oben“ und das „Unten“ zurück, um diese Themen zu veranschaulichen. Die Sprache des Gedichts ist einfach und schlicht, dennoch verwendet Brecht rhetorische Figuren, um seine Botschaft zu verstärken und den Leser zum Nachdenken anzuregen.
- Quote paper
- Hannah-Kristin Elenschneider (Author), 2003, Interpretation des Gedichts "Die Ballade vom Wasserrad" von Bertolt Brecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208660