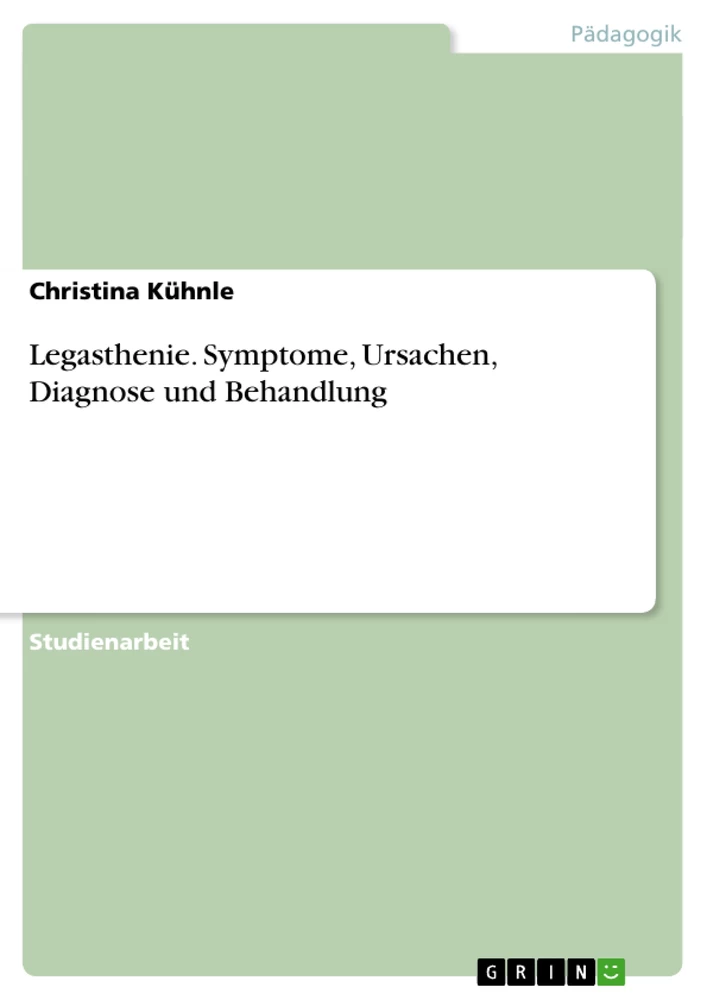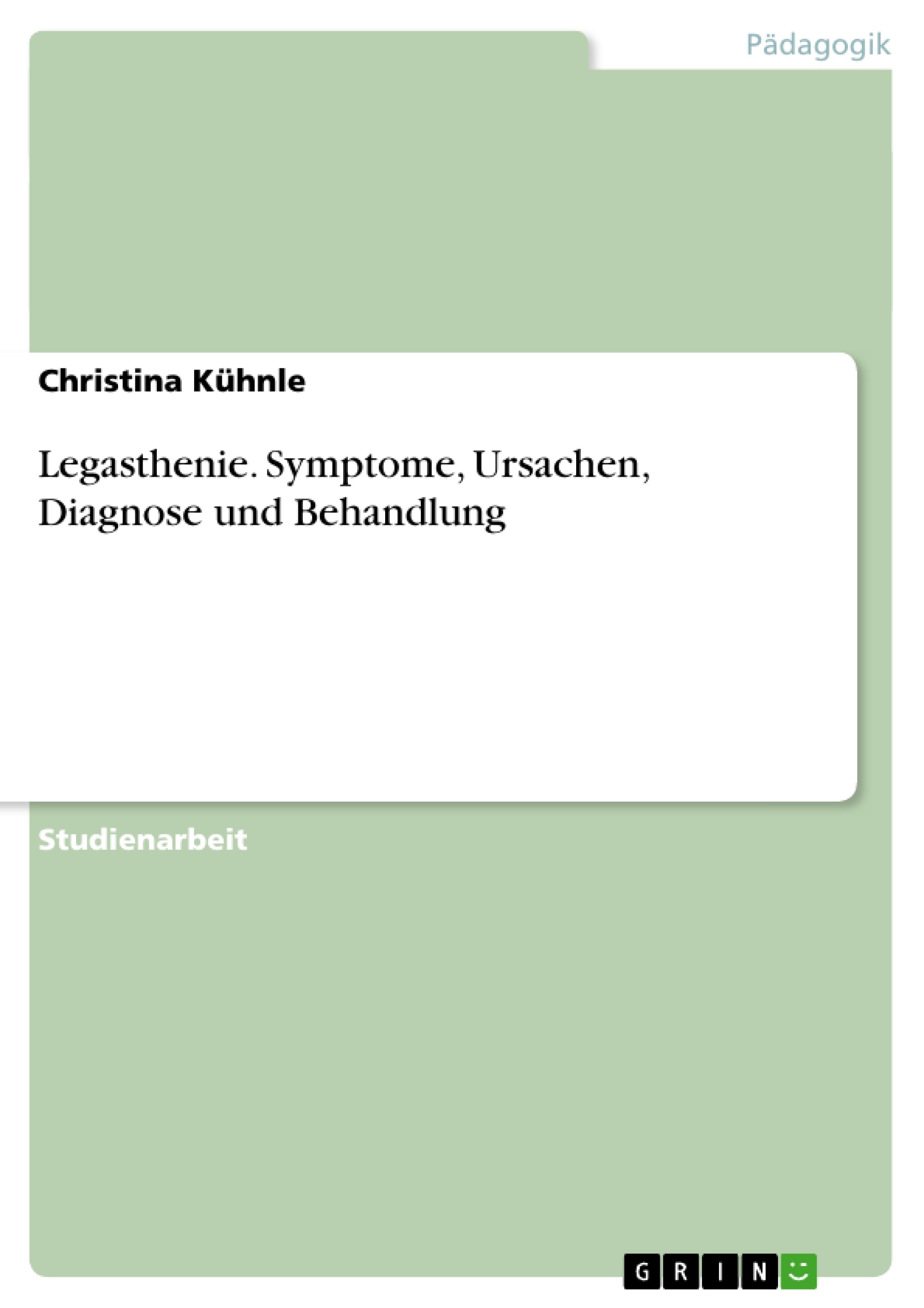Eine der wichtigsten Kulturtechniken, die Kinder erlernen müssen, ist die Sprache in Schrift und Wort. Die Schule ist dafür verantwortlich, dies zu erlernen und zu festigen. Entscheidende Faktoren für ein soziales, berufliches und kulturelles Gesamtbild sind Sprachverständnis, Sprachbeherrschung sowie der kreative Umgang mit Sprache. Einige durchaus intelligente Kinder jedoch wollen diese Kulturtechnik nicht erlernen. Der Hintergrund dafür liegt oft in der Lese- und/oder Rechtschreibschwäche bzw. Legasthenie begründet. Sie ist ein weites und in vieler Hinsicht ein noch relativ unerforschtes Gebiet.
Seit vielen Jahren beschäftigt man sich mit den Symptomen, Ursachen und Fördermaßnahmen von Legasthenie, und doch kommt man immer wieder zu neuen Erkenntnissen und die Forschungsarbeiten sind noch lange nicht abgeschlossen. Zunächst waren es ausnahmslos Mediziner die sich mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten befassten und dieses Phänomen „Wortblindheit" nannten. Betroffene Personen konnten nämlich bildliche Darstellungen ohne weiteres beim Namen nennen, jedoch hatten sie Schwierigkeiten Buchstaben oder einfache Wörter zu benennen.
Der Begriff Legasthenie wurde 1916 von Ranschburg entwickelt, er war der erste Pädagoge, der sich mit der LRS bei Schulkindern befasste. Für Ranschburg stand fest, dass Schüler mit Lernschwierigkeiten dieser Art auf Hilfsschulen gehörten. Legasthenie war für ihn eine nachhaltige Rückständigkeit höheren Grades in der geistigen Entwicklung des Kindes. Daher wurden Kinder mit Legasthenie bis in die siebziger Jahre hinein zu Schülern abgestempelt, die nur auf Hilfsschulen gefördert werden können. Ein besonderes Kriterium war die mangelnde Lesefertigkeit. Diese Thesen von Ranschburg sind bis heute noch das Verhängnis vieler Schüler. Denn noch immer herrscht die Meinung vor, dass Kinder, die nicht richtig Lesen und Schreiben können, nicht aufs Gymnasium gehören. Selbst Erwachsene Analphabeten werden noch vielfach für dumm gehalten.
Neuere Untersuchungen gelangten durch die kriegsbedingte Isolierung nicht bis nach Deutschland vor. 1951 erst entfachte die Schweizer Psychologin M. Linder, die Diskussionen neu, indem sie Kinder mit Legasthenie auf deren Intelligenz untersuchte. Sie kam zu dem Ergebnis, dass diese durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligent sind. Durch diese Erkenntnisse gelang es Legastheniker aus ihrer Isolierung hervorzuholen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Geschichte der Legasthenie
- 2. Definition / Begriffsbestimmung
- 3. Erscheinungsbilder und Symptome
- 3.1 Erscheinungsbilder im Vorschulalter
- 3.2 Erscheinungsbilder in der Grundschule
- a) Optisch-graphomotorischer Bereich
- b) Akustisch-phonematischer Bereich
- c) Kinästhetischer Bereich
- d) Rhythmischer Bereich
- e) Melodischer Bereich
- 3.3 Symptome
- 4. Ursachen
- 5. Diagnose
- 5.1 Diagnostische Leistungsprüfungen in der Grundschule
- 5.2 Tests zu Untersuchungen, die auf allen Schul- und Altersstufen durchgeführt werden können
- 6. Förderung / Behandlung und Übungen
- 6.1 Förderung
- 6.2 Übungen
- a) Optisch-graphomotorischer Bereich
- b) Akustisch-phonematischer Bereich
- c) Kinästhetischer Bereich
- d) Rhythmischer Bereich
- e) Melodischer Bereich
- 7. Aufgaben für Lehrer und Lehrerinnen
- 7.1 Einige praktische Ideen für den Unterricht
- 8. Abschluss
- 9. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Legasthenie, einer Lese-Rechtschreib-Schwäche. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Legasthenie zu vermitteln, von ihren historischen Wurzeln und Definitionen über ihre Erscheinungsbilder und Ursachen bis hin zu diagnostischen Verfahren und Fördermaßnahmen. Der Fokus liegt auf der Unterstützung von Lehrkräften im Umgang mit betroffenen Schülern.
- Historische Entwicklung des Verständnisses von Legasthenie
- Definition und Abgrenzung der Legasthenie
- Erscheinungsbilder und Symptome im Kindesalter
- Diagnostik und Fördermöglichkeiten
- Praktische Hilfestellungen für den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Geschichte der Legasthenie: Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Schriftsprache als Kulturtechnik und führt in das Thema Legasthenie ein. Sie beschreibt Legasthenie als ein komplexes und noch nicht vollständig erforschtes Gebiet. Die historischen Perspektiven zeigen die Entwicklung des Verständnisses von Legasthenie, von der anfänglichen Bezeichnung als „Wortblindheit“ bis hin zu neueren Erkenntnissen, die die Intelligenz von Legasthenikern betonen. Der Text verdeutlicht, wie sich die Sichtweise auf Legasthenie und die damit verbundenen Fördermaßnahmen im Laufe der Zeit verändert haben und wie Vorurteile bis heute bestehen bleiben. Die Einführung betont die Bedeutung weiterer Forschung und die Entwicklung effektiver Fördermaßnahmen.
2. Definition / Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Definitionen von Legasthenie (Lese-Rechtschreib-Schwäche), die sich auf die Beeinträchtigung der Lese- und Schreibfertigkeit bei normaler Intelligenz konzentrieren. Es werden unterschiedliche Perspektiven von Fachleuten vorgestellt, die Legasthenie als Störung des Rekodierungsmechanismus oder als Desorientierung beschreiben, welche die normale Sinneswahrnehmung beeinflusst. Die Vielfältigkeit der Definitionen unterstreicht die Komplexität des Phänomens und die Schwierigkeiten bei der eindeutigen Abgrenzung. Der Text betont, dass Lese- und Rechtschreibschwächen auf allen Intelligenzniveaus auftreten können und langfristige Auswirkungen haben können.
3. Erscheinungsbilder & Symptome: Das Kapitel beschreibt die vielfältigen Erscheinungsbilder und Symptome von Legasthenie, die sich oft zwischen dem zweiten und vierten Schuljahr deutlich zeigen. Es werden mögliche Beobachtungen im Vorschulalter (z.B. später Spracherwerb, Schwierigkeiten beim Nachsprechen, motorische Unsicherheiten) diskutiert, die als Risikofaktoren, aber nicht als sichere Indikatoren für eine spätere Lese-Rechtschreib-Schwäche gelten. Der Fokus liegt auf der Darstellung der unterschiedlichen Erscheinungsformen der LRS in verschiedenen Bereichen (optisch-graphomotorisch, akustisch-phonematischer etc.) im Grundschulalter. Die Zusammenfassung der Symptome im Grundschulalter umfasst Bereiche wie die Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben, dem Umgang mit Rhythmus und Melodie.
Schlüsselwörter
Legasthenie, Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS), Wortblindheit, Definition, Erscheinungsbilder, Symptome, Ursachen, Diagnose, Förderung, Behandlung, Übungen, Schulunterricht, Intelligenz, Risikofaktoren, Diagnostische Tests.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Legasthenie: Ein umfassender Überblick"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Legasthenie (Lese-Rechtschreib-Schwäche). Es beinhaltet eine Einleitung mit der Geschichte des Verständnisses von Legasthenie, Definitionen des Begriffs, Erscheinungsbilder und Symptome im Kindesalter (einschließlich Vorschulalter und Grundschulalter, unterteilt nach optisch-graphomotorischen, akustisch-phonematischer, kinästhetischer, rhythmischer und melodischer Bereiche), Ursachen, Diagnosemethoden (mit Fokus auf diagnostische Leistungsprüfungen und Tests), Förder- und Behandlungsmöglichkeiten sowie Übungen (ebenfalls unterteilt in die genannten Bereiche). Zusätzlich werden Aufgaben für Lehrer und Lehrerinnen mit praktischen Ideen für den Unterricht vorgestellt. Das Dokument schließt mit einem Literaturverzeichnis ab. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Lehrkräften im Umgang mit betroffenen Schülern.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in folgende Kapitel gegliedert: 1. Einleitung und Geschichte der Legasthenie, 2. Definition / Begriffsbestimmung, 3. Erscheinungsbilder und Symptome (mit Unterkapiteln für Vorschulalter und Grundschulalter, sowie Unter-Unterkapiteln für verschiedene Bereiche), 4. Ursachen, 5. Diagnose (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Testverfahren), 6. Förderung / Behandlung und Übungen (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Übungsformen), 7. Aufgaben für Lehrer und Lehrerinnen, 8. Abschluss, 9. Literaturverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Ziel des Dokuments ist es, ein umfassendes Verständnis von Legasthenie zu vermitteln. Es soll Lehrkräfte und andere Interessierte über die verschiedenen Aspekte von Legasthenie informieren, von den historischen Wurzeln und Definitionen bis hin zu den aktuellsten diagnostischen Verfahren und Fördermaßnahmen. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Anwendung des Wissens im Schulunterricht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind: die historische Entwicklung des Verständnisses von Legasthenie, genaue Definitionen und Abgrenzungen, Erscheinungsbilder und Symptome im Kindesalter, Diagnostik und verschiedene Fördermöglichkeiten, sowie praktische Hilfestellungen für den Unterricht.
Wie werden die Symptome von Legasthenie beschrieben?
Die Symptome werden detailliert beschrieben, unterteilt nach Altersgruppen (Vorschulalter und Grundschulalter) und Bereichen (optisch-graphomotorisch, akustisch-phonematischer, kinästhetischer, rhythmischer und melodischer Bereich). Im Vorschulalter werden beispielsweise später Spracherwerb, Schwierigkeiten beim Nachsprechen und motorische Unsicherheiten genannt. Im Grundschulalter werden Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben, im Umgang mit Rhythmus und Melodie detailliert erläutert.
Welche Förder- und Behandlungsmöglichkeiten werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt allgemeine Fördermöglichkeiten und bietet konkrete Übungsvorschläge, die nach den gleichen Bereichen gegliedert sind wie die Beschreibung der Symptome (optisch-graphomotorisch, akustisch-phonematischer, kinästhetischer, rhythmischer und melodischer Bereich). Es geht jedoch nicht in die Tiefe der einzelnen Therapiemethoden.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich in erster Linie an Lehrkräfte, die Schüler mit Legasthenie unterrichten. Es kann aber auch für Eltern, Studenten der Pädagogik und alle anderen Interessierten nützlich sein, die mehr über Legasthenie lernen möchten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Legasthenie, Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS), Wortblindheit, Definition, Erscheinungsbilder, Symptome, Ursachen, Diagnose, Förderung, Behandlung, Übungen, Schulunterricht, Intelligenz, Risikofaktoren, Diagnostische Tests.
- Quote paper
- Christina Kühnle (Author), 2002, Legasthenie. Symptome, Ursachen, Diagnose und Behandlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20852