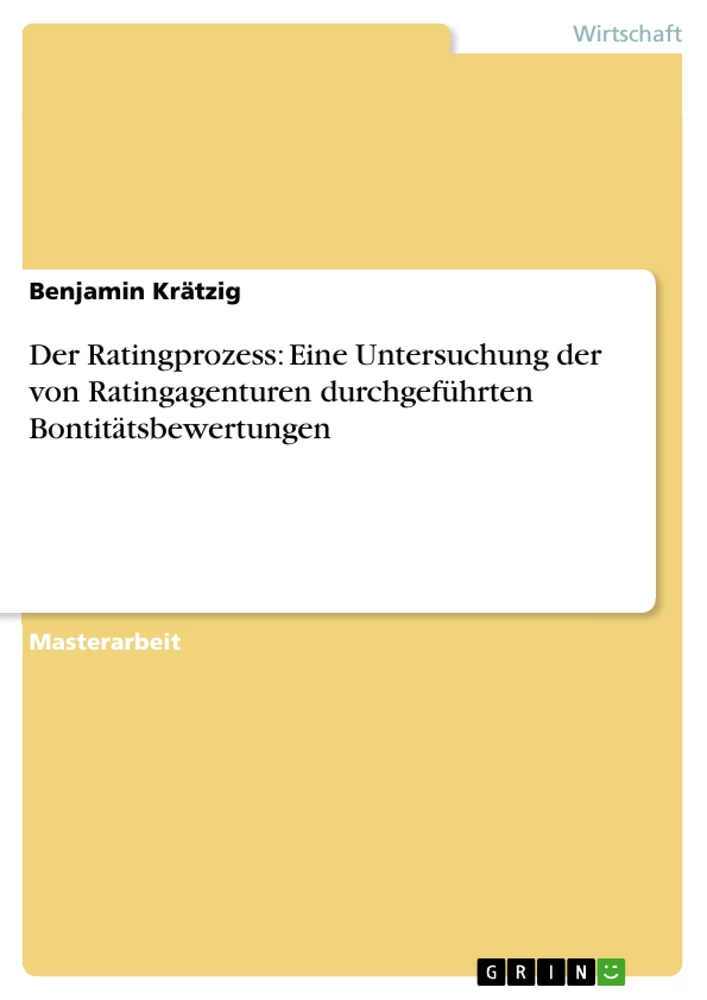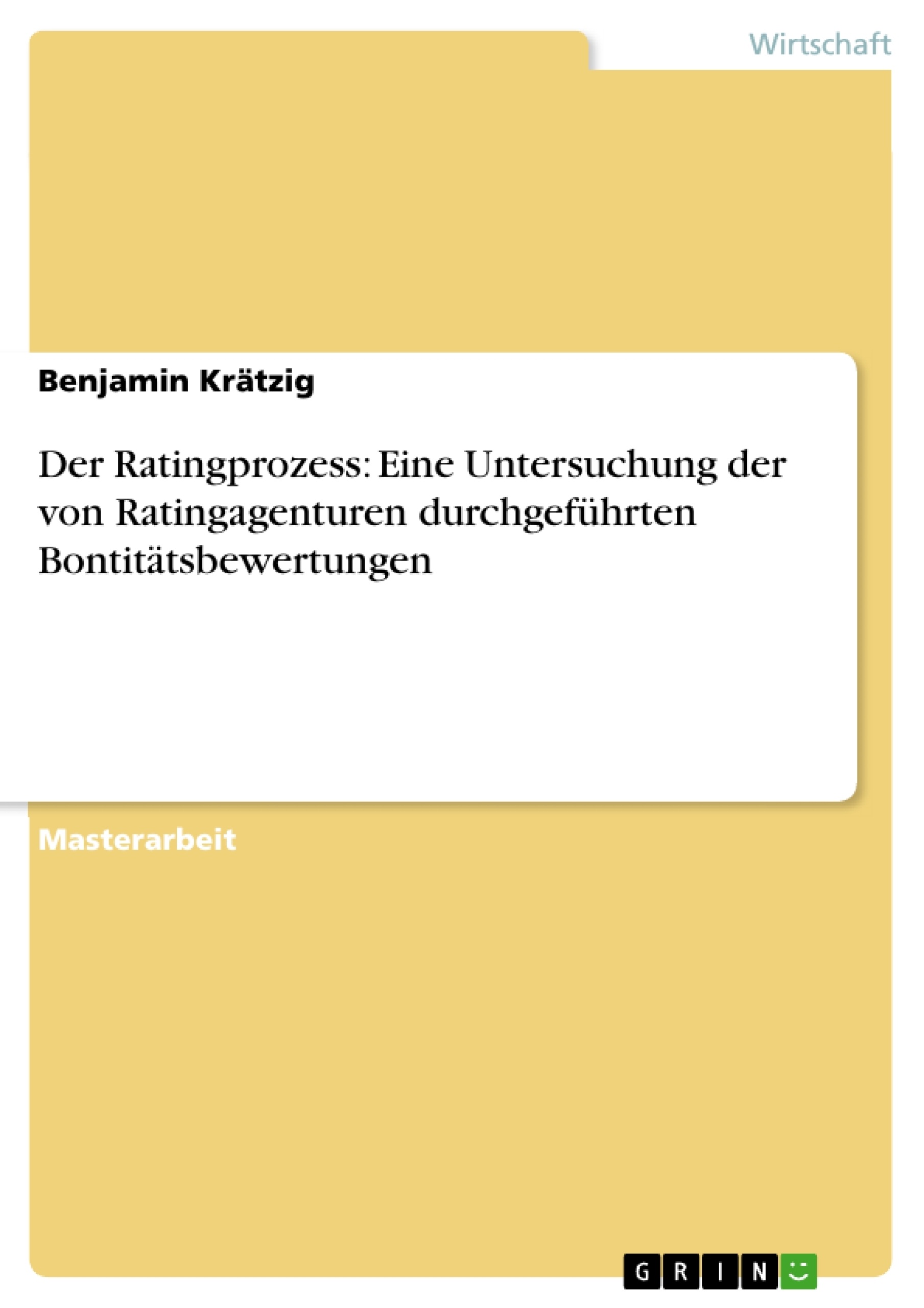Gerade in der heutigen Zeit besitzen Ratingagenturen teilweise einen schlechten Ruf, welcher insbesondere seit Beginn der Finanzkrise 2007 stark gelitten hat. Damals hatten die großen drei Ratingagenturen Standard & Poor´s (S&P), Moody´s Investors Services (Moody´s) und Fitch Ratings (Fitch) hypothekenbesicherte Wertpapiere (sog. CDOs) vielfach zu optimistisch bewertet und damit die Finanz- und spätere Wirtschaftskrise mit zu verantworten. Heutzutage stehen sie in der Kritik, weil sie europäische Staaten reihenweise abwerten und sich diese infolgedessen nur noch teuer refinanzieren können. Dieser Umstand trägt seinen Teil dazu bei, dass einige Staaten immer höhere Schulden anhäufen und infolgedessen an den Rand der Zahlungsunfähigkeit geraten. Zudem wird den Ratingagenturen vorgeworfen, sich europafeindlich zu verhalten und eher im Sinne der USA zu agieren.
Es stellt sich also die Frage, nach welchen Gesichtspunkten ein Rating vergeben wird. Welche Komponenten spielen bei der Bewertung von Unternehmen, Unternehmensanleihen und Staaten eine Rolle? Wie kommen solche Bewertungen zustande? Welche Bewertungsmethoden werden dabei verwendet? Agieren Ratingagenturen tatsächlich autonom und objektiv oder werden sie durch irgendwelche Faktoren in ihrer Bewertung beeinflusst?
Solche und ähnliche Fragen sollen im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden mit dem Ziel, den Prozess der Bonitätsbewertung zu durchleuchten und darzulegen, wie ein Ratingurteil letztlich zustande kommt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Gliederung
- 1.3 Ratingagenturen als mögliche Auslöser von Krisen
- 2 Grundlagen
- 2.1 Gegenstand und Problematik eines Ratings
- 2.1.1 Der Ratingbegriff
- 2.1.2 Probleme und Gefahren bei der Durchführung eines Ratings
- 2.1.2.1 Das Agency – Problem
- 2.1.2.2 Weitere Probleme
- 2.1.2.3 Fehler bei der kategorialen Insolvenzprognose
- 2.2 Die bedeutendsten Ratingagenturen und deren jeweiligen Ratingklassen
- 2.3 Der Zusammenhang zwischen Ratingklasse und Ausfallwahrscheinlichkeit
- 2.3.1 Ausfallquote und Ausfallwahrscheinlichkeit
- 2.3.2 Ratings im Zeitablauf mit Hilfe von Migrationsmatrizen
- 2.1 Gegenstand und Problematik eines Ratings
- 3 Der externe Bewertungsprozess bei Ratingagenturen
- 3.1 Überblick über den Ablauf des externen Ratingprozesses
- 3.2 Die Ratingkriterien
- 3.2.1 Länderrisiko
- 3.2.2 Branchenrisiko
- 3.2.3 Unternehmensrisiko
- 3.2.3.1 Wettbewerbssituation
- 3.2.3.2 Managementqualität
- 3.2.3.3 Finanzsituation
- 3.2.3.3.1 Hybride Finanzinstrumente
- 3.2.3.3.2 Pensionsverpflichtungen
- 3.3 Bewertung und Verknüpfung der Kriterien
- 3.4 Veröffentlichung des Ratings und seine fortlaufende Überwachung
- 4 Methoden der Bonitätsbewertung
- 4.1 Qualitative Analyse
- 4.2 Quantitative Analyse
- 4.2.1 Das Z-Modell im Rahmen der statistischen Analyse
- 4.2.1.1 Die Diskriminanzfunktion des Z-Modells und ihre Komponenten
- 4.2.1.2 Erläuterungen der Kennzahlen
- 4.2.1.3 Entscheidungsregel und Güte des Modells
- 4.2.1.4 Kritische Würdigung
- 4.2.2 Das Optionspreismodell als kausalanalytische Insolvenzprognose
- 4.2.2.1 Annahmen
- 4.2.2.2 Die Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit
- 4.2.2.3 Der Zusammenhang zwischen der Ausfallwahrscheinlichkeit und der Distance-to-Default
- 4.2.1 Das Z-Modell im Rahmen der statistischen Analyse
- 4.3 Moody's KMV Expected Default Frequency RiskCale v3.1 Modell
- 4.3.1 Das Modell und seine Komponenten
- 4.3.2 Erläuterung der Variablen und deren Abbildung auf die Ausfallwahrscheinlichkeit
- 4.3.3 Die Gewichtung der Variablen
- 4.3.4 Branchenanpassungen
- 4.3.5 Anpassungen an den Kreditvergabezyklus
- 5 Moody's Ratinganalyse am Beispiel der Automobilindustrie
- 5.1 Erläuterung der Haupt- und Unterfaktoren und deren Hinführung zum Rating
- 5.1.1 Marktposition & Trend
- 5.1.2 Verschuldungsgrad & Liquidität
- 5.1.3 Profitabilität & Gewinn
- 5.1.4 Kapitalfluss & Kapitaldienst
- 5.2 Annahmen, Beschränkungen und die in den Hauptfaktoren nicht berücksichtigten Kriterien
- 5.3 Umsetzung und Veranschaulichung von Moody's vereinfachter Ratinganalyse am Beispiel der Volkswagen AG
- 5.3.1 Marktposition & Trend
- 5.3.2 Verschuldungsgrad & Liquidität
- 5.3.3 Profitabilität & Gewinn
- 5.3.4 Kapitalfluss & Kapitaldienst
- 5.3.5 Hinführung zum abschließenden Rating
- 5.1 Erläuterung der Haupt- und Unterfaktoren und deren Hinführung zum Rating
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Prozess der Bonitätsbewertung durch Ratingagenturen. Ziel ist es, die Methodik der Bewertung, die involvierten Risiken und die möglichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte des Ratingprozesses, von den zugrundeliegenden theoretischen Grundlagen bis hin zur praktischen Anwendung anhand eines Fallbeispiels.
- Analyse des Ratingprozesses und der verwendeten Methoden
- Bewertung der Risiken und Probleme im Zusammenhang mit Ratings
- Untersuchung des Einflusses von Ratingagenturen auf die Finanzmärkte
- Anwendung der Ratingmethodik anhand eines Fallbeispiels
- Kritische Auseinandersetzung mit den verwendeten Modellen und Annahmen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bonitätsbewertung durch Ratingagenturen ein, beschreibt die Motivation der Arbeit und skizziert den Aufbau der Untersuchung.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel erläutert den Begriff des Ratings, beschreibt die Problematik und Gefahren, die mit der Erstellung von Ratings verbunden sind, und stellt die wichtigsten Ratingagenturen und deren Ratingklassen vor. Es wird der Zusammenhang zwischen Ratingklasse und Ausfallwahrscheinlichkeit detailliert beleuchtet, inklusive einer Analyse von Ausfallquoten und der Verwendung von Migrationsmatrizen zur Darstellung des Ratings im Zeitablauf. Der Abschnitt beschreibt das "Agency-Problem" und mögliche Fehler bei der Insolvenzprognose.
3 Der externe Bewertungsprozess bei Ratingagenturen: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf des externen Ratingprozesses, die verwendeten Ratingkriterien (Länderrisiko, Branchenrisiko, Unternehmensrisiko mit seinen Unterpunkten Wettbewerbssituation, Managementqualität und Finanzsituation, inklusive hybrider Finanzinstrumente und Pensionsverpflichtungen) und die Bewertung sowie Verknüpfung dieser Kriterien. Die Veröffentlichung des Ratings und die fortlaufende Überwachung werden ebenfalls behandelt.
4 Methoden der Bonitätsbewertung: Dieses Kapitel vergleicht qualitative und quantitative Analysemethoden der Bonitätsbewertung. Im Detail werden das Z-Modell, das Optionspreismodell und das Moody's KMV Expected Default Frequency RiskCale v3.1 Modell erläutert. Für jedes Modell werden die Komponenten, Variablen und deren Gewichtung, sowie die Anwendung und kritische Würdigung dargestellt. Die Kapitel befasst sich mit der Insolvenzschwelle und dem Zusammenhang zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit und Distance-to-Default.
5 Moody's Ratinganalyse am Beispiel der Automobilindustrie: Dieses Kapitel wendet die Moody's Ratinganalyse auf die Automobilindustrie an. Es erläutert die Haupt- und Unterfaktoren (Marktposition & Trend, Verschuldungsgrad & Liquidität, Profitabilität & Gewinn, Kapitalfluss & Kapitaldienst) und deren Bedeutung für das Rating. Anhand der Volkswagen AG wird eine vereinfachte Ratinganalyse durchgeführt und veranschaulicht. Das Kapitel diskutiert die Annahmen und Beschränkungen des Modells.
Schlüsselwörter
Ratingagenturen, Bonitätsbewertung, Ausfallwahrscheinlichkeit, Kreditrisiko, Finanzanalyse, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse, Z-Modell, Optionspreismodell, Moody’s KMV Modell, Agency-Problem, Automobilindustrie, Volkswagen AG.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Bonitätsbewertung durch Ratingagenturen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit analysiert den Prozess der Bonitätsbewertung durch Ratingagenturen. Sie untersucht die Methodik der Bewertung, die damit verbundenen Risiken und die Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Ein besonderer Fokus liegt auf der Anwendung der Methodik anhand eines Fallbeispiels aus der Automobilindustrie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter:
- Eine detaillierte Analyse des Ratingprozesses und der verwendeten Methoden.
- Eine Bewertung der Risiken und Probleme im Zusammenhang mit Ratings, einschließlich des "Agency-Problems".
- Eine Untersuchung des Einflusses von Ratingagenturen auf die Finanzmärkte.
- Eine praktische Anwendung der Ratingmethodik anhand eines Fallbeispiels (Volkswagen AG).
- Eine kritische Auseinandersetzung mit den verwendeten Modellen und Annahmen.
Welche Modelle der Bonitätsbewertung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Modelle der Bonitätsbewertung, darunter:
- Qualitative und quantitative Analysemethoden.
- Das Z-Modell im Rahmen der statistischen Analyse.
- Das Optionspreismodell als kausalanalytische Insolvenzprognose.
- Das Moody's KMV Expected Default Frequency RiskCale v3.1 Modell.
Für jedes Modell werden die Komponenten, Variablen, Gewichtung und Anwendung detailliert erläutert und kritisch bewertet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel:
- Einleitung: Motivation, Gliederung und die Rolle von Ratingagenturen als mögliche Krisenauslöser.
- Grundlagen: Ratingbegriff, Probleme und Gefahren von Ratings, bedeutende Ratingagenturen und der Zusammenhang zwischen Ratingklasse und Ausfallwahrscheinlichkeit.
- Der externe Bewertungsprozess: Ablauf des Prozesses, Ratingkriterien (Länderrisiko, Branchenrisiko, Unternehmensrisiko), Bewertung und Verknüpfung der Kriterien, Veröffentlichung und Überwachung.
- Methoden der Bonitätsbewertung: Qualitative und quantitative Analysemethoden, detaillierte Erklärung der oben genannten Modelle.
- Moody's Ratinganalyse am Beispiel der Automobilindustrie: Anwendung der Moody's Analyse auf die Automobilindustrie, vereinfachte Ratinganalyse der Volkswagen AG.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Ratingagenturen, Bonitätsbewertung, Ausfallwahrscheinlichkeit, Kreditrisiko, Finanzanalyse, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse, Z-Modell, Optionspreismodell, Moody’s KMV Modell, Agency-Problem, Automobilindustrie, Volkswagen AG.
Welches Fallbeispiel wird verwendet?
Die Arbeit verwendet die Volkswagen AG als Fallbeispiel, um die Moody's Ratinganalyse in der Automobilindustrie zu veranschaulichen.
Welche Aspekte des Ratings werden kritisch beleuchtet?
Die Arbeit unterzieht die verwendeten Modelle und Annahmen einer kritischen Prüfung. Besondere Aufmerksamkeit wird dem "Agency-Problem" und möglichen Fehlern bei der Insolvenzprognose gewidmet.
- Quote paper
- Benjamin Krätzig (Author), 2012, Der Ratingprozess: Eine Untersuchung der von Ratingagenturen durchgeführten Bontitätsbewertungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208416