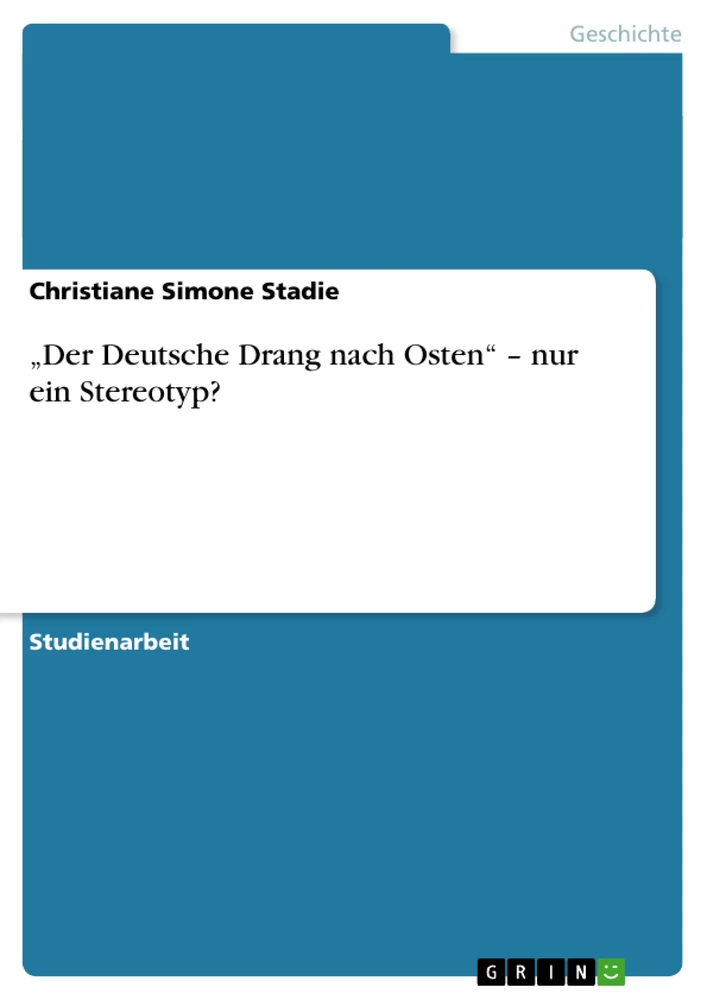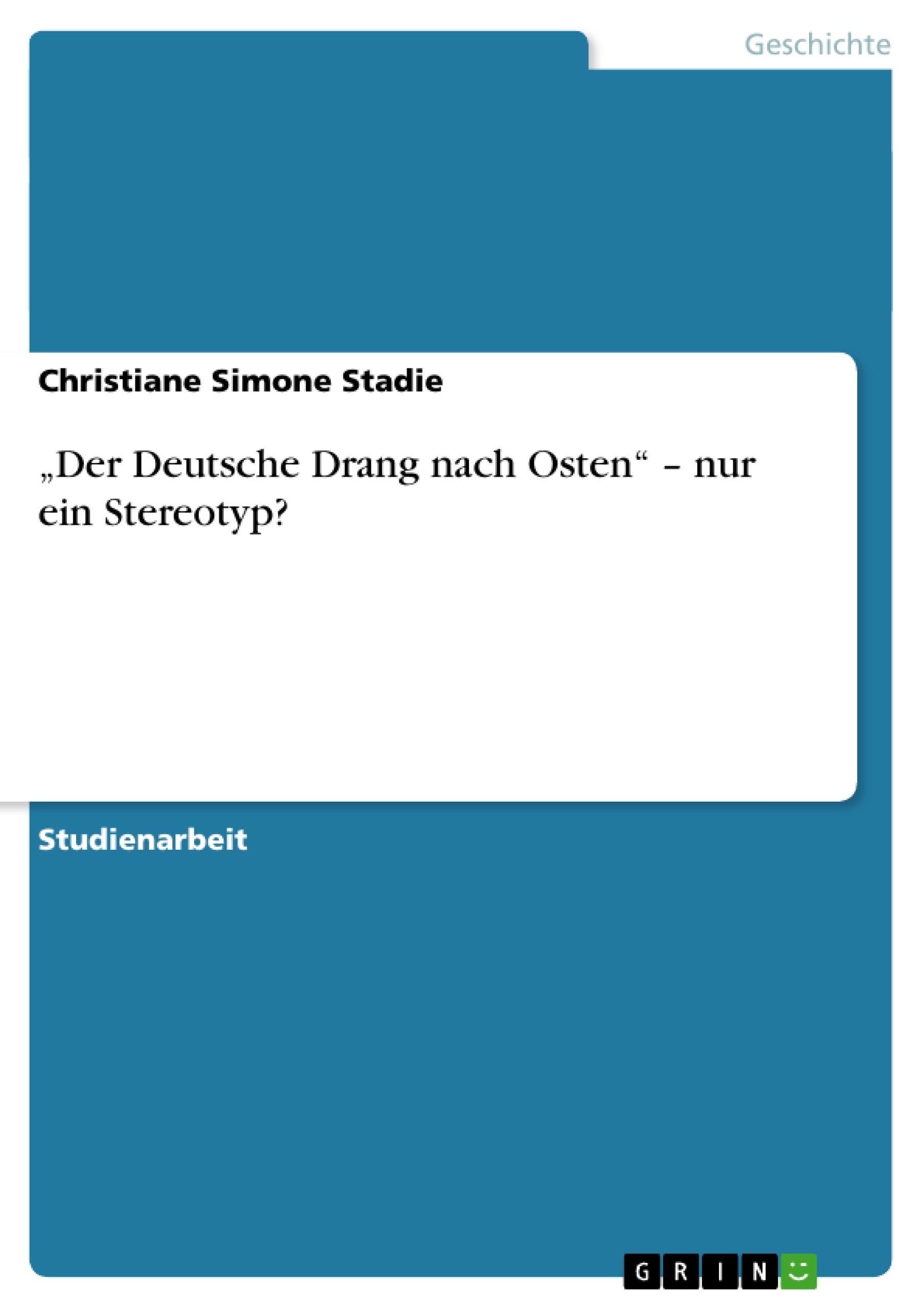„Der deutsche Drang nach Osten“ – ist dies nur eine rhetorische Phrase, ein Stereotyp oder historische Gewissheit? Schon viele Wissenschaftler haben sich eingehend mit diesem Themenfeld befasst. Die Germanen der Antike hätten bereits diesen Drang gen Osten ‚verspürt‘, welcher dann durch diverse deutsche Könige bzw. Kaiser und Ordensverbände des Mittelalters weiter vorangetrieben wurde. Die preußische Ostpolitik ließ diese Bestrebung wieder aufleben und eine „Inbesitznahme“ von beispielsweise polnischem Gebiet erfolgte.
Hier schieden sich jedoch Mitte des 19. Jahrhunderts bei Politiker und Historiker verschiedenster Nationalitäten die Geister. Die Deutschen waren sich sicher, dass sie sie einen historischen Anspruch für östliche Gebiete besäßen und es sei deutlich, dass z. B. Schlesien gar nicht slawisch sei, sondern, durch die Vielzahl von deutschen Bewohner, eben deutsch. Hierzu fand sich eine gegenteilige Meinung auf der slawischen Seite, welche den „deutschen Hegemonen“ Eroberungssucht und Täuschungen vorwirft, nur um ihr eigenes Gebiet zu vergrößern, Slawen zu verdrängen ggf. für sich arbeiten zu lassen und so ihre Einflusssphäre zu vergrößern. Die Slawen riefen zum allgemeinen Widerstand gegen die Deutschen auf.
Die Veröffentlichungen von Julian Klaczko “Die deutschen Hegemonen. Ein Sendschreiben an Georg Gervinus“ (1849) und Wilhelm Wattenbach “Die Germanisierung der östlichen Grenzmarken des deutschen Reiches” (Historische Zeitung, 1862) werden hier eingehend untersucht. Die aus den Texten herausgefilterten deutschen (germanischen) und polnischen (slawischen) Stereotypen werden mit dem übergeordneten Begriff bzw. Stereotyp „deutscher Drang nach Osten“ in Verbindung gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Einleitung
- 2. Grundlagen der Stereotypenforschung - Ein Abriss (Exkurs)
- 3. Definitionen und allgemeine Erläuterungen: "Deutscher Drang nach Osten"
- 4. Quellen
- 4.1 Julian Klaczko: “Die deutschen Hegemonen. Ein Sendschreiben an Georg Gervinus“ (1849)
- 4.2 Wilhelm Wattenbach: “Die Germanisierung der östlichen Grenzmarken des deutschen Reiches\" (Historische Zeitung, 1862)
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff "Deutscher Drang nach Osten" und hinterfragt dessen historische Genauigkeit und seinen Status als Stereotyp. Sie analysiert die unterschiedlichen Perspektiven deutscher und slawischer Historiker und Politiker im 19. Jahrhundert bezüglich der deutschen Ostpolitik und der Besiedlung östlicher Gebiete. Die Arbeit stützt sich auf die Analyse von Primärquellen, um die vorherrschenden Stereotypen und Geschichtsverständnisse darzustellen.
- Der "Deutsche Drang nach Osten" als historisches Phänomen und Stereotyp
- Konflikt und Antagonismus zwischen deutschen und slawischen Perspektiven im 19. Jahrhundert
- Analyse deutscher und slawischer Stereotypen in Bezug auf die Ostpolitik
- Die Rolle von Primärquellen in der historischen Stereotypenforschung
- Grundlagen der Stereotypenforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1.1 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Charakter des "Deutschen Drangs nach Osten" – rhetorische Phrase, Stereotyp oder historische Realität – vor. Sie skizziert den historischen Kontext, beginnend mit den Germanen der Antike bis zur preußischen Ostpolitik, und hebt den gegensätzlichen Standpunkt deutscher und slawischer Akteure im 19. Jahrhundert hervor. Der Konflikt betraf die Deutung historischer Ansprüche auf östliche Gebiete und mündete in gegensätzlichen Darstellungen: deutsche Sichtweise auf einen historischen Anspruch versus slawische Vorwürfe von Eroberungslust und Unterdrückung.
2. Grundlagen der Stereotypenforschung - Ein Abriss: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Stereotypenforschung, beginnend mit Freuds Konzept des "Narzissmus der kleinen Unterschiede". Es erläutert die Funktion von Stereotypen als Orientierungs- und Erklärungshilfen, sowohl für die Gegenwart als auch für die historische Wahrnehmung. Der semiotische Ansatz in der Forschung wird hervorgehoben, der die Analyse von Zeichensystemen in Gesellschaften zur Erforschung von Stereotypen nutzt. Die Bedeutung von Lippmanns Werk und Hahns Thesen zur Stereotypenforschung werden betont.
3. Definitionen und allgemeine Erläuterungen: "Deutscher Drang nach Osten": Dieses Kapitel definiert den Begriff "Deutscher Drang nach Osten" und beleuchtet dessen komplexe historische Bedeutung. Es diskutiert unterschiedliche Interpretationen und Theorien zur deutschen Ostsiedlung, wie die Kulturträger- und die Urgermanentheorie, die oft zur Rechtfertigung von Kolonisationsbewegungen herangezogen wurden. Das Kapitel analysiert auch die unterschiedlichen Perspektiven auf den "Osten" – religiös, orientalisch, europäisch und politisch – und deren Einfluss auf das Verhältnis zwischen Deutschen und ihren östlichen Nachbarn.
4. Quellen: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse zweier Quellen: Klaczkos "Die deutschen Hegemonen" und Wattenbachs Beitrag zur "Germanisierung der östlichen Grenzmarken". Durch die Analyse dieser Texte werden die jeweiligen Geschichtsverständnisse und die damaligen Sichtweisen auf den "Deutschen Drang nach Osten" aufgezeigt und die darin enthaltenen deutschen und slawischen Stereotypen extrahiert. Diese dienen der späteren Verbindung mit dem übergeordneten Stereotyp des "Deutschen Drangs nach Osten".
Schlüsselwörter
Deutscher Drang nach Osten, Stereotypenforschung, Ostpolitik, Germanen, Slawen, nationale Bilder, Geschichtsverständnis, Primärquellenanalyse, Kolonisation, Ostsiedlung, Polen, Deutschland, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Deutscher Drang nach Osten": Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Begriff "Deutscher Drang nach Osten" auf seine historische Genauigkeit und seinen Status als Stereotyp. Sie analysiert gegensätzliche Perspektiven deutscher und slawischer Historiker und Politiker des 19. Jahrhunderts bezüglich der deutschen Ostpolitik und der Besiedlung östlicher Gebiete, basierend auf der Analyse von Primärquellen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf zwei Primärquellen: Julian Klaczkos "Die deutschen Hegemonen. Ein Sendschreiben an Georg Gervinus" (1849) und Wilhelm Wattenbachs Beitrag "Die Germanisierung der östlichen Grenzmarken des deutschen Reiches" (Historische Zeitung, 1862). Diese Quellen werden detailliert analysiert, um die jeweiligen Geschichtsverständnisse und Stereotypen aufzuzeigen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den "Deutschen Drang nach Osten" als historisches Phänomen und Stereotyp; den Konflikt und Antagonismus zwischen deutschen und slawischen Perspektiven im 19. Jahrhundert; die Analyse deutscher und slawischer Stereotypen in Bezug auf die Ostpolitik; die Rolle von Primärquellen in der historischen Stereotypenforschung; und die Grundlagen der Stereotypenforschung selbst.
Wie wird der "Deutsche Drang nach Osten" definiert?
Die Arbeit beleuchtet die komplexe historische Bedeutung des Begriffs "Deutscher Drang nach Osten" und diskutiert unterschiedliche Interpretationen und Theorien zur deutschen Ostsiedlung, einschließlich der Kulturträger- und der Urgermanentheorie. Sie analysiert auch die unterschiedlichen Perspektiven auf den "Osten" – religiös, orientalisch, europäisch und politisch – und deren Einfluss auf das Verhältnis zwischen Deutschen und ihren östlichen Nachbarn.
Welche Rolle spielt die Stereotypenforschung?
Die Arbeit bietet einen Überblick über die Stereotypenforschung, beginnend mit Freuds Konzept des "Narzissmus der kleinen Unterschiede". Sie erläutert die Funktion von Stereotypen als Orientierungs- und Erklärungshilfen und hebt den semiotischen Ansatz in der Forschung hervor. Die Bedeutung von Lippmanns Werk und Hahns Thesen zur Stereotypenforschung wird betont.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen der Stereotypenforschung, ein Kapitel zur Definition und Erläuterung des "Deutschen Drangs nach Osten", ein Kapitel zur Quellenanalyse und eine Schlussbetrachtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutscher Drang nach Osten, Stereotypenforschung, Ostpolitik, Germanen, Slawen, nationale Bilder, Geschichtsverständnis, Primärquellenanalyse, Kolonisation, Ostsiedlung, Polen, Deutschland, 19. Jahrhundert.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist der Charakter des "Deutschen Drangs nach Osten": Handelt es sich um eine rhetorische Phrase, einen Stereotyp oder eine historische Realität?
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die HTML-Datei enthält keine explizite Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung muss aus der Analyse der Primärquellen und der dargestellten Perspektiven abgeleitet werden.)
- Quote paper
- M.A. Christiane Simone Stadie (Author), 2011, „Der Deutsche Drang nach Osten“ – nur ein Stereotyp?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208011